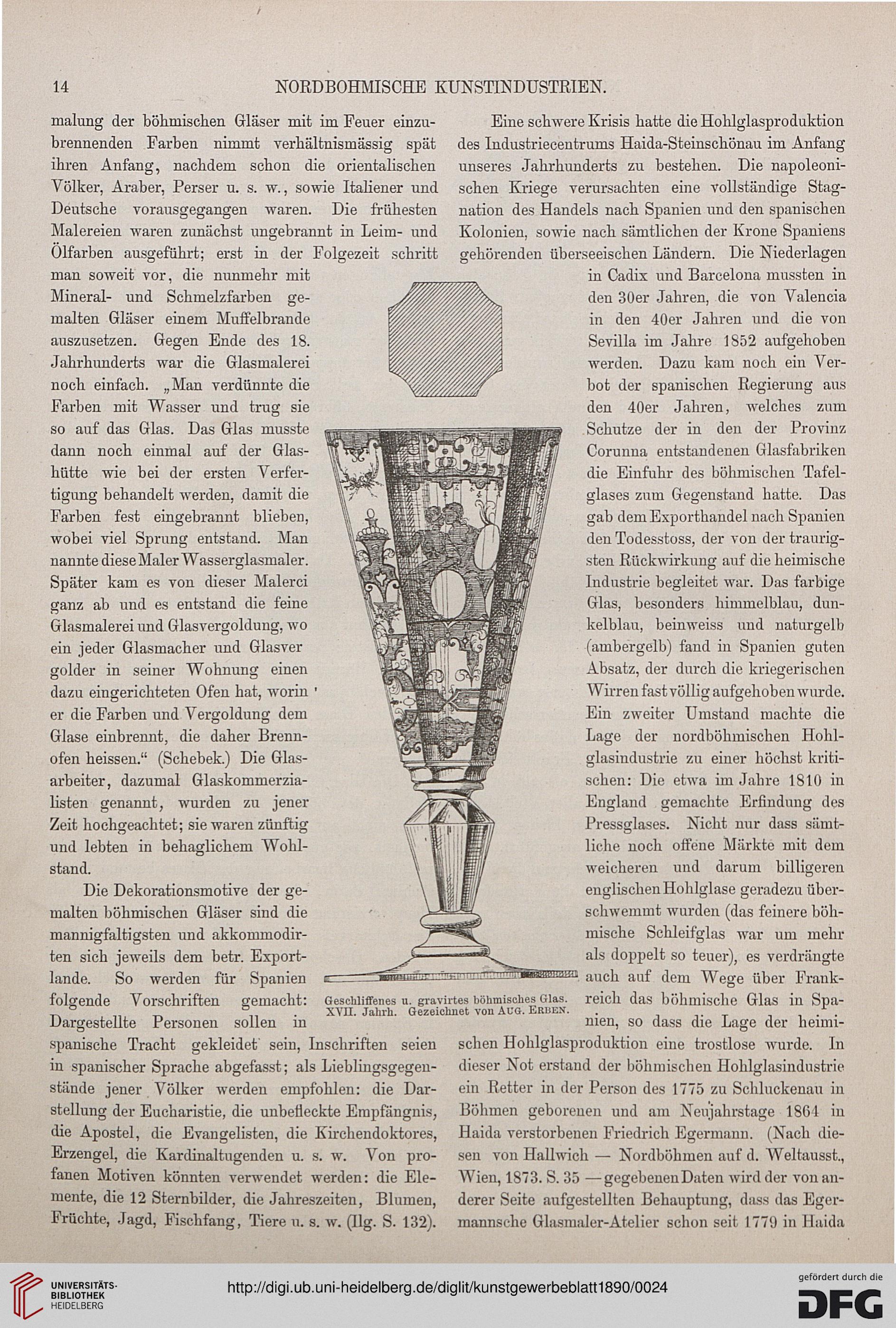14
NORDBOHMISCHE KUNSTINDUSTRIEN.
malung der böhmischen Gläser mit im Feuer einzu-
brennenden Farben nimmt verhältnismässig spät
ihren Anfang, nachdem schon die orientalischen
Völker, Araber, Perser u. s. w., sowie Italiener und
Deutsche vorausgegangen waren. Die frühesten
Malereien waren zunächst ungebrannt in Leim- und
Ölfarben ausgeführt; erst in der Folgezeit schritt
man soweit vor, die nunmehr mit
Mineral- und Schmelzfarben ge-
malten Gläser einem Muffelbrande
auszusetzen. Gegen Ende des 18.
Jahrhunderts war die Glasmalerei
noch einfach. „Man verdünnte die
Farben mit Wasser und trug sie
so auf das Glas. Das Glas musste
dann noch einmal auf der Glas-
hütte wie bei der ersten Verfer-
tigung behandelt werden, damit die
Farben fest eingebrannt blieben,
wobei viel Sprung entstand. Man
nannte diese Maler Wasserglasmaler.
Später kam es von dieser Malerei
ganz ab und es entstand die feine
Glasmalerei und Glasvergoldung, wo
ein jeder Glasmacher und Glasver
golder in seiner Wohnung einen
dazu eingerichteten Ofen hat, worin '
er die Farben und Vergoldung dem
Glase einbrennt, die daher Brenn-
ofen heissen." (Schebek.) Die Glas-
arbeiter, dazumal Glaskommerzia-
listen genannt, wurden zu jener
Zeit hochgeachtet; sie waren zünftig
und lebten in behaglichem Wohl-
stand.
Die Dekorationsmotive der ge-
malten böhmischen Gläser sind die
mannigfaltigsten und akkommodir-
ten sich jeweils dem betr. Export-
lande. So werden für Spanien
folgende Vorschriften gemacht:
Dargestellte Personen sollen in
spanische Tracht gekleidet' sein, Inschriften seien
in spanischer Sprache abgefasst; als Lieblingsgegen-
stände jener Völker werden empfohlen: die Dar-
stellung der Eucharistie, die unbefleckte Empfängnis,
die Apostel, die Evangelisten, die Kirchendoktores,
Erzengel, die Kardinaltugenden u. s. w. Von pro-
fanen Motiven könnten verwendet werden: die Ele-
mente, die 12 Sternbilder, die Jahreszeiten, Blumen,
Früchte, Jagd, Fischfang, Tiere u. s. w. (Hg. S. 132).
Geschliffenes u. gravirtes böhmisches Glas.
XVII. Jahrh. Gezeichnet von Aug. Erben.
Eine schwere Krisis hatte die Hohlglasproduktion
des Industriecentrums Haida-Steinschönau im Anfang
unseres Jahrhunderts zu bestehen. Die napoleoni-
schen Kriege verursachten eine vollständige Stag-
nation des Handels nach Spanien und den spanischen
Kolonien, sowie nach sämtlichen der Krone Spaniens
gehörenden überseeischen Ländern. Die Niederlagen
in Cadix und Barcelona mussten in
den 30er Jahren, die von Valencia
in den 40er Jahren und die von
Sevilla im Jahre 1852 aufgehoben
werden. Dazu kam noch ein Ver-
bot der spanischen Regierung aus
den 40er Jahren, welches zum
Schutze der in den der Provinz
Corunna entstandenen Glasfabriken
die Einfuhr des böhmischen Tafel-
glases zum Gegenstand hatte. Das
gab dem Exporthandel nach Spanien
den Todesstoss, der von der traurig-
sten Rückwirkung auf die heimische
Industrie begleitet war. Das farbige
Glas, besonders himmelblau, dun-
kelblau, beinweiss und naturgelb
(ambergelb) fand in Spanien guten
Absatz, der durch die kriegerischen
Wirren fast völlig aufgehoben wurde.
Ein zweiter Umstand machte die
Lage der nordböhmischen Hohl-
glasindustrie zu einer höchst kriti-
schen: Die etwa im Jabre 1810 in
England gemachte Erfindung des
Pressglases. Nicht nur dass sämt-
liche noch offene Märkte mit dem
weicheren und darum billigeren
englischen Hohlglase geradezu über-
schwemmt wurden (das feinere böh-
mische Schleifglas war um mehr
als doppelt so teuer), es verdrängte
n auch auf dem Wege über Frank-
reich das böhmische Glas in Spa-
nien, so dass die Lage der heimi-
schen Hohlglasproduktion eine trostlose wurde. In
dieser Not erstand der böhmischen Hohlglasindustrie
ein Retter in der Person des 1775 zu Schluckenau in
Böhmen geborenen und am Neujahrstage 1861 in
Haida verstorbenen Friedrich Egermann. (Nach die-
sen von Hallwich — Nordböhmen auf d. Weltausst.,
Wien, 1873. S. 35 —gegebenen Daten wird der von an-
derer Seite aufgestellten Behauptung, dass das Eger-
mannsche Glasmaler-Atelier schon seit 1779 in Haida
NORDBOHMISCHE KUNSTINDUSTRIEN.
malung der böhmischen Gläser mit im Feuer einzu-
brennenden Farben nimmt verhältnismässig spät
ihren Anfang, nachdem schon die orientalischen
Völker, Araber, Perser u. s. w., sowie Italiener und
Deutsche vorausgegangen waren. Die frühesten
Malereien waren zunächst ungebrannt in Leim- und
Ölfarben ausgeführt; erst in der Folgezeit schritt
man soweit vor, die nunmehr mit
Mineral- und Schmelzfarben ge-
malten Gläser einem Muffelbrande
auszusetzen. Gegen Ende des 18.
Jahrhunderts war die Glasmalerei
noch einfach. „Man verdünnte die
Farben mit Wasser und trug sie
so auf das Glas. Das Glas musste
dann noch einmal auf der Glas-
hütte wie bei der ersten Verfer-
tigung behandelt werden, damit die
Farben fest eingebrannt blieben,
wobei viel Sprung entstand. Man
nannte diese Maler Wasserglasmaler.
Später kam es von dieser Malerei
ganz ab und es entstand die feine
Glasmalerei und Glasvergoldung, wo
ein jeder Glasmacher und Glasver
golder in seiner Wohnung einen
dazu eingerichteten Ofen hat, worin '
er die Farben und Vergoldung dem
Glase einbrennt, die daher Brenn-
ofen heissen." (Schebek.) Die Glas-
arbeiter, dazumal Glaskommerzia-
listen genannt, wurden zu jener
Zeit hochgeachtet; sie waren zünftig
und lebten in behaglichem Wohl-
stand.
Die Dekorationsmotive der ge-
malten böhmischen Gläser sind die
mannigfaltigsten und akkommodir-
ten sich jeweils dem betr. Export-
lande. So werden für Spanien
folgende Vorschriften gemacht:
Dargestellte Personen sollen in
spanische Tracht gekleidet' sein, Inschriften seien
in spanischer Sprache abgefasst; als Lieblingsgegen-
stände jener Völker werden empfohlen: die Dar-
stellung der Eucharistie, die unbefleckte Empfängnis,
die Apostel, die Evangelisten, die Kirchendoktores,
Erzengel, die Kardinaltugenden u. s. w. Von pro-
fanen Motiven könnten verwendet werden: die Ele-
mente, die 12 Sternbilder, die Jahreszeiten, Blumen,
Früchte, Jagd, Fischfang, Tiere u. s. w. (Hg. S. 132).
Geschliffenes u. gravirtes böhmisches Glas.
XVII. Jahrh. Gezeichnet von Aug. Erben.
Eine schwere Krisis hatte die Hohlglasproduktion
des Industriecentrums Haida-Steinschönau im Anfang
unseres Jahrhunderts zu bestehen. Die napoleoni-
schen Kriege verursachten eine vollständige Stag-
nation des Handels nach Spanien und den spanischen
Kolonien, sowie nach sämtlichen der Krone Spaniens
gehörenden überseeischen Ländern. Die Niederlagen
in Cadix und Barcelona mussten in
den 30er Jahren, die von Valencia
in den 40er Jahren und die von
Sevilla im Jahre 1852 aufgehoben
werden. Dazu kam noch ein Ver-
bot der spanischen Regierung aus
den 40er Jahren, welches zum
Schutze der in den der Provinz
Corunna entstandenen Glasfabriken
die Einfuhr des böhmischen Tafel-
glases zum Gegenstand hatte. Das
gab dem Exporthandel nach Spanien
den Todesstoss, der von der traurig-
sten Rückwirkung auf die heimische
Industrie begleitet war. Das farbige
Glas, besonders himmelblau, dun-
kelblau, beinweiss und naturgelb
(ambergelb) fand in Spanien guten
Absatz, der durch die kriegerischen
Wirren fast völlig aufgehoben wurde.
Ein zweiter Umstand machte die
Lage der nordböhmischen Hohl-
glasindustrie zu einer höchst kriti-
schen: Die etwa im Jabre 1810 in
England gemachte Erfindung des
Pressglases. Nicht nur dass sämt-
liche noch offene Märkte mit dem
weicheren und darum billigeren
englischen Hohlglase geradezu über-
schwemmt wurden (das feinere böh-
mische Schleifglas war um mehr
als doppelt so teuer), es verdrängte
n auch auf dem Wege über Frank-
reich das böhmische Glas in Spa-
nien, so dass die Lage der heimi-
schen Hohlglasproduktion eine trostlose wurde. In
dieser Not erstand der böhmischen Hohlglasindustrie
ein Retter in der Person des 1775 zu Schluckenau in
Böhmen geborenen und am Neujahrstage 1861 in
Haida verstorbenen Friedrich Egermann. (Nach die-
sen von Hallwich — Nordböhmen auf d. Weltausst.,
Wien, 1873. S. 35 —gegebenen Daten wird der von an-
derer Seite aufgestellten Behauptung, dass das Eger-
mannsche Glasmaler-Atelier schon seit 1779 in Haida