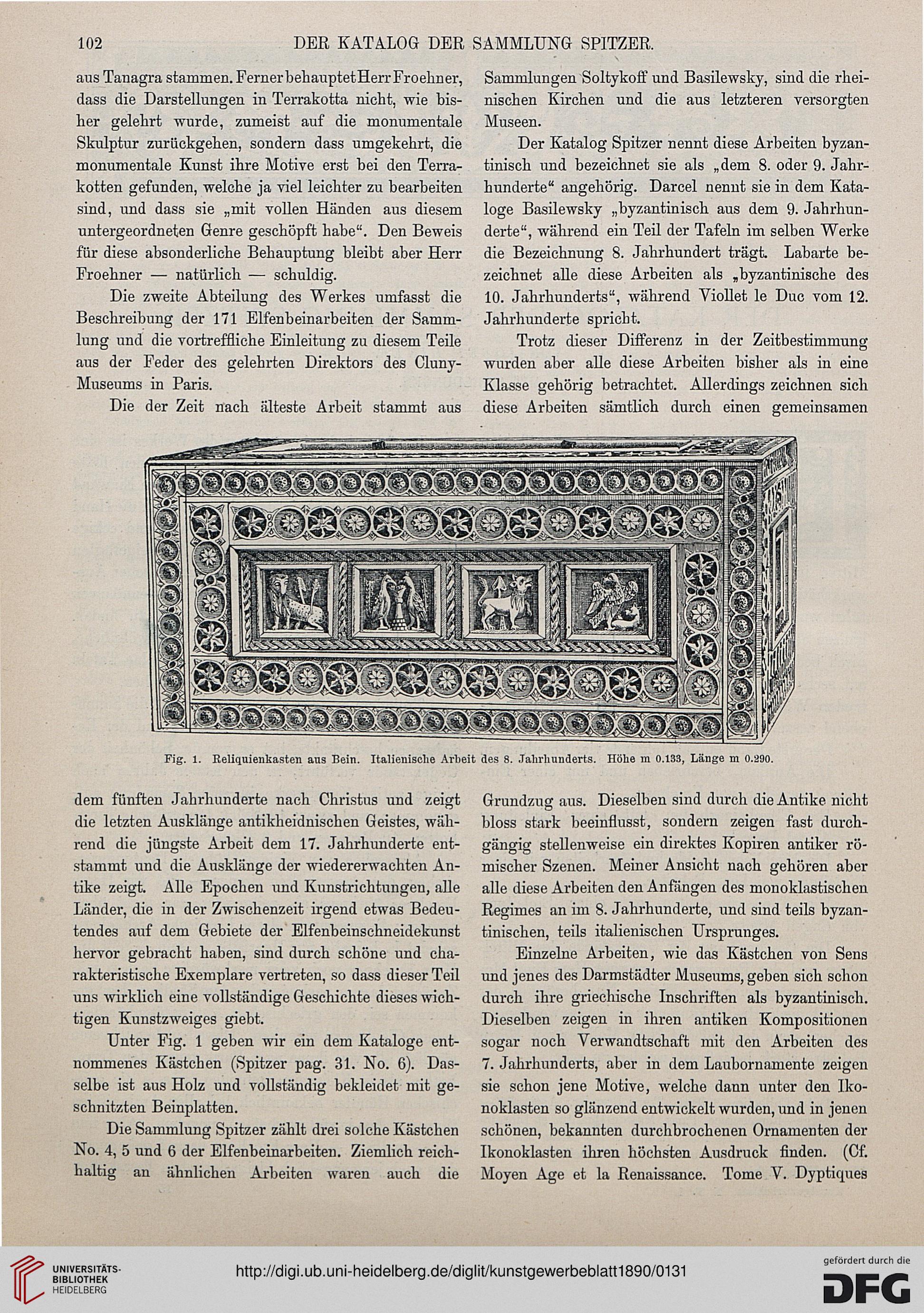102
DER KATALOG DER SAMMLUNG SPITZER.
aus Tanagra stammen. FernerbehauptetHerr Froehner,
dass die Darstellungen in Terrakotta nicht, wie bis-
her gelehrt wurde, zumeist auf die monumentale
Skulptur zurückgehen, sondern dass umgekehrt, die
monumentale Kunst ihre Motive erst bei den Terra-
kotten gefunden, welche ja viel leichter zu bearbeiten
sind, und dass sie „mit vollen Händen aus diesem
untergeordneten Genre geschöpft habe". Den Beweis
für diese absonderliche Behauptung bleibt aber Herr
Froehner — natürlich — schuldig.
Die zweite Abteilung des Werkes umfasst die
Beschreibung der 171 Elfenbeinarbeiten der Samm-
lung und die vortreffliche Einleitung zu diesem Teile
aus der Feder des gelehrten Direktors des Cluny-
Museums in Paris.
Die der Zeit nach älteste Arbeit stammt aus
Sammlungen Soltykoff und Basilewsky, sind die rhei-
nischen Kirchen und die aus letzteren versorgten
Museen.
Der Katalog Spitzer nennt diese Arbeiten byzan-
tinisch und bezeichnet sie als „dem 8. oder 9. Jahr-
hunderte" angehörig. Darcel nennt sie in dem Kata-
loge Basilewsky „byzantinisch aus dem 9. Jahrhun-
derte", während ein Teil der Tafeln im selben Werke
die Bezeichnung 8. Jahrhundert trägt Labarte be-
zeichnet alle diese Arbeiten als „byzantinische des
10. Jahrhunderts", während Viollet le Duo vom 12.
Jahrhunderte spricht.
Trotz dieser Differenz in der Zeitbestimmung
wurden aber alle diese Arbeiten bisher als in eine
Klasse gehörig betrachtet. Allerdings zeichnen sich
diese Arbeiten sämtlich durch einen gemeinsamen
Fig. 1. Reliquienkasten aus Bein. Italienische Arbeit des 8. Jahrhunderts. Höhe m 0.133, Länge m 0.290.
dem fünften Jahrhunderte nach Christus und zeigt
die letzten Ausklänge antikheidnischen Geistes, wäh-
rend die jüngste Arbeit dem 17. Jahrhunderte ent-
stammt und die Ausklänge der wiedererwachten An-
tike zeigt. Alle Epochen und Kunstrichtungen, alle
Länder, die in der Zwischenzeit irgend etwas Bedeu-
tendes auf dem Gebiete der Elfenbeinschneidekunst
hervor gebracht haben, sind durch schöne und cha-
rakteristische Exemplare vertreten, so dass dieser Teil
uns wirklich eine vollständige Geschichte dieses wich-
tigen Kunstzweiges giebt.
Unter Fig. 1 geben wir ein dem Kataloge ent-
nommenes Kästchen (Spitzer pag. 31. No. 6). Das-
selbe ist aus Holz und vollständig bekleidet mit ge-
schnitzten Beinplatten.
Die Sammlung Spitzer zählt drei solche Kästchen
No. 4, 5 und 6 der Elfenbeinarbeiten. Ziemlich reich-
haltig an ähnlichen Arbeiten waren auch die
Grundzug aus. Dieselben sind durch die Antike nicht
bloss stark beeinflusst, sondern zeigen fast durch-
gängig stellenweise ein direktes Kopiren antiker rö-
mischer Szenen. Meiner Ansicht nach gehören aber
alle diese Arbeiten den Anfängen des monoklastischen
Regimes an im 8. Jahrhunderte, und sind teils byzan-
tinischen, teils italienischen Ursprunges.
Einzelne Arbeiten, wie das Kästchen von Sens
und jenes des Darmstädter Museums, geben sich schon
durch ihre griechische Inschriften als byzantinisch.
Dieselben zeigen in ihren antiken Kompositionen
sogar noch Verwandtschaft mit den Arbeiten des
7. Jahrhunderts, aber in dem Laubornamente zeigen
sie schon jene Motive, welche dann unter den Iko-
noklasten so glänzend entwickelt wurden, und in jenen
schönen, bekannten durchbrochenen Ornamenten der
Ikonoklasten ihren höchsten Ausdruck finden. (Cf.
Moyen Age et la Renaissance. Tome V. Dyptiques
DER KATALOG DER SAMMLUNG SPITZER.
aus Tanagra stammen. FernerbehauptetHerr Froehner,
dass die Darstellungen in Terrakotta nicht, wie bis-
her gelehrt wurde, zumeist auf die monumentale
Skulptur zurückgehen, sondern dass umgekehrt, die
monumentale Kunst ihre Motive erst bei den Terra-
kotten gefunden, welche ja viel leichter zu bearbeiten
sind, und dass sie „mit vollen Händen aus diesem
untergeordneten Genre geschöpft habe". Den Beweis
für diese absonderliche Behauptung bleibt aber Herr
Froehner — natürlich — schuldig.
Die zweite Abteilung des Werkes umfasst die
Beschreibung der 171 Elfenbeinarbeiten der Samm-
lung und die vortreffliche Einleitung zu diesem Teile
aus der Feder des gelehrten Direktors des Cluny-
Museums in Paris.
Die der Zeit nach älteste Arbeit stammt aus
Sammlungen Soltykoff und Basilewsky, sind die rhei-
nischen Kirchen und die aus letzteren versorgten
Museen.
Der Katalog Spitzer nennt diese Arbeiten byzan-
tinisch und bezeichnet sie als „dem 8. oder 9. Jahr-
hunderte" angehörig. Darcel nennt sie in dem Kata-
loge Basilewsky „byzantinisch aus dem 9. Jahrhun-
derte", während ein Teil der Tafeln im selben Werke
die Bezeichnung 8. Jahrhundert trägt Labarte be-
zeichnet alle diese Arbeiten als „byzantinische des
10. Jahrhunderts", während Viollet le Duo vom 12.
Jahrhunderte spricht.
Trotz dieser Differenz in der Zeitbestimmung
wurden aber alle diese Arbeiten bisher als in eine
Klasse gehörig betrachtet. Allerdings zeichnen sich
diese Arbeiten sämtlich durch einen gemeinsamen
Fig. 1. Reliquienkasten aus Bein. Italienische Arbeit des 8. Jahrhunderts. Höhe m 0.133, Länge m 0.290.
dem fünften Jahrhunderte nach Christus und zeigt
die letzten Ausklänge antikheidnischen Geistes, wäh-
rend die jüngste Arbeit dem 17. Jahrhunderte ent-
stammt und die Ausklänge der wiedererwachten An-
tike zeigt. Alle Epochen und Kunstrichtungen, alle
Länder, die in der Zwischenzeit irgend etwas Bedeu-
tendes auf dem Gebiete der Elfenbeinschneidekunst
hervor gebracht haben, sind durch schöne und cha-
rakteristische Exemplare vertreten, so dass dieser Teil
uns wirklich eine vollständige Geschichte dieses wich-
tigen Kunstzweiges giebt.
Unter Fig. 1 geben wir ein dem Kataloge ent-
nommenes Kästchen (Spitzer pag. 31. No. 6). Das-
selbe ist aus Holz und vollständig bekleidet mit ge-
schnitzten Beinplatten.
Die Sammlung Spitzer zählt drei solche Kästchen
No. 4, 5 und 6 der Elfenbeinarbeiten. Ziemlich reich-
haltig an ähnlichen Arbeiten waren auch die
Grundzug aus. Dieselben sind durch die Antike nicht
bloss stark beeinflusst, sondern zeigen fast durch-
gängig stellenweise ein direktes Kopiren antiker rö-
mischer Szenen. Meiner Ansicht nach gehören aber
alle diese Arbeiten den Anfängen des monoklastischen
Regimes an im 8. Jahrhunderte, und sind teils byzan-
tinischen, teils italienischen Ursprunges.
Einzelne Arbeiten, wie das Kästchen von Sens
und jenes des Darmstädter Museums, geben sich schon
durch ihre griechische Inschriften als byzantinisch.
Dieselben zeigen in ihren antiken Kompositionen
sogar noch Verwandtschaft mit den Arbeiten des
7. Jahrhunderts, aber in dem Laubornamente zeigen
sie schon jene Motive, welche dann unter den Iko-
noklasten so glänzend entwickelt wurden, und in jenen
schönen, bekannten durchbrochenen Ornamenten der
Ikonoklasten ihren höchsten Ausdruck finden. (Cf.
Moyen Age et la Renaissance. Tome V. Dyptiques