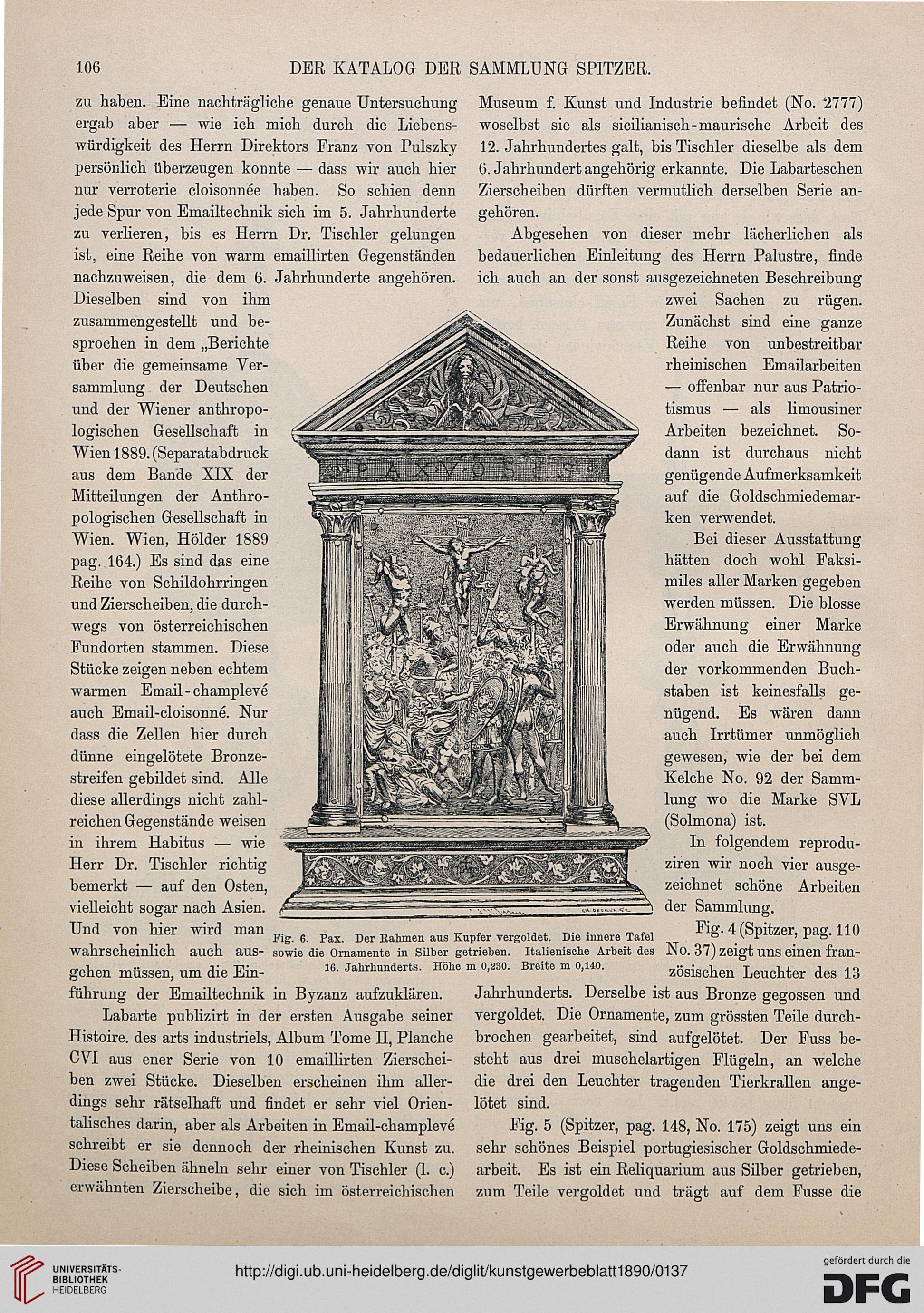106
DER KATALOG DER SAMMLUNG SPITZER.
zu haben. Eine nachträgliche genaue Untersuchung
ergab aber — wie ich mich durch die Liebens-
würdigkeit des Herrn Direktors Franz von Pulszky
persönlich überzeugen konnte — dass wir auch hier
nur verroterie cloisonnee haben. So schien denn
jede Spur von Emailtechnik sich im 5. Jahrhunderte
zu verlieren, bis es Herrn Dr. Tischler gelungen
ist, eine Reihe von warm emaillirten Gegenständen
nachzuweisen, die dem 6. Jahrhunderte angehören.
Dieselben sind von ihm
zusammengestellt und be-
sprochen in dem „Berichte
über die gemeinsame Ver-
sammlung der Deutschen
und der Wiener anthropo-
logischen Gesellschaft in
Wien 1889. (Separatabdruck
aus dem Bande XIX der
Mitteilungen der Anthro-
pologischen Gesellschaft in
Wien. Wien, Holder 1889
pag. 164.) Es sind das eine
Reihe von Schildohrringen
und Zierscheiben, die durch-
wegs von österreichischen
Fundorten stammen. Diese
Stücke zeigen neben echtem
warmen E mail - champleve
auch Email-cloisonne. Nur
dass die Zellen hier durch
dünne eingelötete Bronze-
streifen gebildet sind. Alle
diese allerdings nicht zahl-
reichen Gegenstände weisen
in ihrem Habitus — wie
Herr Dr. Tischler richtig
bemerkt — auf den Osten,
vielleicht sogar nach Asien.
Und von hier wird man
Museum f. Kunst und Industrie befindet (No. 2777)
woselbst sie als sicilianisch-maurische Arbeit des
12. Jahrhundertes galt, bis Tischler dieselbe als dem
6. Jahrhundert angehörig erkannte. Die Labarteschen
Zierscheiben dürften vermutlich derselben Serie an-
gehören.
Abgesehen von dieser mehr lächerlichen als
bedauerlichen Einleitung des Herrn Palustre, finde
ich auch an der sonst ausgezeichneten Beschreibung
zwei Sachen zu rügen.
Zunächst sind eine ganze
Reihe von unbestreitbar
rheinischen Emailarbeiten
— offenbar nur aus Patrio-
tismus — als limousiner
Arbeiten bezeichnet. So-
dann ist durchaus nicht
genügende Aufmerksamkeit
auf die Goldschmiedemar-
ken verwendet.
Bei dieser Ausstattung
hätten doch wohl Faksi-
miles aller Marken gegeben
werden müssen. Die blosse
Erwähnung einer Marke
oder auch die Erwähnung
der vorkommenden Buch-
staben ist keinesfalls ge-
nügend. Es wären dann
auch Irrtümer unmöglich
gewesen, wie der bei dem
Kelche No. 92 der Samm-
lung wo die Marke SVL
(Solmona) ist.
In folgendem reprodu-
ziren wir noch vier ausge-
zeichnet schöne Arbeiten
der Sammlung.
Fig. 4 (Spitzer, pag. 110
Fig. 6. Pax. Der Rahmen aus Kupfer vergoldet. Die innere Tafel
wahrscheinlich auch aus- sowie die Ornamente in Silber getrieben. Italienische Arbeit des No. 37) zeigt Uns einen fran
gehen müssen, um die Ein- 16- -^hunderts. Höhe m 0,2B0. Breite m 0,140.
führung der Emailtechnik in Byzanz aufzuklären.
Labarte publizirt in der ersten Ausgabe seiner
Histoire. des arts industriels, Album Tome H, Planche
CVI aus ener Serie von 10 emaillirten Zierschei-
ben zwei Stücke. Dieselben erscheinen ihm aller-
dings sehr rätselhaft und findet er sehr viel Orien-
talisches darin, aber als Arbeiten in Email-champleve
schreibt er sie dennoch der rheinischen Kunst zu.
Diese Scheiben ähneln sehr einer von Tischler (1. c.)
erwähnten Zierscheibe, die sich im österreichischen
zösischen Leuchter des 13
Jahrhunderts. Derselbe ist aus Bronze gegossen und
vergoldet. Die Ornamente, zum grössten Teile durch-
brochen gearbeitet, sind aufgelötet. Der Fuss be-
steht aus drei muschelartigen Flügeln, an welche
die drei den Leuchter tragenden Tierkrallen ange-
lötet sind.
Fig. 5 (Spitzer, pag. 148, No. 175) zeigt uns ein
sehr schönes Beispiel portugiesischer Goldschmiede-
arbeit. Es ist ein Reliquarium aus Silber getrieben,
zum Teile vergoldet und trägt auf dem Fusse die
DER KATALOG DER SAMMLUNG SPITZER.
zu haben. Eine nachträgliche genaue Untersuchung
ergab aber — wie ich mich durch die Liebens-
würdigkeit des Herrn Direktors Franz von Pulszky
persönlich überzeugen konnte — dass wir auch hier
nur verroterie cloisonnee haben. So schien denn
jede Spur von Emailtechnik sich im 5. Jahrhunderte
zu verlieren, bis es Herrn Dr. Tischler gelungen
ist, eine Reihe von warm emaillirten Gegenständen
nachzuweisen, die dem 6. Jahrhunderte angehören.
Dieselben sind von ihm
zusammengestellt und be-
sprochen in dem „Berichte
über die gemeinsame Ver-
sammlung der Deutschen
und der Wiener anthropo-
logischen Gesellschaft in
Wien 1889. (Separatabdruck
aus dem Bande XIX der
Mitteilungen der Anthro-
pologischen Gesellschaft in
Wien. Wien, Holder 1889
pag. 164.) Es sind das eine
Reihe von Schildohrringen
und Zierscheiben, die durch-
wegs von österreichischen
Fundorten stammen. Diese
Stücke zeigen neben echtem
warmen E mail - champleve
auch Email-cloisonne. Nur
dass die Zellen hier durch
dünne eingelötete Bronze-
streifen gebildet sind. Alle
diese allerdings nicht zahl-
reichen Gegenstände weisen
in ihrem Habitus — wie
Herr Dr. Tischler richtig
bemerkt — auf den Osten,
vielleicht sogar nach Asien.
Und von hier wird man
Museum f. Kunst und Industrie befindet (No. 2777)
woselbst sie als sicilianisch-maurische Arbeit des
12. Jahrhundertes galt, bis Tischler dieselbe als dem
6. Jahrhundert angehörig erkannte. Die Labarteschen
Zierscheiben dürften vermutlich derselben Serie an-
gehören.
Abgesehen von dieser mehr lächerlichen als
bedauerlichen Einleitung des Herrn Palustre, finde
ich auch an der sonst ausgezeichneten Beschreibung
zwei Sachen zu rügen.
Zunächst sind eine ganze
Reihe von unbestreitbar
rheinischen Emailarbeiten
— offenbar nur aus Patrio-
tismus — als limousiner
Arbeiten bezeichnet. So-
dann ist durchaus nicht
genügende Aufmerksamkeit
auf die Goldschmiedemar-
ken verwendet.
Bei dieser Ausstattung
hätten doch wohl Faksi-
miles aller Marken gegeben
werden müssen. Die blosse
Erwähnung einer Marke
oder auch die Erwähnung
der vorkommenden Buch-
staben ist keinesfalls ge-
nügend. Es wären dann
auch Irrtümer unmöglich
gewesen, wie der bei dem
Kelche No. 92 der Samm-
lung wo die Marke SVL
(Solmona) ist.
In folgendem reprodu-
ziren wir noch vier ausge-
zeichnet schöne Arbeiten
der Sammlung.
Fig. 4 (Spitzer, pag. 110
Fig. 6. Pax. Der Rahmen aus Kupfer vergoldet. Die innere Tafel
wahrscheinlich auch aus- sowie die Ornamente in Silber getrieben. Italienische Arbeit des No. 37) zeigt Uns einen fran
gehen müssen, um die Ein- 16- -^hunderts. Höhe m 0,2B0. Breite m 0,140.
führung der Emailtechnik in Byzanz aufzuklären.
Labarte publizirt in der ersten Ausgabe seiner
Histoire. des arts industriels, Album Tome H, Planche
CVI aus ener Serie von 10 emaillirten Zierschei-
ben zwei Stücke. Dieselben erscheinen ihm aller-
dings sehr rätselhaft und findet er sehr viel Orien-
talisches darin, aber als Arbeiten in Email-champleve
schreibt er sie dennoch der rheinischen Kunst zu.
Diese Scheiben ähneln sehr einer von Tischler (1. c.)
erwähnten Zierscheibe, die sich im österreichischen
zösischen Leuchter des 13
Jahrhunderts. Derselbe ist aus Bronze gegossen und
vergoldet. Die Ornamente, zum grössten Teile durch-
brochen gearbeitet, sind aufgelötet. Der Fuss be-
steht aus drei muschelartigen Flügeln, an welche
die drei den Leuchter tragenden Tierkrallen ange-
lötet sind.
Fig. 5 (Spitzer, pag. 148, No. 175) zeigt uns ein
sehr schönes Beispiel portugiesischer Goldschmiede-
arbeit. Es ist ein Reliquarium aus Silber getrieben,
zum Teile vergoldet und trägt auf dem Fusse die