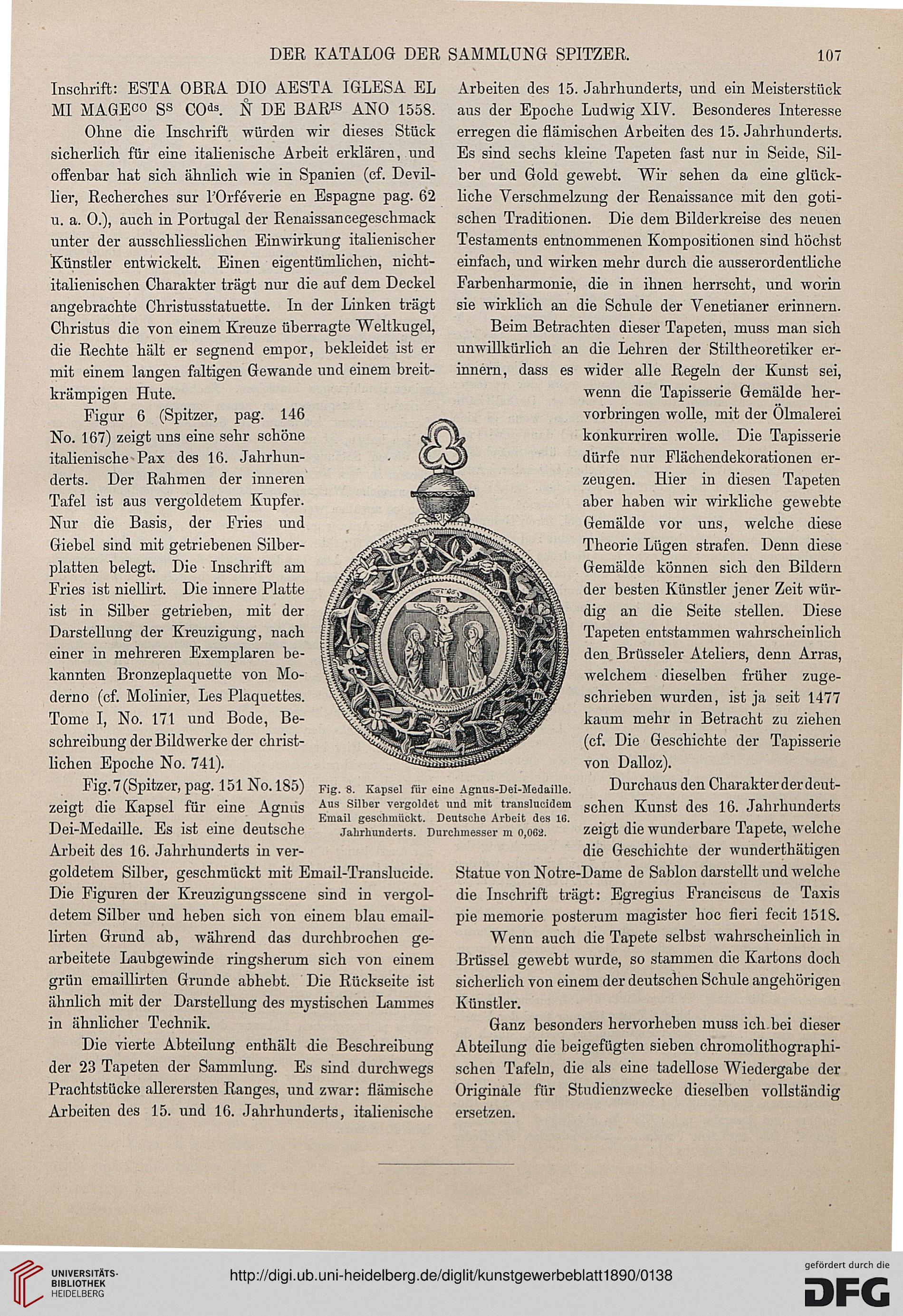DER KATALOG DER SAMMLUNG SPITZER.
107
Inschrift: ESTA OBRA DIO AESTA IGLESA EL
MI MAGEco Ss COds. N DE BARIS ANO 1558.
Ohne die Inschrift würden wir dieses Stück
sicherlich für eine italienische Arbeit erklären, und
offenbar hat sich ähnlich wie in Spanien (cf. Devil-
lier, Recherches sur POrfeverie en Espagne pag. 62
u. a. 0.), auch in Portugal der Renaissancegeschmack
unter der ausschliesslichen Einwirkung italienischer
Künstler entwickelt. Einen eigentümlichen, nicht-
italienischen Charakter trägt nur die auf dem Deckel
angebrachte Christusstatuette. In der Linken trägt
Christus die von einem Kreuze überragte Weltkugel,
die Rechte hält er segnend empor, bekleidet ist er
mit einem langen faltigen Gewände und einem breit-
krämpigen Hute.
Figur 6 (Spitzer, pag. 146
No. 167) zeigt uns eine sehr schöne
italienische-Pax des 16. Jahrhun-
derts. Der Rahmen der inneren
Tafel ist aus vergoldetem Kupfer.
Nur die Basis, der Fries und
Giebel sind mit getriebenen Silber-
platten belegt. Die Inschrift am
Fries ist niellirt. Die innere Platte
ist in Silber getrieben, mit der
Darstellung der Kreuzigung, nach
einer in mehreren Exemplaren be-
kannten Bronzeplaquette von Mo-
derno (cf. Molinier, Les Plaquettes.
Tome I, No. 171 und Bode, Be-
schreibung der Bildwerke der christ-
lichen Epoche No. 741).
Fig. 7 (Spitzer, pag. 151 No. 185) Fig. 8. Kapsel für eine Agnus-Dei-Medaille
zeigt die Kapsel für eine Agnus Aus silber vergoldet und mit transiucidem
. . ' Email geschmückt. Deutsche Arbeit des IG.
Dei-Medaille. Es ist eine deutsche Jahrhunderts
Arbeit des 16. Jahrhunderts in ver-
goldetem Silber, geschmückt mit Email-Translucide.
Die Figuren der Kreuzigungsscene sind in vergol-
detem Silber und heben sich von einem blau email-
lirten Grund ab, während das durchbrochen ge-
arbeitete Laubgewinde ringsherum sich von einem
grün emaillirten Grunde abhebt. Die Rückseite ist
ähnlich mit der Darstellung des mystischen Lammes
in ähnlicher Technik.
Die vierte Abteilung enthält die Beschreibung
der 23 Tapeten der Sammlung. Es sind durchwegs
Prachtstücke allerersten Ranges, und zwar: flämische
Arbeiten des 15. und 16. Jahrhunderts, italienische
Arbeiten des 15. Jahrhunderts, und ein Meisterstück
aus der Epoche Ludwig XIV. Besonderes Interesse
erregen die flämischen Arbeiten des 15. Jahrhunderts.
Es sind sechs kleine Tapeten fast nur in Seide, Sil-
ber und Gold gewebt. Wir sehen da eine glück-
liche Verschmelzung der Renaissance mit den goti-
schen Traditionen. Die dem Bilderkreise des neuen
Testaments entnommenen Kompositionen sind höchst
einfach, und wirken mehr durch die ausserordentliche
Farbenharmonie, die in ihnen herrscht, und worin
sie wirklich an die Schule der Venetianer erinnern.
Beim Betrachten dieser Tapeten, muss man sich
unwillkürlich an die Lehren der Stiltheoretiker er-
innern, dass es wider alle Regeln der Kunst sei,
wenn die Tapisserie Gemälde her-
vorbringen wolle, mit der Ölmalerei
konkurriren wolle. Die Tapisserie
dürfe nur Flächendekorationen er-
zeugen. Hier in diesen Tapeten
aber haben wir wirkliche gewebte
Gemälde vor uns, welche diese
Theorie Lügen strafen. Denn diese
Gemälde können sich den Bildern
der besten Künstler jener Zeit wür-
dig an die Seite stellen. Diese
Tapeten entstammen wahrscheinlich
den Brüsseler Ateliers, denn Arras,
welchem dieselben früher zuge-
schrieben wurden, ist ja seit 1477
kaum mehr in Betracht zu ziehen
(cf. Die Geschichte der Tapisserie
von Dalloz).
Durchaus den Charakter der deut-
schen Kunst des 16. Jahrhunderts
zeigt die wunderbare Tapete, welche
die Geschichte der wunderthätigen
Statue von Notre-Dame de Sablon darstellt und welche
die Inschrift trägt: Egregius Franciscus de Taxis
pie memorie posterum magister hoc fieri fecit 1518.
Wenn auch die Tapete selbst wahrscheinlich in
Brüssel gewebt wurde, so stammen die Kartons doch
sicherlich von einem der deutschen Schule angehörigen
Künstler.
Ganz besonders hervorheben muss ich.bei dieser
Abteilung die beigefügten sieben chromolithographi-
schen Tafeln, die als eine tadellose Wiedergabe der
Originale für Studienzwecke dieselben vollständig
ersetzen.
Durchmesser m 0,062.
107
Inschrift: ESTA OBRA DIO AESTA IGLESA EL
MI MAGEco Ss COds. N DE BARIS ANO 1558.
Ohne die Inschrift würden wir dieses Stück
sicherlich für eine italienische Arbeit erklären, und
offenbar hat sich ähnlich wie in Spanien (cf. Devil-
lier, Recherches sur POrfeverie en Espagne pag. 62
u. a. 0.), auch in Portugal der Renaissancegeschmack
unter der ausschliesslichen Einwirkung italienischer
Künstler entwickelt. Einen eigentümlichen, nicht-
italienischen Charakter trägt nur die auf dem Deckel
angebrachte Christusstatuette. In der Linken trägt
Christus die von einem Kreuze überragte Weltkugel,
die Rechte hält er segnend empor, bekleidet ist er
mit einem langen faltigen Gewände und einem breit-
krämpigen Hute.
Figur 6 (Spitzer, pag. 146
No. 167) zeigt uns eine sehr schöne
italienische-Pax des 16. Jahrhun-
derts. Der Rahmen der inneren
Tafel ist aus vergoldetem Kupfer.
Nur die Basis, der Fries und
Giebel sind mit getriebenen Silber-
platten belegt. Die Inschrift am
Fries ist niellirt. Die innere Platte
ist in Silber getrieben, mit der
Darstellung der Kreuzigung, nach
einer in mehreren Exemplaren be-
kannten Bronzeplaquette von Mo-
derno (cf. Molinier, Les Plaquettes.
Tome I, No. 171 und Bode, Be-
schreibung der Bildwerke der christ-
lichen Epoche No. 741).
Fig. 7 (Spitzer, pag. 151 No. 185) Fig. 8. Kapsel für eine Agnus-Dei-Medaille
zeigt die Kapsel für eine Agnus Aus silber vergoldet und mit transiucidem
. . ' Email geschmückt. Deutsche Arbeit des IG.
Dei-Medaille. Es ist eine deutsche Jahrhunderts
Arbeit des 16. Jahrhunderts in ver-
goldetem Silber, geschmückt mit Email-Translucide.
Die Figuren der Kreuzigungsscene sind in vergol-
detem Silber und heben sich von einem blau email-
lirten Grund ab, während das durchbrochen ge-
arbeitete Laubgewinde ringsherum sich von einem
grün emaillirten Grunde abhebt. Die Rückseite ist
ähnlich mit der Darstellung des mystischen Lammes
in ähnlicher Technik.
Die vierte Abteilung enthält die Beschreibung
der 23 Tapeten der Sammlung. Es sind durchwegs
Prachtstücke allerersten Ranges, und zwar: flämische
Arbeiten des 15. und 16. Jahrhunderts, italienische
Arbeiten des 15. Jahrhunderts, und ein Meisterstück
aus der Epoche Ludwig XIV. Besonderes Interesse
erregen die flämischen Arbeiten des 15. Jahrhunderts.
Es sind sechs kleine Tapeten fast nur in Seide, Sil-
ber und Gold gewebt. Wir sehen da eine glück-
liche Verschmelzung der Renaissance mit den goti-
schen Traditionen. Die dem Bilderkreise des neuen
Testaments entnommenen Kompositionen sind höchst
einfach, und wirken mehr durch die ausserordentliche
Farbenharmonie, die in ihnen herrscht, und worin
sie wirklich an die Schule der Venetianer erinnern.
Beim Betrachten dieser Tapeten, muss man sich
unwillkürlich an die Lehren der Stiltheoretiker er-
innern, dass es wider alle Regeln der Kunst sei,
wenn die Tapisserie Gemälde her-
vorbringen wolle, mit der Ölmalerei
konkurriren wolle. Die Tapisserie
dürfe nur Flächendekorationen er-
zeugen. Hier in diesen Tapeten
aber haben wir wirkliche gewebte
Gemälde vor uns, welche diese
Theorie Lügen strafen. Denn diese
Gemälde können sich den Bildern
der besten Künstler jener Zeit wür-
dig an die Seite stellen. Diese
Tapeten entstammen wahrscheinlich
den Brüsseler Ateliers, denn Arras,
welchem dieselben früher zuge-
schrieben wurden, ist ja seit 1477
kaum mehr in Betracht zu ziehen
(cf. Die Geschichte der Tapisserie
von Dalloz).
Durchaus den Charakter der deut-
schen Kunst des 16. Jahrhunderts
zeigt die wunderbare Tapete, welche
die Geschichte der wunderthätigen
Statue von Notre-Dame de Sablon darstellt und welche
die Inschrift trägt: Egregius Franciscus de Taxis
pie memorie posterum magister hoc fieri fecit 1518.
Wenn auch die Tapete selbst wahrscheinlich in
Brüssel gewebt wurde, so stammen die Kartons doch
sicherlich von einem der deutschen Schule angehörigen
Künstler.
Ganz besonders hervorheben muss ich.bei dieser
Abteilung die beigefügten sieben chromolithographi-
schen Tafeln, die als eine tadellose Wiedergabe der
Originale für Studienzwecke dieselben vollständig
ersetzen.
Durchmesser m 0,062.