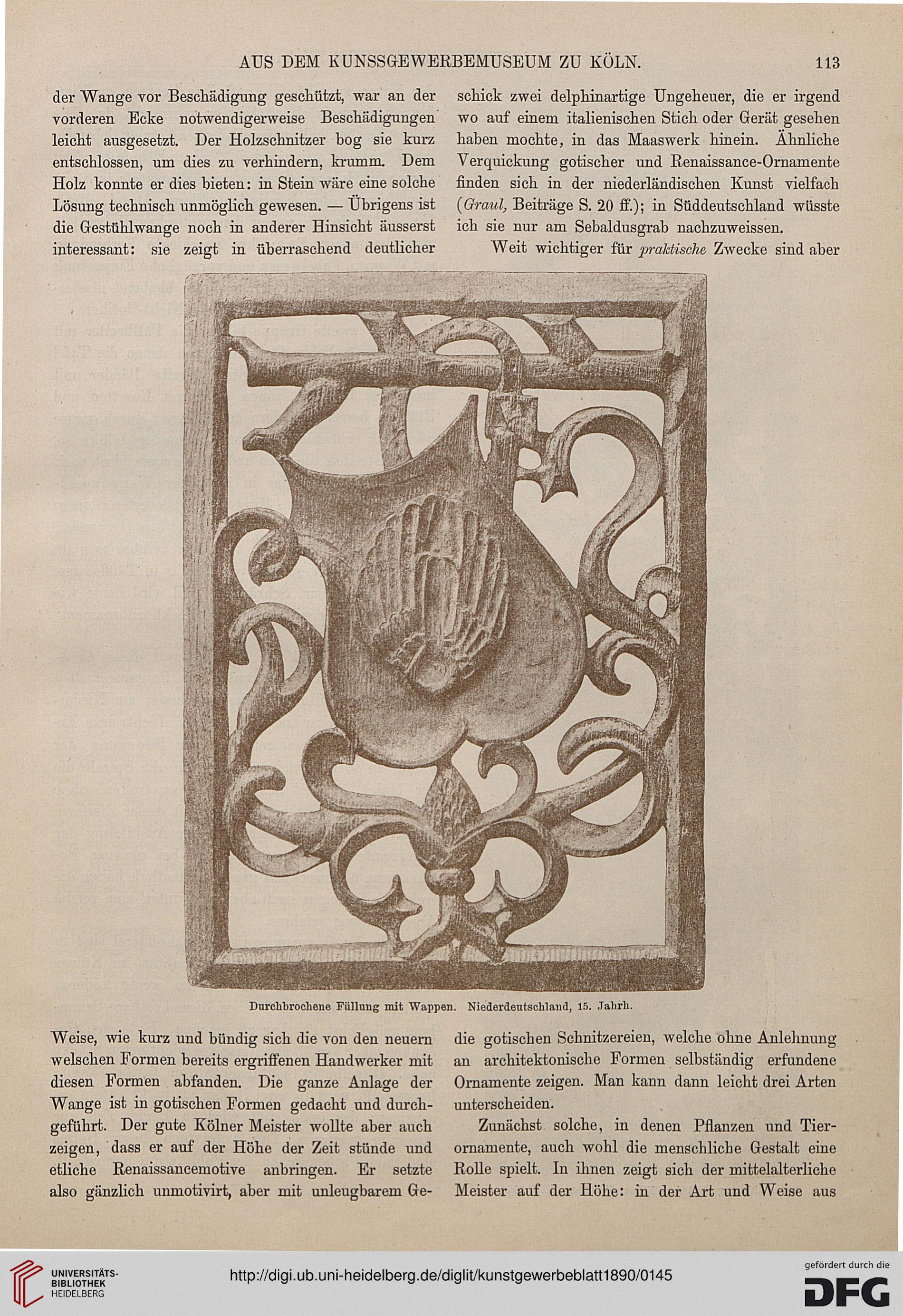AUS DEM KUNSSGEWERBEMUSEUM ZU KÖLN.
113
der Wange vor Beschädigung geschützt, war an der
vorderen Ecke notwendigerweise Beschädigungen
leicht ausgesetzt. Der Holzschnitzer bog sie kurz
entschlossen, um dies zu verhindern, krumm. Dem
Holz konnte er dies bieten: in Stein wäre eine solche
Lösung technisch unmöglich gewesen. — Übrigens ist
die Gestühlwange noch in anderer Hinsicht äusserst
interessant: sie zeigt in überraschend deutlicher
schick zwei delphinartige Ungeheuer, die er irgend
wo auf einem italienischen Stich oder Gerät gesehen
haben mochte, in das Maaswerk hinein. Ähnliche
Verquickung gotischer und Renaissance-Ornamente
finden sich in der niederländischen Kunst vielfach
{Graul, Beiträge S. 20 ff.); in Süddeutschland wüsste
ich sie nur am Sebaldusgrab nachzuweissen.
Weit wichtiger für praktische Zwecke sind aber
Durchbrochene Füllung mit Wappen. Niederdeutschland, 15. Jahrh.
Weise, wie kurz und bündig sich die von den neuern
welschen Formen bereits ergriffenen Handwerker mit
diesen Formen abfanden. Die ganze Anlage der
Wange ist in gotischen Formen gedacht und durch-
geführt. Der gute Kölner Meister wollte aber auch
zeigen, dass er auf der Höhe der Zeit stünde und
etliche Renaissancemotive anbringen. Er setzte
also gänzlich unmotivirt, aber mit unleugbarem Ge-
die gotischen Schnitzereien, welche ohne Anlehnung
an architektonische Formen selbständig erfundene
Ornamente zeigen. Man kann dann leicht drei Arten
unterscheiden.
Zunächst solche, in denen Pflanzen und Tier-
ornamente, auch wohl die menschliche Gestalt eine
Rolle spielt. In ihnen zeigt sich der mittelalterliche
Meister auf der Höhe: in der Art und Weise aus
113
der Wange vor Beschädigung geschützt, war an der
vorderen Ecke notwendigerweise Beschädigungen
leicht ausgesetzt. Der Holzschnitzer bog sie kurz
entschlossen, um dies zu verhindern, krumm. Dem
Holz konnte er dies bieten: in Stein wäre eine solche
Lösung technisch unmöglich gewesen. — Übrigens ist
die Gestühlwange noch in anderer Hinsicht äusserst
interessant: sie zeigt in überraschend deutlicher
schick zwei delphinartige Ungeheuer, die er irgend
wo auf einem italienischen Stich oder Gerät gesehen
haben mochte, in das Maaswerk hinein. Ähnliche
Verquickung gotischer und Renaissance-Ornamente
finden sich in der niederländischen Kunst vielfach
{Graul, Beiträge S. 20 ff.); in Süddeutschland wüsste
ich sie nur am Sebaldusgrab nachzuweissen.
Weit wichtiger für praktische Zwecke sind aber
Durchbrochene Füllung mit Wappen. Niederdeutschland, 15. Jahrh.
Weise, wie kurz und bündig sich die von den neuern
welschen Formen bereits ergriffenen Handwerker mit
diesen Formen abfanden. Die ganze Anlage der
Wange ist in gotischen Formen gedacht und durch-
geführt. Der gute Kölner Meister wollte aber auch
zeigen, dass er auf der Höhe der Zeit stünde und
etliche Renaissancemotive anbringen. Er setzte
also gänzlich unmotivirt, aber mit unleugbarem Ge-
die gotischen Schnitzereien, welche ohne Anlehnung
an architektonische Formen selbständig erfundene
Ornamente zeigen. Man kann dann leicht drei Arten
unterscheiden.
Zunächst solche, in denen Pflanzen und Tier-
ornamente, auch wohl die menschliche Gestalt eine
Rolle spielt. In ihnen zeigt sich der mittelalterliche
Meister auf der Höhe: in der Art und Weise aus