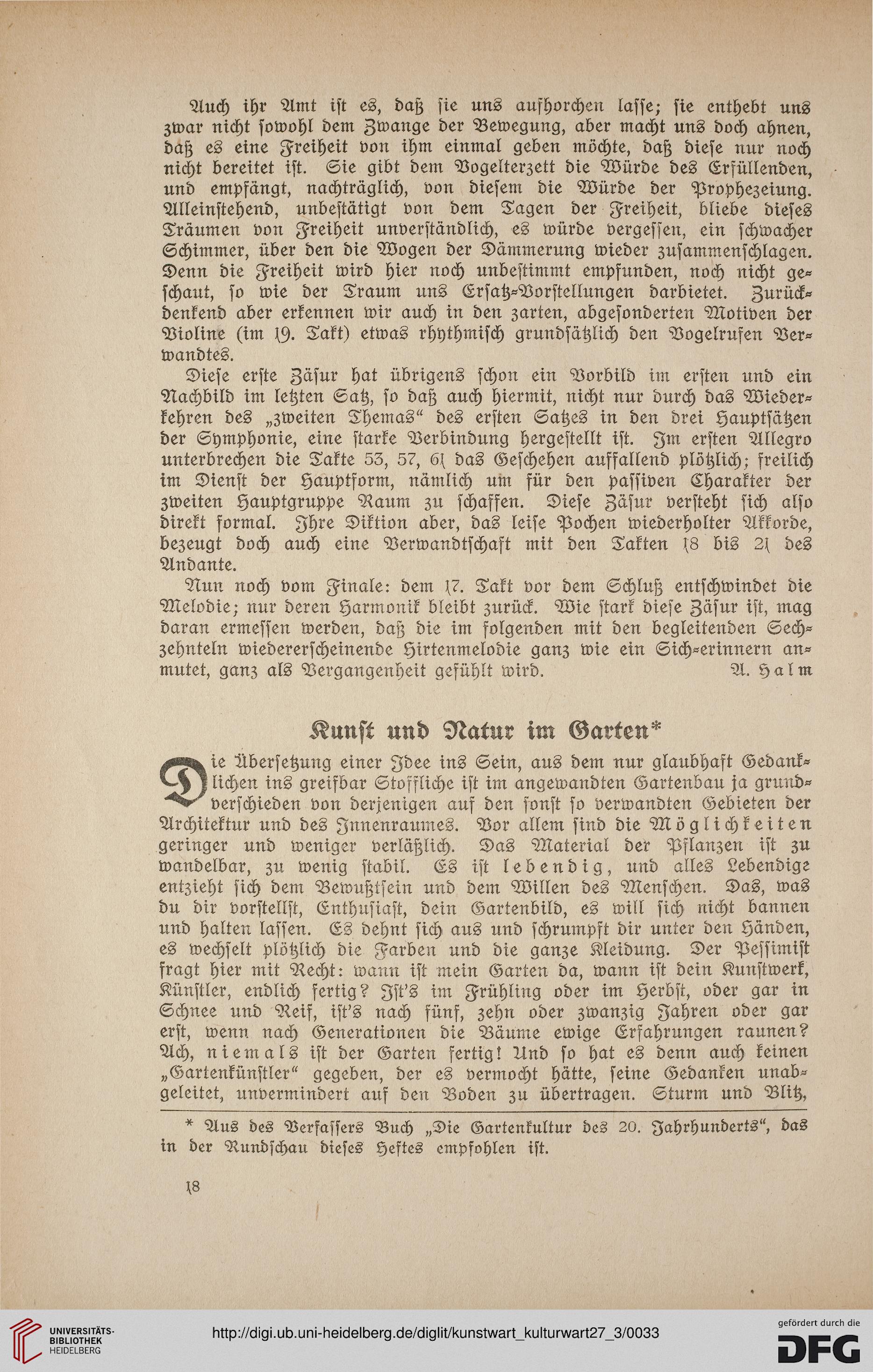Auch ihr AmL ist es, daß sie uns aufhorchen lasse; sie enthebt uns
zwar nicht sowohl dem Zwange der Bewegung, aber macht uns doch ahnen,
daß es eine Freiheit von ihm einmal geben möchte, daß diese nur noch
nicht bereitet ist. Sie gibt dem Vogelterzett die Würde des Erfüllenden,
und empfängt, nachträglich, von diesem die Würde der Prophezeiung.
Alleinstehend, unbestätigt von dem Tagen der Freiheit, bliebe dieses
Träumen von Freiheit unverständlich, es würde vergessen, ein schwacher
Schimmer, über den die Wogen der Dämmerung wieder zusammenschlagen.
Denn die Freiheit wird hier noch unbestimmt empfunden, noch nicht ge-
schaut, so wie der Traum uns (Lrsatz-Vorstellungen darbietet. Zurück-
denkend aber erkennen wir auch in den zarten, abgesonderten Motiven der
Violine (im (9- Takt) etwas rhythmisch grundsätzlich den Vogelrufen Ver-
wandtes.
Diese erste Zäsur hat übrigens schon ein Vorbild im ersten und ein
Nachbild im letzten Satz, so daß auch hiermit, nicht nur durch das Wieder-
kehren des „zweiten Themas" des ersten Satzes in den drei tzauptsätzen
der Symphonie, eine starke Verbindung hergestellt ist. Im ersten Allegro
unterbrechen die Takte 53, 57, das Geschehen auffallend plötzlich; freilich
im Dienst der tzauptforw, nämlich um für den passiven Charakter der
zweiten tzauptgruppe Raum zu schaffen. Diese ZLsur versteht sich also
direkt formal. Ihre Diktion aber, das leise Pochen wiederholter Mkorde,
bezeugt doch auch eine Verwandtschaft mit den Takten (8 bis 2( des
Andante.
Nun noch vom Finale: dem (7. Takt vor dem Schluß entschwindet die
Melodie; nur deren tzarmonik bleibt zurück. Wie stark diese Zäsur ist, mag
daran ermessen werden, daß die im folgenden mit den begleitenden Sech-
zehnteln wiedererscheinende tzirtenmelodie ganz wie ein Sich-erinnern an«
mutet, ganz als Vergangenheit gefühlt wird. A. tzalm
Kunst und Natur im Garten*
^A^ie Äbersetzung einer Idee ins Sein, aus dem nur glaubhaft Gedank«
lichen ins greifbar Stosfliche ist im angewandten Gartenbau ja grund--
verschieden von derjenigen auf den sonst so verwandten Gebieten der
Architektur und des Innenraumes. Vor allem sind die Möglichkeiten
geringer und weniger verläßlich. Das Material der Pflanzen ist zu
wandelbar, zu wenig stabil. Es ist lebendig, und alles Lebendige
entzieht sich dem Bewußtsein und dem Willen des Menschen. Das, was
du dir vorstellst, Enthusiast, dein Gartenbild, es will sich nicht bannen
und halten lassen. Es dehnt sich aus und schrumpft dir unter den tzänden,
es wechselt plötzlich die Farben und die ganze Kleidung. Der Pessimist
fragt hier mit Recht: wann ist mein Garten da, wann ist dein Kunstwerk,
Künstler, endlich fertig? Ist's im Frühling oder im tzerbst, oder gar in
Schnee und Reif, ist's nach fünf, zehn oder zwanzig Iahren oder gar
erst, wenn nach Generationen die Bäume ewige Erfahrungen raunen?
Ach, niemals ist der Garten fertig! Und so hat es denn auch keinen
„Gartenkünstler" gegeben, der es vermocht hätte, seine Gedanken unab-
geleitet, unvermindert auf den Boden zu übertragen. Sturm und Blitz,
* Aus des Verfassers Buch „Die Gartenkultur des 20. Iahrhunderts", das
in der Aundschau dieses tzeftes empfohlen ift.
t8
zwar nicht sowohl dem Zwange der Bewegung, aber macht uns doch ahnen,
daß es eine Freiheit von ihm einmal geben möchte, daß diese nur noch
nicht bereitet ist. Sie gibt dem Vogelterzett die Würde des Erfüllenden,
und empfängt, nachträglich, von diesem die Würde der Prophezeiung.
Alleinstehend, unbestätigt von dem Tagen der Freiheit, bliebe dieses
Träumen von Freiheit unverständlich, es würde vergessen, ein schwacher
Schimmer, über den die Wogen der Dämmerung wieder zusammenschlagen.
Denn die Freiheit wird hier noch unbestimmt empfunden, noch nicht ge-
schaut, so wie der Traum uns (Lrsatz-Vorstellungen darbietet. Zurück-
denkend aber erkennen wir auch in den zarten, abgesonderten Motiven der
Violine (im (9- Takt) etwas rhythmisch grundsätzlich den Vogelrufen Ver-
wandtes.
Diese erste Zäsur hat übrigens schon ein Vorbild im ersten und ein
Nachbild im letzten Satz, so daß auch hiermit, nicht nur durch das Wieder-
kehren des „zweiten Themas" des ersten Satzes in den drei tzauptsätzen
der Symphonie, eine starke Verbindung hergestellt ist. Im ersten Allegro
unterbrechen die Takte 53, 57, das Geschehen auffallend plötzlich; freilich
im Dienst der tzauptforw, nämlich um für den passiven Charakter der
zweiten tzauptgruppe Raum zu schaffen. Diese ZLsur versteht sich also
direkt formal. Ihre Diktion aber, das leise Pochen wiederholter Mkorde,
bezeugt doch auch eine Verwandtschaft mit den Takten (8 bis 2( des
Andante.
Nun noch vom Finale: dem (7. Takt vor dem Schluß entschwindet die
Melodie; nur deren tzarmonik bleibt zurück. Wie stark diese Zäsur ist, mag
daran ermessen werden, daß die im folgenden mit den begleitenden Sech-
zehnteln wiedererscheinende tzirtenmelodie ganz wie ein Sich-erinnern an«
mutet, ganz als Vergangenheit gefühlt wird. A. tzalm
Kunst und Natur im Garten*
^A^ie Äbersetzung einer Idee ins Sein, aus dem nur glaubhaft Gedank«
lichen ins greifbar Stosfliche ist im angewandten Gartenbau ja grund--
verschieden von derjenigen auf den sonst so verwandten Gebieten der
Architektur und des Innenraumes. Vor allem sind die Möglichkeiten
geringer und weniger verläßlich. Das Material der Pflanzen ist zu
wandelbar, zu wenig stabil. Es ist lebendig, und alles Lebendige
entzieht sich dem Bewußtsein und dem Willen des Menschen. Das, was
du dir vorstellst, Enthusiast, dein Gartenbild, es will sich nicht bannen
und halten lassen. Es dehnt sich aus und schrumpft dir unter den tzänden,
es wechselt plötzlich die Farben und die ganze Kleidung. Der Pessimist
fragt hier mit Recht: wann ist mein Garten da, wann ist dein Kunstwerk,
Künstler, endlich fertig? Ist's im Frühling oder im tzerbst, oder gar in
Schnee und Reif, ist's nach fünf, zehn oder zwanzig Iahren oder gar
erst, wenn nach Generationen die Bäume ewige Erfahrungen raunen?
Ach, niemals ist der Garten fertig! Und so hat es denn auch keinen
„Gartenkünstler" gegeben, der es vermocht hätte, seine Gedanken unab-
geleitet, unvermindert auf den Boden zu übertragen. Sturm und Blitz,
* Aus des Verfassers Buch „Die Gartenkultur des 20. Iahrhunderts", das
in der Aundschau dieses tzeftes empfohlen ift.
t8