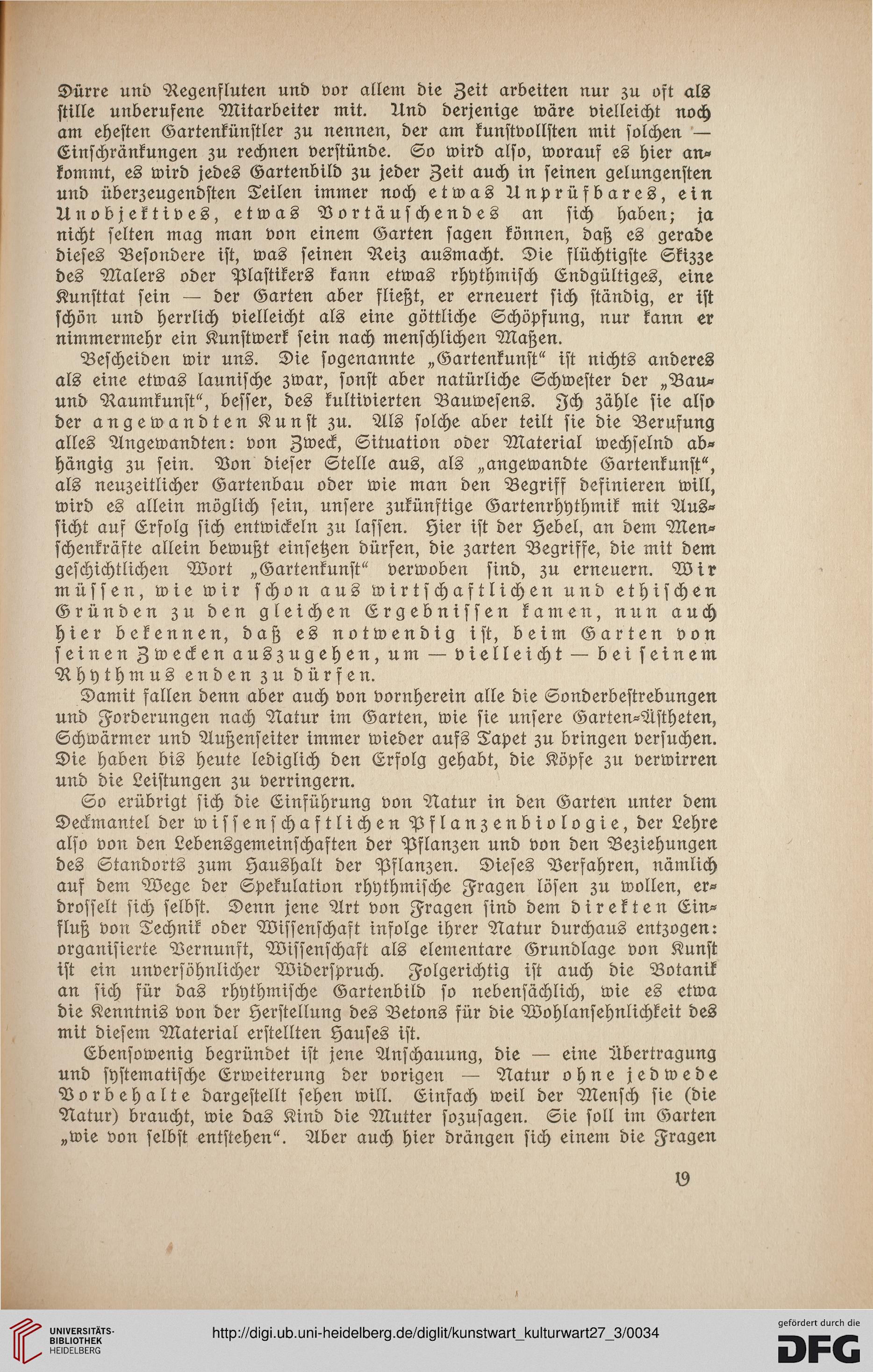Dürre und Regenfluten und vor allem die ZeiL arbeiten nur zu oft als
stille unberufene Mitarbeiter mit. Und derjenige wäre vielleicht noch
am ehesten Gartenkünstler zu nennen, der am kunstvollsten mit solchen —
(Linschränkungen zu rechnen verstünde. So wird also, worauf es hier aw-
kommt, es wird jedes Gartenbild zu jeder Zeit auch in seinen gelungensten
und überzeugendsten Teilen immer noch etwas Unprüfbares, ein
Unobjektives, etwas Vortäuschendes an sich haben; ja
nicht selten mag man von einem Garten sagen können, datz es gerade
dieses Besondere ist, was seinen Reiz ausmacht. Die flüchtigste Skizze
des Malers oder Plastikers kann etwas rhythmisch Endgültiges, eine
Kunsttat sein — der Garten aber flietzt, er erneuert sich ständig, er ist
schön und herrlich vielleicht als eine göttliche Schöpfung, nur kann er
nimmermehr ein Kunstwerk sein nach menschlichen Matzen.
Bescheiden wir uns. Die sogenannte „Gartenkunst" ist nichts anderes
als eine etwas launische zwar, sonst aber natürliche Schwester der „Bau-
und Raumkunst", besser, des kultivierten Bauwesens. Ich zähle sie also
der angewandten Kunst zu. Als solche aber teilt sie die Berufung
alles Angewandten: von Zweck, Situation oder Material wechselnd ab»
hängig zu sein. Von dieser Stelle aus, als „angewandte Gartenkunst",
als neuzeitlicher Gartenbau oder wie man den Begriff definieren will,
wird es allein möglich sein, unsere zukünftige Gartenrhythmik mit Aus«
sicht auf Erfolg sich entwickeln zu lassen. tzier ist der tzebel, an dem Men-
schenkräfte allein bewutzt einsetzen dürfen, die zarten Begriffe, die mit dem
geschichtlichen Wort „Gartenkunst" verwoben sind, zu erneuern. Wir
müssen, wie wir schon aus wirtschaftlichen und ethischen
Gründen zu den gleichen Ergebnissen kamen, nun auch
hier bekennen, datz es notwendig ist, beim Garten von
seinen Iwecken auszugehen, um — vielleicht — bei seinem
Rhythmus enden zu dürfen.
Damit fallen denn aber auch von vornherein alle die Sonderbestrebungen
und Forderungen nach Natur im Garten, wie sie unsere Garten-Astheten,
Schwärmer und Autzenseiter immer wieder aufs Tapet zu bringen versuchen.
Die haben bis heute lediglich den Erfolg gehabt, die Köpfe zu verwirren
und die Leistungen zu verringern.
So erübrigt sich die Einführung von Natur in den Garten unter dem
DeckmanLel der wissenschaftlichen Pflanzenbiologie, der Lehre
also von den Lebensgemeinschaften der Pflanzen und von den Beziehungen
des Standorts zum tzaushalt der Pflanzen. Dieses Verfahren, nämlich
aus dem Wege der Spekulation rhythmische Fragen lösen zu wollen, er--
drosselt sich selbst. Denn jene Art von Fragen sind dem direkten Ein«
flutz von Technik oder Wissenschaft infolge ihrer Natur durchaus entzogen:
organisierte Vernunft, Wissenschaft als elementare Grundlage von Kunst
ist ein unversöhnlicher Widerspruch. Folgerichtig ist auch die Botanik
an sich für das rhythmische Gartenbild so nebensächlich, wie es etwa
die Kenntnis von der tzerstellung des Betons für die Wohlansehnlichkeit des
mit diesem Material erstellten tzauses ist.
Ebensowenig begründet ist jene Anschauung, die — eine Abertragung
und systematische Erweiterung der vorigen — Natur ohne jedwede
Vorbehalte dargestellt sehen will. Einfach weil der Mensch sie (die
Natur) braucht, wie das Kind die Mutter sozusagen. Sie soll im Garten
„wie von selbst entstehen". Aber auch hier drängen sich einem die Fragen
stille unberufene Mitarbeiter mit. Und derjenige wäre vielleicht noch
am ehesten Gartenkünstler zu nennen, der am kunstvollsten mit solchen —
(Linschränkungen zu rechnen verstünde. So wird also, worauf es hier aw-
kommt, es wird jedes Gartenbild zu jeder Zeit auch in seinen gelungensten
und überzeugendsten Teilen immer noch etwas Unprüfbares, ein
Unobjektives, etwas Vortäuschendes an sich haben; ja
nicht selten mag man von einem Garten sagen können, datz es gerade
dieses Besondere ist, was seinen Reiz ausmacht. Die flüchtigste Skizze
des Malers oder Plastikers kann etwas rhythmisch Endgültiges, eine
Kunsttat sein — der Garten aber flietzt, er erneuert sich ständig, er ist
schön und herrlich vielleicht als eine göttliche Schöpfung, nur kann er
nimmermehr ein Kunstwerk sein nach menschlichen Matzen.
Bescheiden wir uns. Die sogenannte „Gartenkunst" ist nichts anderes
als eine etwas launische zwar, sonst aber natürliche Schwester der „Bau-
und Raumkunst", besser, des kultivierten Bauwesens. Ich zähle sie also
der angewandten Kunst zu. Als solche aber teilt sie die Berufung
alles Angewandten: von Zweck, Situation oder Material wechselnd ab»
hängig zu sein. Von dieser Stelle aus, als „angewandte Gartenkunst",
als neuzeitlicher Gartenbau oder wie man den Begriff definieren will,
wird es allein möglich sein, unsere zukünftige Gartenrhythmik mit Aus«
sicht auf Erfolg sich entwickeln zu lassen. tzier ist der tzebel, an dem Men-
schenkräfte allein bewutzt einsetzen dürfen, die zarten Begriffe, die mit dem
geschichtlichen Wort „Gartenkunst" verwoben sind, zu erneuern. Wir
müssen, wie wir schon aus wirtschaftlichen und ethischen
Gründen zu den gleichen Ergebnissen kamen, nun auch
hier bekennen, datz es notwendig ist, beim Garten von
seinen Iwecken auszugehen, um — vielleicht — bei seinem
Rhythmus enden zu dürfen.
Damit fallen denn aber auch von vornherein alle die Sonderbestrebungen
und Forderungen nach Natur im Garten, wie sie unsere Garten-Astheten,
Schwärmer und Autzenseiter immer wieder aufs Tapet zu bringen versuchen.
Die haben bis heute lediglich den Erfolg gehabt, die Köpfe zu verwirren
und die Leistungen zu verringern.
So erübrigt sich die Einführung von Natur in den Garten unter dem
DeckmanLel der wissenschaftlichen Pflanzenbiologie, der Lehre
also von den Lebensgemeinschaften der Pflanzen und von den Beziehungen
des Standorts zum tzaushalt der Pflanzen. Dieses Verfahren, nämlich
aus dem Wege der Spekulation rhythmische Fragen lösen zu wollen, er--
drosselt sich selbst. Denn jene Art von Fragen sind dem direkten Ein«
flutz von Technik oder Wissenschaft infolge ihrer Natur durchaus entzogen:
organisierte Vernunft, Wissenschaft als elementare Grundlage von Kunst
ist ein unversöhnlicher Widerspruch. Folgerichtig ist auch die Botanik
an sich für das rhythmische Gartenbild so nebensächlich, wie es etwa
die Kenntnis von der tzerstellung des Betons für die Wohlansehnlichkeit des
mit diesem Material erstellten tzauses ist.
Ebensowenig begründet ist jene Anschauung, die — eine Abertragung
und systematische Erweiterung der vorigen — Natur ohne jedwede
Vorbehalte dargestellt sehen will. Einfach weil der Mensch sie (die
Natur) braucht, wie das Kind die Mutter sozusagen. Sie soll im Garten
„wie von selbst entstehen". Aber auch hier drängen sich einem die Fragen