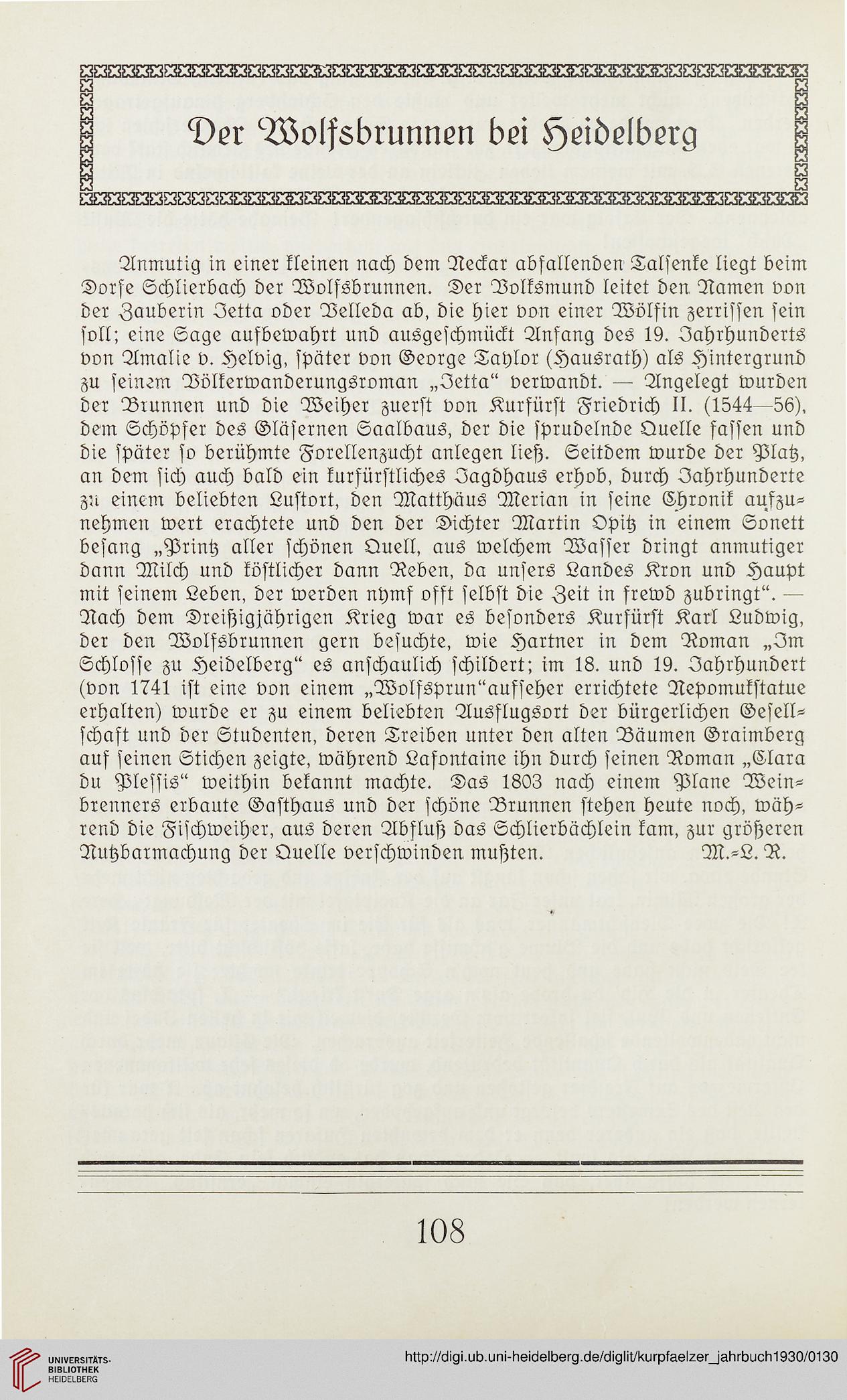Der Wolfsbrunnen bei Heidelberg
Anmutig in einer kleinen nach dem Neckar abfallenden Talsenke liegt beim
Dorfe Schlierbach der Wolfsbrunnen. Der Volksmund leitet den Namen von
der Zauberin Ietta oder Velleda ab, die hier von einer Wölfin zerrissen sein
soll; eine Sage aufbewahrt und ausgeschmückt Anfang des 19. Jahrhunderts
von Amalie v. Helvig, später von George Taylor (Hausrath) als Hintergrund
zu seinem Völkerwanderungsroman „Ietta" verwandt. — Angelegt wurden
der Brunnen und die Weiher zuerst von Kurfürst Friedrich II. (1544—56).
dem Schöpfer des Gläsernen Saalbaus, der die sprudelnde Quelle fassen und
die später so berühmte Forellenzucht anlegen lieh. Seitdem wurde der Platz,
an dem sich auch bald ein kurfürstliches Jagdhaus erhob, durch Jahrhunderte
zu einem beliebten Lustort, den Matthäus Merian in seine Chronik aufzu-
nehmen wert erachtete und den der Dichter Martin Opitz in einem Sonett
besang „Printz aller schönen Quell, aus welchem Wasser dringt anmutiger
dann Milch und köstlicher dann Reben, da unsers Landes Krön und Haupt
mit seinem Leben, der werden nhmf offt selbst die Zeit in frewd zubringt". —
Nach dem Dreißigjährigen Krieg war es besonders Kurfürst Karl Ludwig,
der den Wolfsbrunnen gern besuchte, wie Härtner in dem Roman „Im
Schlosse zu Heidelberg" es anschaulich schildert; im 18. und 19. Jahrhundert
(von 1741 ist eine von einem „Wolfsprun"aufseher errichtete Nepomukstatue
erhalten) wurde er zu einem beliebten Ausflugsort der bürgerlichen Gesell-
schaft und der Studenten, deren Treiben unter den alten Bäumen Graimbera
auf seinen Stichen zeigte, während Lafontaine ihn durch seinen Roman „Clara
du Plessis" weithin bekannt machte. Das 1803 nach einem Plane Wein-
brenners erbaute Gasthaus und der schöne Brunnen stehen heute noch, wäh-
rend die Fischweih-er, aus deren Abfluß das Schlierbächlein kam, zur größeren
Nutzbarmachung der Quelle verschwinden muhten. M.-L. R.
108
Anmutig in einer kleinen nach dem Neckar abfallenden Talsenke liegt beim
Dorfe Schlierbach der Wolfsbrunnen. Der Volksmund leitet den Namen von
der Zauberin Ietta oder Velleda ab, die hier von einer Wölfin zerrissen sein
soll; eine Sage aufbewahrt und ausgeschmückt Anfang des 19. Jahrhunderts
von Amalie v. Helvig, später von George Taylor (Hausrath) als Hintergrund
zu seinem Völkerwanderungsroman „Ietta" verwandt. — Angelegt wurden
der Brunnen und die Weiher zuerst von Kurfürst Friedrich II. (1544—56).
dem Schöpfer des Gläsernen Saalbaus, der die sprudelnde Quelle fassen und
die später so berühmte Forellenzucht anlegen lieh. Seitdem wurde der Platz,
an dem sich auch bald ein kurfürstliches Jagdhaus erhob, durch Jahrhunderte
zu einem beliebten Lustort, den Matthäus Merian in seine Chronik aufzu-
nehmen wert erachtete und den der Dichter Martin Opitz in einem Sonett
besang „Printz aller schönen Quell, aus welchem Wasser dringt anmutiger
dann Milch und köstlicher dann Reben, da unsers Landes Krön und Haupt
mit seinem Leben, der werden nhmf offt selbst die Zeit in frewd zubringt". —
Nach dem Dreißigjährigen Krieg war es besonders Kurfürst Karl Ludwig,
der den Wolfsbrunnen gern besuchte, wie Härtner in dem Roman „Im
Schlosse zu Heidelberg" es anschaulich schildert; im 18. und 19. Jahrhundert
(von 1741 ist eine von einem „Wolfsprun"aufseher errichtete Nepomukstatue
erhalten) wurde er zu einem beliebten Ausflugsort der bürgerlichen Gesell-
schaft und der Studenten, deren Treiben unter den alten Bäumen Graimbera
auf seinen Stichen zeigte, während Lafontaine ihn durch seinen Roman „Clara
du Plessis" weithin bekannt machte. Das 1803 nach einem Plane Wein-
brenners erbaute Gasthaus und der schöne Brunnen stehen heute noch, wäh-
rend die Fischweih-er, aus deren Abfluß das Schlierbächlein kam, zur größeren
Nutzbarmachung der Quelle verschwinden muhten. M.-L. R.
108