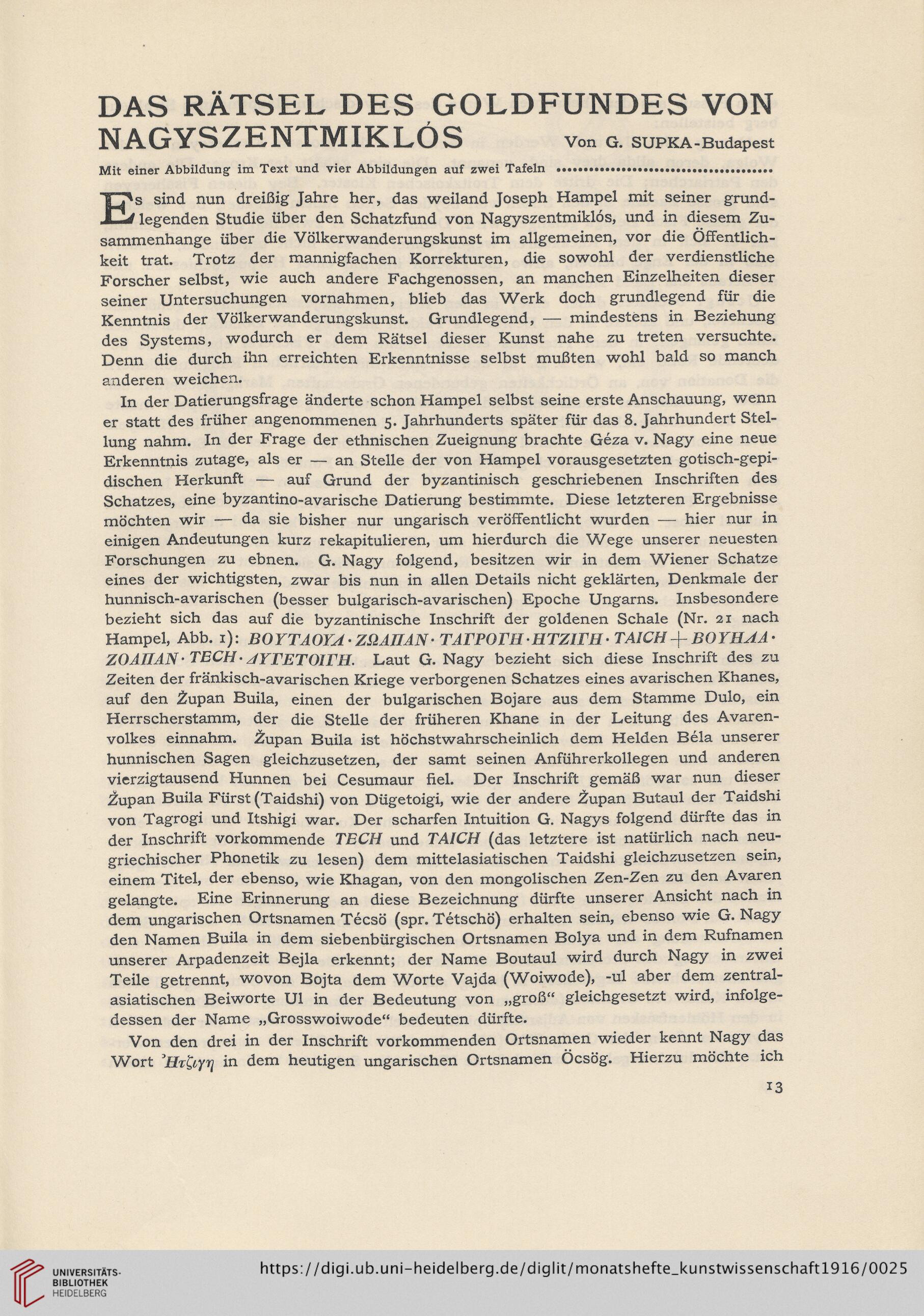DAS RÄTSEL DES GOLDFUNDES VON
NAGYS ZENTMIK LÖS Von G. SUPKA-Budapest
Mit einer Abbildung im Text und vier Abbildungen auf zwei Tafeln
Es sind nun dreißig Jahre her, das weiland Joseph Hampel mit seiner grund-
legenden Studie über den Schatzfund von Nagyszentmiklos, und in diesem Zu-
sammenhänge über die Völkerwanderungskunst im allgemeinen, vor die Öffentlich-
keit trat. Trotz der mannigfachen Korrekturen, die sowohl der verdienstliche
Forscher selbst, wie auch andere Fachgenossen, an manchen Einzelheiten dieser
seiner Untersuchungen vornahmen, blieb das Werk doch grundlegend für die
Kenntnis der Völkerwanderungskunst. Grundlegend, — mindestens in Beziehung
des Systems, wodurch er dem Rätsel dieser Kunst nahe zu treten versuchte.
Denn die durch ihn erreichten Erkenntnisse selbst mußten wohl bald so manch
anderen weichen.
In der Datierungsfrage änderte schon Hampel selbst seine erste Anschauung, wenn
er statt des früher angenommenen 5. Jahrhunderts später für das 8. Jahrhundert Stel-
lung nahm. In der Frage der ethnischen Zueignung brachte Geza v. Nagy eine neue
Erkenntnis zutage, als er — an Stelle der von Hampel vorausgesetzten gotisch-gepi-
dischen Herkunft — auf Grund der byzantinisch geschriebenen Inschriften des
Schatzes, eine byzantino-avarische Datierung bestimmte. Diese letzteren Ergebnisse
möchten wir — da sie bisher nur ungarisch veröffentlicht wurden — hier nur in
einigen Andeutungen kurz rekapitulieren, um hierdurch die Wege unserer neuesten
Forschungen zu ebnen. G. Nagy folgend, besitzen wir in dem Wiener Schatze
eines der wichtigsten, zwar bis nun in allen Details nicht geklärten, Denkmale der
hunnisch-avarischen (besser bulgarisch-avarischen) Epoche Ungarns. Insbesondere
bezieht sich das auf die byzantinische Inschrift der goldenen Schale (Nr. 21 nach
Hampel, Abb. 1): B0YTA0Y4- ΖΩΑΠΑΝ- ΤΑΓΡΟΓΗΗΤΖΙΓΗ- TAICH4 ΒΟΥΗΛΑ-
ΖΟΑΠΑΝ· TECH- ΑΥΓΕΤΟΙΓΗ. Laut G. Nagy bezieht sich diese Inschrift des zu
Zeiten der fränkisch-avarischen Kriege verborgenen Schatzes eines avarischen Khanes,
auf den Zupan Buila, einen der bulgarischen Bojare aus dem Stamme Dulo, ein
Herrscherstamm, der die Stelle der früheren Khane in der Leitung des Avaren-
volkes einnahm. Zupan Buila ist höchstwahrscheinlich dem Helden Bela unserer
hunnischen Sagen gleichzusetzen, der samt seinen Anführerkollegen und anderen
vierzigtausend Hunnen bei Cesumaur fiel. Der Inschrift gemäß war nun dieser
Zupan Buila Fürst (Taidshi) von Dügetoigi, wie der andere Zupan Butaul der Taidshi
von Tagrogi und Itshigi war. Der scharfen Intuition G. Nagys folgend dürfte das in
der Inschrift vorkommende TECH und TAICH (das letztere ist natürlich nach neu-
griechischer Phonetik zu lesen) dem mittelasiatischen Taidshi gleichzusetzen sein,
einem Titel, der ebenso, wie Khagan, von den mongolischen Zen-Zen zu den Avaren
gelangte. Eine Erinnerung an diese Bezeichnung dürfte unserer Ansicht nach in
dem ungarischen Ortsnamen Tecsö (spr. Tetschö) erhalten sein, ebenso wie G. Nagy
den Namen Buila in dem siebenbürgischen Ortsnamen Bolya und in dem Rufnamen
unserer Arpadenzeit Bejla erkennt; der Name Boutaul wird durch Nagy in zwei
Teile getrennt, wovon Bojta dem Worte Vajda (Woiwode), -ul aber dem zentral-
asiatischen Beiworte Ul in der Bedeutung von „groß“ gleichgesetzt wird, infolge-
dessen der Name „Grosswoiwode“ bedeuten dürfte.
Von den drei in der Inschrift vorkommenden Ortsnamen wieder kennt Nagy das
Wort Ίίτζι,γη in dem heutigen ungarischen Ortsnamen Öcsög. Hierzu möchte ich
13
NAGYS ZENTMIK LÖS Von G. SUPKA-Budapest
Mit einer Abbildung im Text und vier Abbildungen auf zwei Tafeln
Es sind nun dreißig Jahre her, das weiland Joseph Hampel mit seiner grund-
legenden Studie über den Schatzfund von Nagyszentmiklos, und in diesem Zu-
sammenhänge über die Völkerwanderungskunst im allgemeinen, vor die Öffentlich-
keit trat. Trotz der mannigfachen Korrekturen, die sowohl der verdienstliche
Forscher selbst, wie auch andere Fachgenossen, an manchen Einzelheiten dieser
seiner Untersuchungen vornahmen, blieb das Werk doch grundlegend für die
Kenntnis der Völkerwanderungskunst. Grundlegend, — mindestens in Beziehung
des Systems, wodurch er dem Rätsel dieser Kunst nahe zu treten versuchte.
Denn die durch ihn erreichten Erkenntnisse selbst mußten wohl bald so manch
anderen weichen.
In der Datierungsfrage änderte schon Hampel selbst seine erste Anschauung, wenn
er statt des früher angenommenen 5. Jahrhunderts später für das 8. Jahrhundert Stel-
lung nahm. In der Frage der ethnischen Zueignung brachte Geza v. Nagy eine neue
Erkenntnis zutage, als er — an Stelle der von Hampel vorausgesetzten gotisch-gepi-
dischen Herkunft — auf Grund der byzantinisch geschriebenen Inschriften des
Schatzes, eine byzantino-avarische Datierung bestimmte. Diese letzteren Ergebnisse
möchten wir — da sie bisher nur ungarisch veröffentlicht wurden — hier nur in
einigen Andeutungen kurz rekapitulieren, um hierdurch die Wege unserer neuesten
Forschungen zu ebnen. G. Nagy folgend, besitzen wir in dem Wiener Schatze
eines der wichtigsten, zwar bis nun in allen Details nicht geklärten, Denkmale der
hunnisch-avarischen (besser bulgarisch-avarischen) Epoche Ungarns. Insbesondere
bezieht sich das auf die byzantinische Inschrift der goldenen Schale (Nr. 21 nach
Hampel, Abb. 1): B0YTA0Y4- ΖΩΑΠΑΝ- ΤΑΓΡΟΓΗΗΤΖΙΓΗ- TAICH4 ΒΟΥΗΛΑ-
ΖΟΑΠΑΝ· TECH- ΑΥΓΕΤΟΙΓΗ. Laut G. Nagy bezieht sich diese Inschrift des zu
Zeiten der fränkisch-avarischen Kriege verborgenen Schatzes eines avarischen Khanes,
auf den Zupan Buila, einen der bulgarischen Bojare aus dem Stamme Dulo, ein
Herrscherstamm, der die Stelle der früheren Khane in der Leitung des Avaren-
volkes einnahm. Zupan Buila ist höchstwahrscheinlich dem Helden Bela unserer
hunnischen Sagen gleichzusetzen, der samt seinen Anführerkollegen und anderen
vierzigtausend Hunnen bei Cesumaur fiel. Der Inschrift gemäß war nun dieser
Zupan Buila Fürst (Taidshi) von Dügetoigi, wie der andere Zupan Butaul der Taidshi
von Tagrogi und Itshigi war. Der scharfen Intuition G. Nagys folgend dürfte das in
der Inschrift vorkommende TECH und TAICH (das letztere ist natürlich nach neu-
griechischer Phonetik zu lesen) dem mittelasiatischen Taidshi gleichzusetzen sein,
einem Titel, der ebenso, wie Khagan, von den mongolischen Zen-Zen zu den Avaren
gelangte. Eine Erinnerung an diese Bezeichnung dürfte unserer Ansicht nach in
dem ungarischen Ortsnamen Tecsö (spr. Tetschö) erhalten sein, ebenso wie G. Nagy
den Namen Buila in dem siebenbürgischen Ortsnamen Bolya und in dem Rufnamen
unserer Arpadenzeit Bejla erkennt; der Name Boutaul wird durch Nagy in zwei
Teile getrennt, wovon Bojta dem Worte Vajda (Woiwode), -ul aber dem zentral-
asiatischen Beiworte Ul in der Bedeutung von „groß“ gleichgesetzt wird, infolge-
dessen der Name „Grosswoiwode“ bedeuten dürfte.
Von den drei in der Inschrift vorkommenden Ortsnamen wieder kennt Nagy das
Wort Ίίτζι,γη in dem heutigen ungarischen Ortsnamen Öcsög. Hierzu möchte ich
13