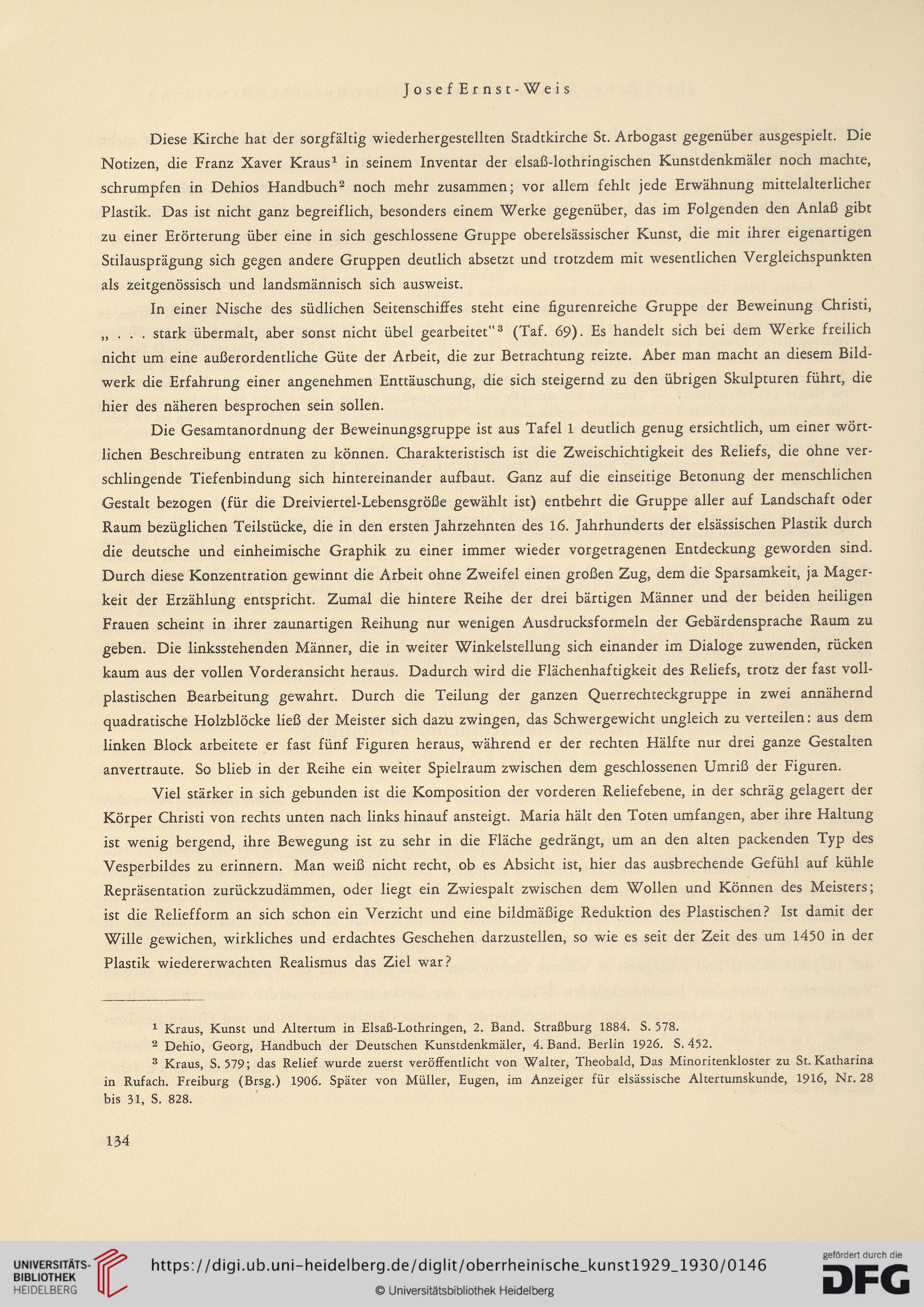JosefErnst-Weis
Diese Kirche hat der sorgfältig wiederhergestellten Stadtkirche St. Arbogast gegenüber ausgespielt. Die
Notizen, die Franz Xaver Kraus1 in seinem Inventar der elsaß-lothringischen Kunstdenkmäler noch machte,
schrumpfen in Dehios Handbuch2 noch mehr zusammen; vor allem fehlt jede Erwähnung mittelalterlicher
Plastik. Das ist nicht ganz begreiflich, besonders einem Werke gegenüber, das im Folgenden den Anlaß gibt
zu einer Erörterung über eine in sich geschlossene Gruppe oberelsässischer Kunst, die mit ihrer eigenartigen
Stilausprägung sich gegen andere Gruppen deutlich absetzt und trotzdem mit wesentlichen Vergleichspunkten
als zeitgenössisch und landsmännisch sich ausweist.
In einer Nische des südlichen Seitenschiffes steht eine figurenreiche Gruppe der Beweinung Christi,
„ . . . stark übermalt, aber sonst nicht übel gearbeitet"3 (Taf. 69). Es handelt sich bei dem Werke freilich
nicht um eine außerordentliche Güte der Arbeit, die zur Betrachtung reizte. Aber man macht an diesem Bild-
werk die Erfahrung einer angenehmen Enttäuschung, die sich steigernd zu den übrigen Skulpturen führt, die
hier des näheren besprochen sein sollen.
Die Gesamtanordnung der Beweinungsgruppe ist aus Tafel 1 deutlich genug ersichtlich, um einer wört-
lichen Beschreibung entraten zu können. Charakteristisch ist die Zweischichtigkeit des Reliefs, die ohne ver-
schlingende Tiefenbindung sich hintereinander aufbaut. Ganz auf die einseitige Betonung der menschlichen
Gestalt bezogen (für die Dreiviertel-Lebensgröße gewählt ist) entbehrt die Gruppe aller auf Landschaft oder
Raum bezüglichen Teilstücke, die in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts der elsässischen Plastik durch
die deutsche und einheimische Graphik zu einer immer wieder vorgetragenen Entdeckung geworden sind.
Durch diese Konzentration gewinnt die Arbeit ohne Zweifel einen großen Zug, dem die Sparsamkeit, ja Mager-
keit der Erzählung entspricht. Zumal die hintere Reihe der drei bärtigen Männer und der beiden heiligen
Frauen scheint in ihrer zaunartigen Reihung nur wenigen Ausdrucksformeln der Gebärdensprache Raum zu
geben. Die linksstehenden Männer, die in weiter Winkelstellung sich einander im Dialoge zuwenden, rücken
kaum aus der vollen Vorderansicht heraus. Dadurch wird die Flächenhaftigkeit des Reliefs, trotz der fast voll-
plastischen Bearbeitung gewahrt. Durch die Teilung der ganzen Querrechteckgruppe in zwei annähernd
quadratische Holzblöcke ließ der Meister sich dazu zwingen, das Schwergewicht ungleich zu verteilen: aus dem
linken Block arbeitete er fast fünf Figuren heraus, während er der rechten Hälfte nur drei ganze Gestalten
anvertraute. So blieb in der Reihe ein weiter Spielraum zwischen dem geschlossenen Umriß der Figuren.
Viel stärker in sich gebunden ist die Komposition der vorderen Reliefebene, in der schräg gelagert der
Körper Christi von rechts unten nach links hinauf ansteigt. Maria hält den Toten umfangen, aber ihre Haltung
ist wenig bergend, ihre Bewegung ist zu sehr in die Fläche gedrängt, um an den alten packenden Typ des
Vesperbildes zu erinnern. Man weiß nicht recht, ob es Absicht ist, hier das ausbrechende Gefühl auf kühle
Repräsentation zurückzudämmen, oder liegt ein Zwiespalt zwischen dem Wollen und Können des Meisters;
ist die Reliefform an sich schon ein Verzicht und eine bildmäßige Reduktion des Plastischen? Ist damit der
Wille gewichen, wirkliches und erdachtes Geschehen darzustellen, so wie es seit der Zeit des um 1450 in der
Plastik wiedererwachten Realismus das Ziel war?
1 Kraus, Kunst und Altertum in Elsaß-Lothringen, 2. Band. Straßburg 1884. S. 578.
2 Dehio, Georg, Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler, 4. Band. Berlin 1926. S. 452.
3 Kraus, S. 579; das Relief wurde zuerst veröffentlicht von Walter, Theobald, Das Minoritenkloster zu St. Katharina
in Rufach. Freiburg (Brsg.) 1906. Später von Müller, Eugen, im Anzeiger für elsässische Altertumskunde, 1916, Nr. 28
bis 31, S. 828.
134
Diese Kirche hat der sorgfältig wiederhergestellten Stadtkirche St. Arbogast gegenüber ausgespielt. Die
Notizen, die Franz Xaver Kraus1 in seinem Inventar der elsaß-lothringischen Kunstdenkmäler noch machte,
schrumpfen in Dehios Handbuch2 noch mehr zusammen; vor allem fehlt jede Erwähnung mittelalterlicher
Plastik. Das ist nicht ganz begreiflich, besonders einem Werke gegenüber, das im Folgenden den Anlaß gibt
zu einer Erörterung über eine in sich geschlossene Gruppe oberelsässischer Kunst, die mit ihrer eigenartigen
Stilausprägung sich gegen andere Gruppen deutlich absetzt und trotzdem mit wesentlichen Vergleichspunkten
als zeitgenössisch und landsmännisch sich ausweist.
In einer Nische des südlichen Seitenschiffes steht eine figurenreiche Gruppe der Beweinung Christi,
„ . . . stark übermalt, aber sonst nicht übel gearbeitet"3 (Taf. 69). Es handelt sich bei dem Werke freilich
nicht um eine außerordentliche Güte der Arbeit, die zur Betrachtung reizte. Aber man macht an diesem Bild-
werk die Erfahrung einer angenehmen Enttäuschung, die sich steigernd zu den übrigen Skulpturen führt, die
hier des näheren besprochen sein sollen.
Die Gesamtanordnung der Beweinungsgruppe ist aus Tafel 1 deutlich genug ersichtlich, um einer wört-
lichen Beschreibung entraten zu können. Charakteristisch ist die Zweischichtigkeit des Reliefs, die ohne ver-
schlingende Tiefenbindung sich hintereinander aufbaut. Ganz auf die einseitige Betonung der menschlichen
Gestalt bezogen (für die Dreiviertel-Lebensgröße gewählt ist) entbehrt die Gruppe aller auf Landschaft oder
Raum bezüglichen Teilstücke, die in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts der elsässischen Plastik durch
die deutsche und einheimische Graphik zu einer immer wieder vorgetragenen Entdeckung geworden sind.
Durch diese Konzentration gewinnt die Arbeit ohne Zweifel einen großen Zug, dem die Sparsamkeit, ja Mager-
keit der Erzählung entspricht. Zumal die hintere Reihe der drei bärtigen Männer und der beiden heiligen
Frauen scheint in ihrer zaunartigen Reihung nur wenigen Ausdrucksformeln der Gebärdensprache Raum zu
geben. Die linksstehenden Männer, die in weiter Winkelstellung sich einander im Dialoge zuwenden, rücken
kaum aus der vollen Vorderansicht heraus. Dadurch wird die Flächenhaftigkeit des Reliefs, trotz der fast voll-
plastischen Bearbeitung gewahrt. Durch die Teilung der ganzen Querrechteckgruppe in zwei annähernd
quadratische Holzblöcke ließ der Meister sich dazu zwingen, das Schwergewicht ungleich zu verteilen: aus dem
linken Block arbeitete er fast fünf Figuren heraus, während er der rechten Hälfte nur drei ganze Gestalten
anvertraute. So blieb in der Reihe ein weiter Spielraum zwischen dem geschlossenen Umriß der Figuren.
Viel stärker in sich gebunden ist die Komposition der vorderen Reliefebene, in der schräg gelagert der
Körper Christi von rechts unten nach links hinauf ansteigt. Maria hält den Toten umfangen, aber ihre Haltung
ist wenig bergend, ihre Bewegung ist zu sehr in die Fläche gedrängt, um an den alten packenden Typ des
Vesperbildes zu erinnern. Man weiß nicht recht, ob es Absicht ist, hier das ausbrechende Gefühl auf kühle
Repräsentation zurückzudämmen, oder liegt ein Zwiespalt zwischen dem Wollen und Können des Meisters;
ist die Reliefform an sich schon ein Verzicht und eine bildmäßige Reduktion des Plastischen? Ist damit der
Wille gewichen, wirkliches und erdachtes Geschehen darzustellen, so wie es seit der Zeit des um 1450 in der
Plastik wiedererwachten Realismus das Ziel war?
1 Kraus, Kunst und Altertum in Elsaß-Lothringen, 2. Band. Straßburg 1884. S. 578.
2 Dehio, Georg, Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler, 4. Band. Berlin 1926. S. 452.
3 Kraus, S. 579; das Relief wurde zuerst veröffentlicht von Walter, Theobald, Das Minoritenkloster zu St. Katharina
in Rufach. Freiburg (Brsg.) 1906. Später von Müller, Eugen, im Anzeiger für elsässische Altertumskunde, 1916, Nr. 28
bis 31, S. 828.
134