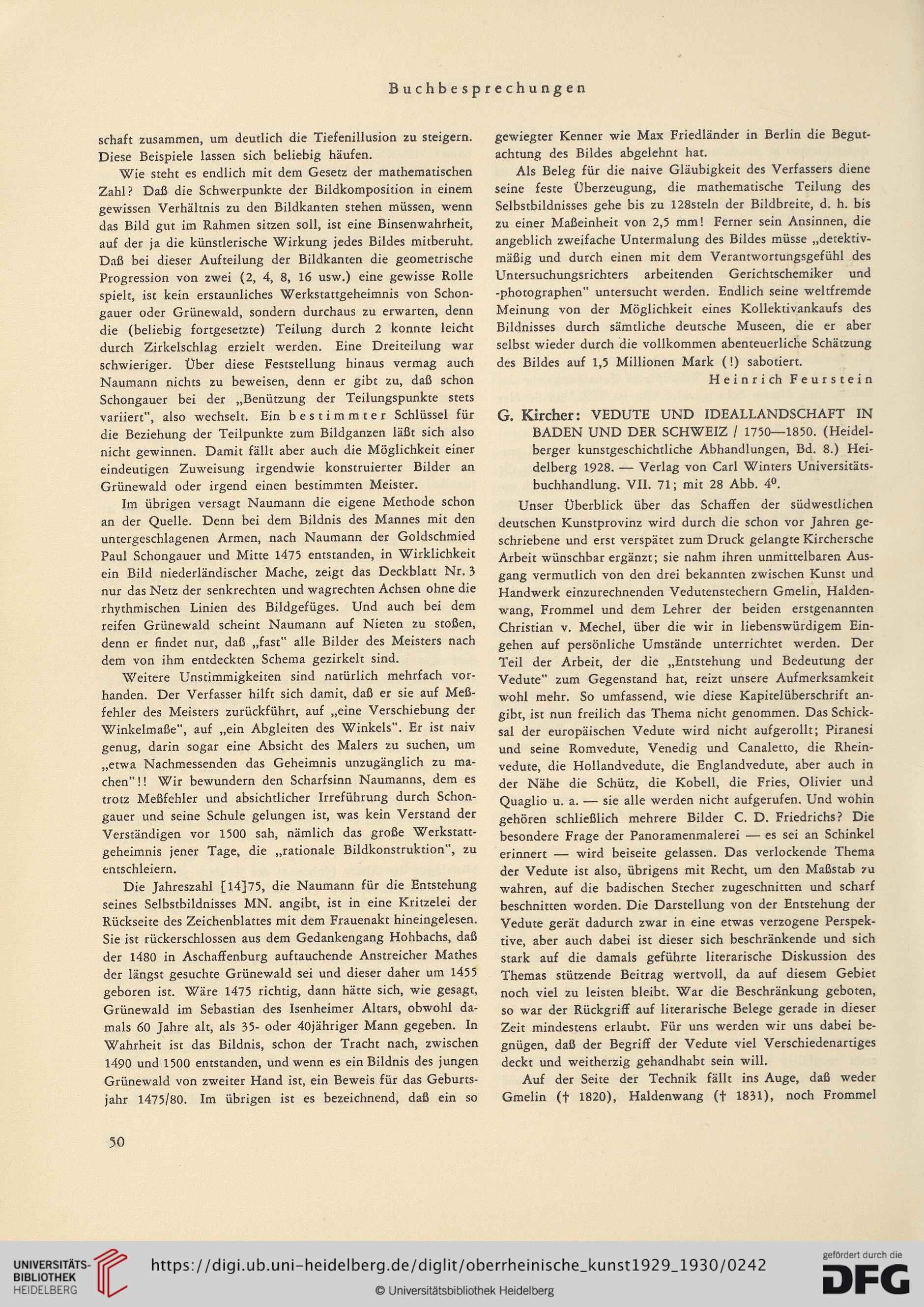Buchbesprechungen
schäft zusammen, um deutlich die Tiefenillusion zu steigern.
Diese Beispiele lassen sich beliebig häufen.
Wie steht es endlich mit dem Gesetz der mathematischen
Zahl? Daß die Schwerpunkte der Bildkomposition in einem
gewissen Verhältnis zu den Bildkanten stehen müssen, wenn
das Bild gut im Rahmen sitzen soll, ist eine Binsenwahrheit,
auf der ja die künstlerische Wirkung jedes Bildes mitberuht.
Daß bei dieser Aufteilung der Bildkanten die geometrische
Progression von zwei (2, 4, 8, 16 usw.) eine gewisse Rolle
spielt, ist kein erstaunliches Werkstattgeheimnis von Schon-
gauer oder Grünewald, sondern durchaus zu erwarten, denn
die (beliebig fortgesetzte) Teilung durch 2 konnte leicht
durch Zirkelschlag erzielt werden. Eine Dreiteilung war
schwieriger. Über diese Feststellung hinaus vermag auch
Naumann nichts zu beweisen, denn er gibt zu, daß schon
Schongauer bei der „Benützung der Teilungspunkte stets
variiert", also wechselt. Ein bestimmter Schlüssel für
die Beziehung der Teilpunkte zum Bildganzen läßt sich also
nicht gewinnen. Damit fällt aber auch die Möglichkeit einer
eindeutigen Zuweisung irgendwie konstruierter Bilder an
Grünewald oder irgend einen bestimmten Meister.
Im übrigen versagt Naumann die eigene Methode schon
an der Quelle. Denn bei dem Bildnis des Mannes mit den
untergeschlagenen Armen, nach Naumann der Goldschmied
Paul Schongauer und Mitte 1475 entstanden, in Wirklichkeit
ein Bild niederländischer Mache, zeigt das Deckblatt Nr. 3
nur das Netz der senkrechten und wagrechten Achsen ohne die
rhythmischen Linien des Bildgefüges. Und auch bei dem
reifen Grünewald scheint Naumann auf Nieten zu stoßen,
denn er findet nur, daß „fast" alle Bilder des Meisters nach
dem von ihm entdeckten Schema gezirkelt sind.
Weitere Unstimmigkeiten sind natürlich mehrfach vor-
handen. Der Verfasser hilft sich damit, daß er sie auf Meß-
fehler des Meisters zurückführt, auf „eine Verschiebung der
Winkelmaße", auf „ein Abgleiten des Winkels". Er ist naiv
genug, darin sogar eine Absicht des Malers zu suchen, um
„etwa Nachmessenden das Geheimnis unzugänglich zu ma-
chen" !! Wir bewundern den Scharfsinn Naumanns, dem es
trotz Meßfehler und absichtlicher Irreführung durch Schon-
gauer und seine Schule gelungen ist, was kein Verstand der
Verständigen vor 1500 sah, nämlich das große Werkstatt-
geheimnis jener Tage, die „rationale Bildkonstruktion", zu
entschleiern.
Die Jahreszahl [14]75, die Naumann für die Entstehung
seines Selbstbildnisses MN. angibt, ist in eine Kritzelei der
Rückseite des Zeichenblattes mit dem Frauenakt hineingelesen.
Sie ist rückerschlossen aus dem Gedankengang Hohbachs, daß
der 1480 in Aschaffenburg auftauchende Anstreicher Mathes
der längst gesuchte Grünewald sei und dieser daher um 1455
geboren ist. Wäre 1475 richtig, dann hätte sich, wie gesagt,
Grünewald im Sebastian des Isenheimer Altars, obwohl da-
mals 60 Jahre alt, als 35- oder 40jähriger Mann gegeben. In
Wahrheit ist das Bildnis, schon der Tracht nach, zwischen
1490 und 1500 entstanden, und wenn es ein Bildnis des jungen
Grünewald von zweiter Hand ist, ein Beweis für das Geburts-
jahr 1475/80. Im übrigen ist es bezeichnend, daß ein so
gewiegter Kenner wie Max Friedländer in Berlin die Begut-
achtung des Bildes abgelehnt hat.
Als Beleg für die naive Gläubigkeit des Verfassers diene
seine feste Überzeugung, die mathematische Teilung des
Selbstbildnisses gehe bis zu 128steln der Bildbreite, d. h. bis
zu einer Maßeinheit von 2,5 mm! Ferner sein Ansinnen, die
angeblich zweifache Untermalung des Bildes müsse „detektiv-
mäßig und durch einen mit dem Verantwortungsgefühl des
Untersuchungsrichters arbeitenden Gerichtschemiker und
-photographen" untersucht werden. Endlich seine weltfremde
Meinung von der Möglichkeit eines Kollektivankaufs des
Bildnisses durch sämtliche deutsche Museen, die er aber
selbst wieder durch die vollkommen abenteuerliche Schätzung
des Bildes auf 1,5 Millionen Mark (!) sabotiert.
Heinrich Feurstein
G. Kircher: VEDUTE UND IDEALLANDSCHAFT IN
BADEN UND DER SCHWEIZ / 1750—1850. (Heidel-
berger kunstgeschichtliche Abhandlungen, Bd. 8.) Hei-
delberg 1928. — Verlag von Carl Winters Universitäts-
buchhandlung. VII. 71; mit 28 Abb. 4°.
Unser Überblick über das Schaffen der südwestlichen
deutschen Kunstprovinz wird durch die schon vor Jahren ge-
schriebene und erst verspätet zum Druck gelangte Kirchersche
Arbeit wünschbar ergänzt; sie nahm ihren unmittelbaren Aus-
gang vermutlich von den drei bekannten zwischen Kunst und
Handwerk einzurechnenden Vedutenstechern Gmelin, Halden-
wang, Frommei und dem Lehrer der beiden erstgenannten
Christian v. Mechel, über die wir in liebenswürdigem Ein-
gehen auf persönliche Umstände unterrichtet werden. Der
Teil der Arbeit, der die „Entstehung und Bedeutung der
Vedute" zum Gegenstand hat, reizt unsere Aufmerksamkeit
wohl mehr. So umfassend, wie diese Kapitelüberschrift an-
gibt, ist nun freilich das Thema nicht genommen. Das Schick-
sal der europäischen Vedute wird nicht aufgerollt; Piranesi
und seine Romvedute, Venedig und Canaletto, die Rhein-
vedute, die Hollandvedute, die Englandvedute, aber auch in
der Nähe die Schütz, die Kobell, die Fries, Olivier und
Quaglio u. a. — sie alle werden nicht aufgerufen. Und wohin
gehören schließlich mehrere Bilder C. D. Friedrichs? Die
besondere Frage der Panoramenmalerei — es sei an Schinkel
erinnert — wird beiseite gelassen. Das verlockende Thema
der Vedute ist also, übrigens mit Recht, um den Maßstab zu
wahren, auf die badischen Stecher zugeschnitten und scharf
beschnitten worden. Die Darstellung von der Entstehung der
Vedute gerät dadurch zwar in eine etwas verzogene Perspek-
tive, aber auch dabei ist dieser sich beschränkende und sich
stark auf die damals geführte literarische Diskussion des
Themas stützende Beitrag wertvoll, da auf diesem Gebiet
noch viel zu leisten bleibt. War die Beschränkung geboten,
so war der Rückgriff auf literarische Belege gerade in dieser
Zeit mindestens erlaubt. Für uns werden wir uns dabei be-
gnügen, daß der Begriff der Vedute viel Verschiedenartiges
deckt und weitherzig gehandhabt sein will.
Auf der Seite der Technik fällt ins Auge, daß weder
Gmelin (f 1820), Haldenwang (t 1831), noch Frommei
50
schäft zusammen, um deutlich die Tiefenillusion zu steigern.
Diese Beispiele lassen sich beliebig häufen.
Wie steht es endlich mit dem Gesetz der mathematischen
Zahl? Daß die Schwerpunkte der Bildkomposition in einem
gewissen Verhältnis zu den Bildkanten stehen müssen, wenn
das Bild gut im Rahmen sitzen soll, ist eine Binsenwahrheit,
auf der ja die künstlerische Wirkung jedes Bildes mitberuht.
Daß bei dieser Aufteilung der Bildkanten die geometrische
Progression von zwei (2, 4, 8, 16 usw.) eine gewisse Rolle
spielt, ist kein erstaunliches Werkstattgeheimnis von Schon-
gauer oder Grünewald, sondern durchaus zu erwarten, denn
die (beliebig fortgesetzte) Teilung durch 2 konnte leicht
durch Zirkelschlag erzielt werden. Eine Dreiteilung war
schwieriger. Über diese Feststellung hinaus vermag auch
Naumann nichts zu beweisen, denn er gibt zu, daß schon
Schongauer bei der „Benützung der Teilungspunkte stets
variiert", also wechselt. Ein bestimmter Schlüssel für
die Beziehung der Teilpunkte zum Bildganzen läßt sich also
nicht gewinnen. Damit fällt aber auch die Möglichkeit einer
eindeutigen Zuweisung irgendwie konstruierter Bilder an
Grünewald oder irgend einen bestimmten Meister.
Im übrigen versagt Naumann die eigene Methode schon
an der Quelle. Denn bei dem Bildnis des Mannes mit den
untergeschlagenen Armen, nach Naumann der Goldschmied
Paul Schongauer und Mitte 1475 entstanden, in Wirklichkeit
ein Bild niederländischer Mache, zeigt das Deckblatt Nr. 3
nur das Netz der senkrechten und wagrechten Achsen ohne die
rhythmischen Linien des Bildgefüges. Und auch bei dem
reifen Grünewald scheint Naumann auf Nieten zu stoßen,
denn er findet nur, daß „fast" alle Bilder des Meisters nach
dem von ihm entdeckten Schema gezirkelt sind.
Weitere Unstimmigkeiten sind natürlich mehrfach vor-
handen. Der Verfasser hilft sich damit, daß er sie auf Meß-
fehler des Meisters zurückführt, auf „eine Verschiebung der
Winkelmaße", auf „ein Abgleiten des Winkels". Er ist naiv
genug, darin sogar eine Absicht des Malers zu suchen, um
„etwa Nachmessenden das Geheimnis unzugänglich zu ma-
chen" !! Wir bewundern den Scharfsinn Naumanns, dem es
trotz Meßfehler und absichtlicher Irreführung durch Schon-
gauer und seine Schule gelungen ist, was kein Verstand der
Verständigen vor 1500 sah, nämlich das große Werkstatt-
geheimnis jener Tage, die „rationale Bildkonstruktion", zu
entschleiern.
Die Jahreszahl [14]75, die Naumann für die Entstehung
seines Selbstbildnisses MN. angibt, ist in eine Kritzelei der
Rückseite des Zeichenblattes mit dem Frauenakt hineingelesen.
Sie ist rückerschlossen aus dem Gedankengang Hohbachs, daß
der 1480 in Aschaffenburg auftauchende Anstreicher Mathes
der längst gesuchte Grünewald sei und dieser daher um 1455
geboren ist. Wäre 1475 richtig, dann hätte sich, wie gesagt,
Grünewald im Sebastian des Isenheimer Altars, obwohl da-
mals 60 Jahre alt, als 35- oder 40jähriger Mann gegeben. In
Wahrheit ist das Bildnis, schon der Tracht nach, zwischen
1490 und 1500 entstanden, und wenn es ein Bildnis des jungen
Grünewald von zweiter Hand ist, ein Beweis für das Geburts-
jahr 1475/80. Im übrigen ist es bezeichnend, daß ein so
gewiegter Kenner wie Max Friedländer in Berlin die Begut-
achtung des Bildes abgelehnt hat.
Als Beleg für die naive Gläubigkeit des Verfassers diene
seine feste Überzeugung, die mathematische Teilung des
Selbstbildnisses gehe bis zu 128steln der Bildbreite, d. h. bis
zu einer Maßeinheit von 2,5 mm! Ferner sein Ansinnen, die
angeblich zweifache Untermalung des Bildes müsse „detektiv-
mäßig und durch einen mit dem Verantwortungsgefühl des
Untersuchungsrichters arbeitenden Gerichtschemiker und
-photographen" untersucht werden. Endlich seine weltfremde
Meinung von der Möglichkeit eines Kollektivankaufs des
Bildnisses durch sämtliche deutsche Museen, die er aber
selbst wieder durch die vollkommen abenteuerliche Schätzung
des Bildes auf 1,5 Millionen Mark (!) sabotiert.
Heinrich Feurstein
G. Kircher: VEDUTE UND IDEALLANDSCHAFT IN
BADEN UND DER SCHWEIZ / 1750—1850. (Heidel-
berger kunstgeschichtliche Abhandlungen, Bd. 8.) Hei-
delberg 1928. — Verlag von Carl Winters Universitäts-
buchhandlung. VII. 71; mit 28 Abb. 4°.
Unser Überblick über das Schaffen der südwestlichen
deutschen Kunstprovinz wird durch die schon vor Jahren ge-
schriebene und erst verspätet zum Druck gelangte Kirchersche
Arbeit wünschbar ergänzt; sie nahm ihren unmittelbaren Aus-
gang vermutlich von den drei bekannten zwischen Kunst und
Handwerk einzurechnenden Vedutenstechern Gmelin, Halden-
wang, Frommei und dem Lehrer der beiden erstgenannten
Christian v. Mechel, über die wir in liebenswürdigem Ein-
gehen auf persönliche Umstände unterrichtet werden. Der
Teil der Arbeit, der die „Entstehung und Bedeutung der
Vedute" zum Gegenstand hat, reizt unsere Aufmerksamkeit
wohl mehr. So umfassend, wie diese Kapitelüberschrift an-
gibt, ist nun freilich das Thema nicht genommen. Das Schick-
sal der europäischen Vedute wird nicht aufgerollt; Piranesi
und seine Romvedute, Venedig und Canaletto, die Rhein-
vedute, die Hollandvedute, die Englandvedute, aber auch in
der Nähe die Schütz, die Kobell, die Fries, Olivier und
Quaglio u. a. — sie alle werden nicht aufgerufen. Und wohin
gehören schließlich mehrere Bilder C. D. Friedrichs? Die
besondere Frage der Panoramenmalerei — es sei an Schinkel
erinnert — wird beiseite gelassen. Das verlockende Thema
der Vedute ist also, übrigens mit Recht, um den Maßstab zu
wahren, auf die badischen Stecher zugeschnitten und scharf
beschnitten worden. Die Darstellung von der Entstehung der
Vedute gerät dadurch zwar in eine etwas verzogene Perspek-
tive, aber auch dabei ist dieser sich beschränkende und sich
stark auf die damals geführte literarische Diskussion des
Themas stützende Beitrag wertvoll, da auf diesem Gebiet
noch viel zu leisten bleibt. War die Beschränkung geboten,
so war der Rückgriff auf literarische Belege gerade in dieser
Zeit mindestens erlaubt. Für uns werden wir uns dabei be-
gnügen, daß der Begriff der Vedute viel Verschiedenartiges
deckt und weitherzig gehandhabt sein will.
Auf der Seite der Technik fällt ins Auge, daß weder
Gmelin (f 1820), Haldenwang (t 1831), noch Frommei
50