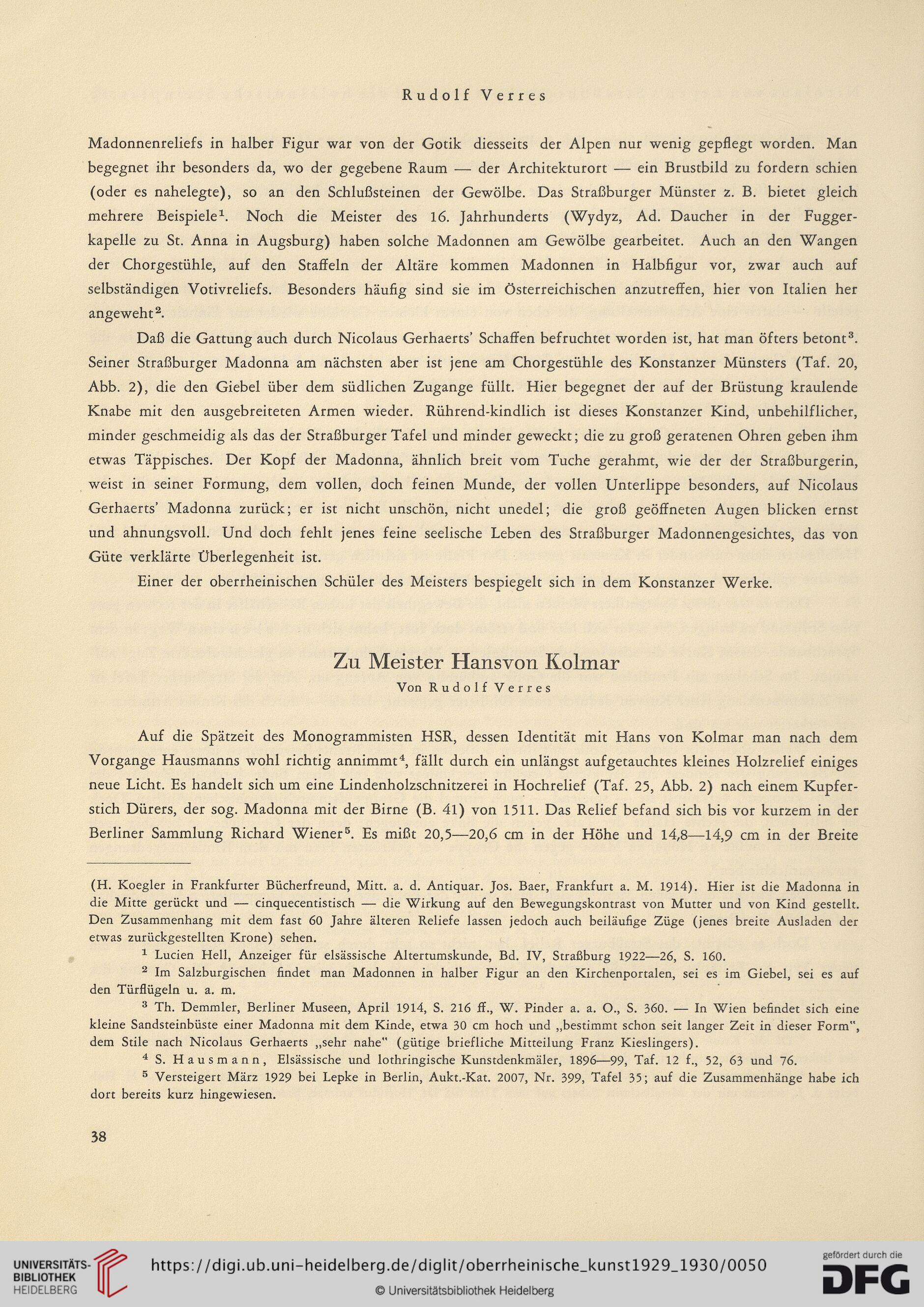Rudolf Verres
Madonnenreliefs in halber Figur war von der Gotik diesseits der Alpen nur wenig gepflegt worden. Man
begegnet ihr besonders da, wo der gegebene Raum — der Architekturort — ein Brustbild zu fordern schien
(oder es nahelegte), so an den Schlußsteinen der Gewölbe. Das Straßburger Münster z. B. bietet gleich
mehrere Beispiele* 1. Noch die Meister des 16. Jahrhunderts (Wydyz, Ad. Daucher in der Fugger-
kapelle zu St. Anna in Augsburg) haben solche Madonnen am Gewölbe gearbeitet. Auch an den Wangen
der Chorgestühle, auf den Staffeln der Altäre kommen Madonnen in Halbfigur vor, zwar auch auf
selbständigen Votivreliefs. Besonders häufig sind sie im Österreichischen anzutreffen, hier von Italien her
angeweht2.
Daß die Gattung auch durch Nicolaus Gerhaerts’ Schaffen befruchtet worden ist, hat man öfters betont3.
Seiner Straßburger Madonna am nächsten aber ist jene am Chorgestühle des Konstanzer Münsters (Taf. 20,
Abb. 2), die den Giebel über dem südlichen Zugänge füllt. Hier begegnet der auf der Brüstung kraulende
Knabe mit den ausgebreiteten Armen wieder. Rührend-kindlich ist dieses Konstanzer Kind, unbehilflicher,
minder geschmeidig als das der Straßburger Tafel und minder geweckt; die zu groß geratenen Ohren geben ihm
etwas Täppisches. Der Kopf der Madonna, ähnlich breit vom Tuche gerahmt, wie der der Straßburgerin,
weist in seiner Formung, dem vollen, doch feinen Munde, der vollen Unterlippe besonders, auf Nicolaus
Gerhaerts’ Madonna zurück; er ist nicht unschön, nicht unedel; die groß geöffneten Augen blicken ernst
und ahnungsvoll. Und doch fehlt jenes feine seelische Leben des Straßburger Madonnengesichtes, das von
Güte verklärte Überlegenheit ist.
Einer der oberrheinischen Schüler des Meisters bespiegelt sich in dem Konstanzer Werke.
Zu Meister Hansvon Kolmar
Von Rudolf Verres
Auf die Spätzeit des Monogrammisten HSR, dessen Identität mit Hans von Kolmar man nach dem
Vorgänge Hausmanns wohl richtig annimmt4, fällt durch ein unlängst aufgetauchtes kleines Holzrelief einiges
neue Licht. Es handelt sich um eine Lindenholzschnitzerei in Hochrelief (Taf. 25, Abb. 2) nach einem Kupfer-
stich Dürers, der sog. Madonna mit der Birne (B. 41) von 1511. Das Relief befand sich bis vor kurzem in der
Berliner Sammlung Richard Wiener5. Es mißt 20,5—20,6 cm in der Höhe und 14,8—14,9 cm in der Breite
(H. Koegler in Frankfurter Bücherfreund, Mitt. a. d. Antiquar. Jos. Baer, Frankfurt a. M. 1914). Hier ist die Madonna in
die Mitte gerückt und — cinquecentistisch — die Wirkung auf den Bewegungskontrast von Mutter und von Kind gestellt.
Den Zusammenhang mit dem fast 60 Jahre älteren Reliefe lassen jedoch auch beiläufige Züge (jenes breite Ausladen der
etwas zurückgestellten Krone) sehen.
1 Lucien Hell, Anzeiger für elsässische Altertumskunde, Bd. IV, Straßburg 1922—26, S. 160.
2 Im Salzburgischen findet man Madonnen in halber Figur an den Kirchenportalen, sei es im Giebel, sei es auf
den Türflügeln u. a. m.
3 Th. Demmler, Berliner Museen, April 1914, S. 216 ff., W. Pinder a. a. O., S. 360. — In Wien befindet sich eine
kleine Sandsteinbüste einer Madonna mit dem Kinde, etwa 30 cm hoch und „bestimmt schon seit langer Zeit in dieser Form",
dem Stile nach Nicolaus Gerhaerts „sehr nahe" (gütige briefliche Mitteilung Franz Kieslingers).
4 S. Hausmann, Elsässische und lothringische Kunstdenkmäler, 1896—99, Taf. 12 f., 52, 63 und 76.
5 Versteigert März 1929 bei Lepke in Berlin, Aukt.-Kat. 2007, Nr. 399, Tafel 35; auf die Zusammenhänge habe ich
dort bereits kurz hingewiesen.
38
Madonnenreliefs in halber Figur war von der Gotik diesseits der Alpen nur wenig gepflegt worden. Man
begegnet ihr besonders da, wo der gegebene Raum — der Architekturort — ein Brustbild zu fordern schien
(oder es nahelegte), so an den Schlußsteinen der Gewölbe. Das Straßburger Münster z. B. bietet gleich
mehrere Beispiele* 1. Noch die Meister des 16. Jahrhunderts (Wydyz, Ad. Daucher in der Fugger-
kapelle zu St. Anna in Augsburg) haben solche Madonnen am Gewölbe gearbeitet. Auch an den Wangen
der Chorgestühle, auf den Staffeln der Altäre kommen Madonnen in Halbfigur vor, zwar auch auf
selbständigen Votivreliefs. Besonders häufig sind sie im Österreichischen anzutreffen, hier von Italien her
angeweht2.
Daß die Gattung auch durch Nicolaus Gerhaerts’ Schaffen befruchtet worden ist, hat man öfters betont3.
Seiner Straßburger Madonna am nächsten aber ist jene am Chorgestühle des Konstanzer Münsters (Taf. 20,
Abb. 2), die den Giebel über dem südlichen Zugänge füllt. Hier begegnet der auf der Brüstung kraulende
Knabe mit den ausgebreiteten Armen wieder. Rührend-kindlich ist dieses Konstanzer Kind, unbehilflicher,
minder geschmeidig als das der Straßburger Tafel und minder geweckt; die zu groß geratenen Ohren geben ihm
etwas Täppisches. Der Kopf der Madonna, ähnlich breit vom Tuche gerahmt, wie der der Straßburgerin,
weist in seiner Formung, dem vollen, doch feinen Munde, der vollen Unterlippe besonders, auf Nicolaus
Gerhaerts’ Madonna zurück; er ist nicht unschön, nicht unedel; die groß geöffneten Augen blicken ernst
und ahnungsvoll. Und doch fehlt jenes feine seelische Leben des Straßburger Madonnengesichtes, das von
Güte verklärte Überlegenheit ist.
Einer der oberrheinischen Schüler des Meisters bespiegelt sich in dem Konstanzer Werke.
Zu Meister Hansvon Kolmar
Von Rudolf Verres
Auf die Spätzeit des Monogrammisten HSR, dessen Identität mit Hans von Kolmar man nach dem
Vorgänge Hausmanns wohl richtig annimmt4, fällt durch ein unlängst aufgetauchtes kleines Holzrelief einiges
neue Licht. Es handelt sich um eine Lindenholzschnitzerei in Hochrelief (Taf. 25, Abb. 2) nach einem Kupfer-
stich Dürers, der sog. Madonna mit der Birne (B. 41) von 1511. Das Relief befand sich bis vor kurzem in der
Berliner Sammlung Richard Wiener5. Es mißt 20,5—20,6 cm in der Höhe und 14,8—14,9 cm in der Breite
(H. Koegler in Frankfurter Bücherfreund, Mitt. a. d. Antiquar. Jos. Baer, Frankfurt a. M. 1914). Hier ist die Madonna in
die Mitte gerückt und — cinquecentistisch — die Wirkung auf den Bewegungskontrast von Mutter und von Kind gestellt.
Den Zusammenhang mit dem fast 60 Jahre älteren Reliefe lassen jedoch auch beiläufige Züge (jenes breite Ausladen der
etwas zurückgestellten Krone) sehen.
1 Lucien Hell, Anzeiger für elsässische Altertumskunde, Bd. IV, Straßburg 1922—26, S. 160.
2 Im Salzburgischen findet man Madonnen in halber Figur an den Kirchenportalen, sei es im Giebel, sei es auf
den Türflügeln u. a. m.
3 Th. Demmler, Berliner Museen, April 1914, S. 216 ff., W. Pinder a. a. O., S. 360. — In Wien befindet sich eine
kleine Sandsteinbüste einer Madonna mit dem Kinde, etwa 30 cm hoch und „bestimmt schon seit langer Zeit in dieser Form",
dem Stile nach Nicolaus Gerhaerts „sehr nahe" (gütige briefliche Mitteilung Franz Kieslingers).
4 S. Hausmann, Elsässische und lothringische Kunstdenkmäler, 1896—99, Taf. 12 f., 52, 63 und 76.
5 Versteigert März 1929 bei Lepke in Berlin, Aukt.-Kat. 2007, Nr. 399, Tafel 35; auf die Zusammenhänge habe ich
dort bereits kurz hingewiesen.
38