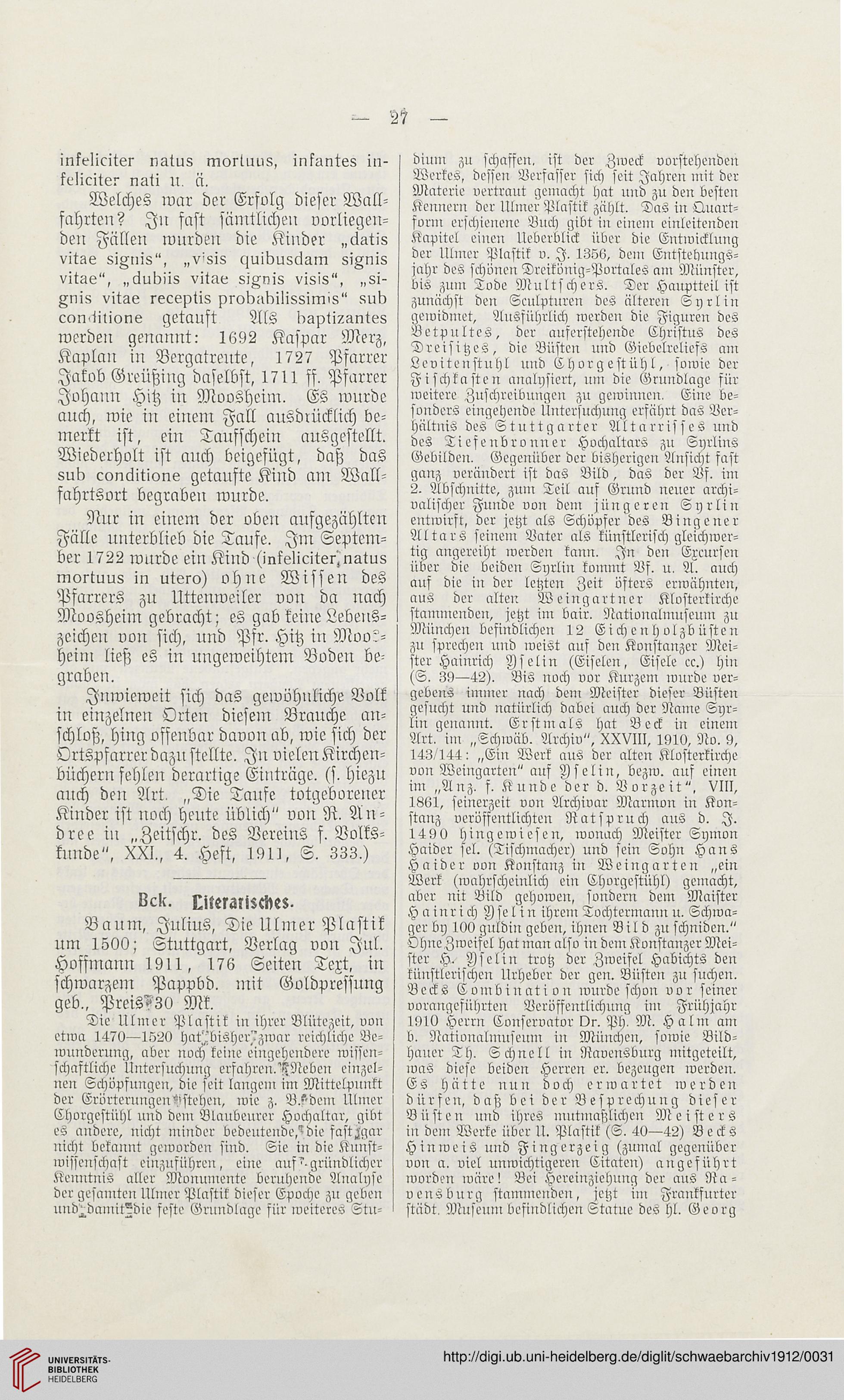— '27
inleäicitei' iiatus mortuuR, iukantes iu-
feliciter nuti in ä.
Welches war der Erfolg dieser Wall-
fahrten? Jn fast sämtlichen vorliegen-
den Fällen mnrden die Kinder „clatis
vitse siAui8", „v^sis guibusäain siZnis
vitae", „äubüs vitae siZnis visis", „si-
Aiüs vitae receptis prokakilissimis" sub
conüirione getauft Als baptixantes
werden genannt: 1692 Kaspar Merz,
Kaplan in Bergatreute, 1727 Pfarrer
Jakob Greüßing daselbst, 1711 ff. Pfarrer
Johann Hitz in Moasheim. Es wurde
auch, wie in eineni Fall ausdrücklich be-
merkt ist, ein Taufschein ausgestellt.
Wiederholt ist auch beigefügt, daß das
suk conclitionc getaufte Kind am Wall-
fahrtsort begraben murde.
Nur in einem der oben aufgezählten
Fälle unterblieb die Taufe. Jin Septem-
ber 1722 murde ein Kind (inksliciter, natus
mortuus in utero) ohne Wissen des
Pfarrers zu Uttenweiler von da nach
Moosheim gebracht; es gab keine Lebens-
zeichen von sich, und Pfr. Hitz in Moos-
heim ließ es in ungemeihtem Boden be-
graben.
Jnwieweit fich das gewöhnliche Volk
in einzelnen Orten diesem Brauche an-
schlaß, hing offenbar davon ab, wie sich der
Ortspfarrerdazustellte. Jn vielenKirchen-
büchern fehlen derartige Einträge. (f. hiezu
auch den Art. „Die Taufe totgeborener
Kinder ist noch heute üblich" von R. An-
dree in „Zeitschr. des Vereins f. Volks-
kunde", XXI., 4. Heft, 1911, S. 333.)
llclc. Lttesüljsche;-
Baum, Julius, Die Ulmer Plastik
um 1500; Stuttgart, Verlag von Jul.
Hoffmann 1911, 176 Seiten Text, in
schwarzem Pappbd. mit Goldpressung
geb., Preis?30 Mk.
Dic Ulmer Plastik in ihrcr Vlütczeit, von
ctwa 1470—1520 haUbisher'-'zwar reichliche Be-
wunderung, nber nvch kcine eingehendere wissen-
schaftlichc Untersuchung erfahrcn.UNebcn einzel-
nen Schöpfungen, die seit langem irn Mittelpnnkt
der Erörterungenchstehen, rvie z. B.s'dem Ulmer
Chorgcstiihl und dem Blaubeurer Hochaltar, gibt
es andere, nicht minder bedeutcndcPdie fast^gar
nicht bekannt geworden sind. Sie in die Kunst-
nnssenschast einzufiihren, eine nuf"-gründlicher
Kenntnis aller Monumente beruhende Analyse
der gesamten Uliner Plastik dieser Epoche zu geben
und^damit^die feste Grundlage fiir weiteres Stu-
dium zu schaffen. ist der Zweck vorstehenden
Werkes, dessen Verfasser sich seit Jahren mit der
Materie vertraut gemacht hat und zu den besten
Kennern der Ulmer Plastik zählt. Das in Quart-
form erschienenc Vuch giüt in einem einleitenden
Kapitel einen Ueberblick iiber die Entwicklung
dcr Ulmcr Plastik v. I. 1356, dem Entstehungs-
jahr des schönen Dreikönig-Portales ani Miinster,
bis zum Tode Multschers. Der Hauptteil ist
zunächst den Seulpturen des älteren Sprlin
gewidmet, Ausführlich werdcn die Figuren dcs
Betpultes, der auferstehendc Christus des
Dreisitzes, die Büsten und Giebelreliefs am
Levitenftuhl und Chorgestühl, sowie der
Fischkastcn analysiert, um die Grundlage für
weitere Zuschreibungen zu gewinncn. Eins be-
svnders eingehendo Untersuchung erfährt das Ber-
hältnis des Stuttgarter Altarrisses und
des Tiefenbronner Hochaltars zu Sprlins
Geüilden. Gegcnüber der bisherigen Ansicht fast
ganz verändert ist das Bild, das dcr Vf. im
2. Abschnitte, zuin Teil auf Grund neuer archi-
valischer Funde von dein jüngeren Syrlin
entivirft, dcr jetzt nls Schöpfer des Bingener
Altars seinem Vater als künstlcrisch gleichwer-
tig angereiht iverden kann. In den Exeursen
iiber die beiden Syrlin kvinmt Vf. n. A. auch
auf die in der lctzten Zeit öfters erwähnten,
nus der alten Weingartner Klosterkirche
stainmenden, jetzt im bair. Nationalmuseum zu
München befindlichen 12 Eichenhvlzbüsten
zu sprechcn und wcist auf den Konstanzer Mei-
ster Hainrich Iselin (Eiselen, Eisele cc.) hin
(S. 89—42). Bis noch vor Kurzem wurde ver-
geüens immer nach dein Meister dieser Büsten
gesucht und natiirlich dabei auch der Name Syr-
lin genannt. Erstmals hat Bcck in einem
Art. im „Schwäb. Archiv", XXVIII, 1910, No. 9,
143/144: „Ein Werk aus der altcn Klosterkirche
von Weingarten" auf Iselin, bezw. auf einen
im „Anz. f. Kunde der d. Vorzeit", VIII,
1861, seinerzeit von Archivar Marmon in Kon-
stanz veröffentlichten Ratspruch aus d. I.
149 0 hingewiesen, ivonach Meister Symon
Haider sel. (Tischmacher) und sein Sohn Hans
Haider ovn Konstanz in Weingarten „ein
Werk (wnhrscheinlich ein Chorgestühl) gcinacht,
aber nit Bild gehowen, sondern dem Maister
Hainrich DseIin ihrem Tochtermann u. Schiva-
ger by 100 guldin geben, ihnen Vild zu schnidcn."
OhneZwcifel hatman also in dem Konstanzer Mei-
ster H. Uselin trotz der Zweifel Habichts den
künstlcrischcn Urhebcr der gcn. Büstcn zu suchen.
Becks Combination wurde schon vor seiner
vorangeführten Veröffentlichung im Frühjahr
1910 Herrn Conservator Or. Ph. M. Halm ani
b. Nationalmuseum in Münchcn, sowie Bild-
hauer Th. Schnell in Ravensburg mitgeteilt,
was dicse beidcn Hcrren er. bezcugen werden.
Es hätte nun doch erwartet werden
dürfen, daß bei der Besprechung dieser
Büsten und ihres mntmaszlichcn M c i st e r s
in dcm Werkc iiber II. Plastik (S. 40—42) Vecks
Hinweis und Fingerzeig (zumal gegenüber
von a. viel unwichtigeren Citaten) angcführt
worden wäre! Bei Hereinziehung der aus Ra-
vcnsburg stammenden, jctzt im Frankfurter
städt. Museum befindlichen Statue des hl. Georg
inleäicitei' iiatus mortuuR, iukantes iu-
feliciter nuti in ä.
Welches war der Erfolg dieser Wall-
fahrten? Jn fast sämtlichen vorliegen-
den Fällen mnrden die Kinder „clatis
vitse siAui8", „v^sis guibusäain siZnis
vitae", „äubüs vitae siZnis visis", „si-
Aiüs vitae receptis prokakilissimis" sub
conüirione getauft Als baptixantes
werden genannt: 1692 Kaspar Merz,
Kaplan in Bergatreute, 1727 Pfarrer
Jakob Greüßing daselbst, 1711 ff. Pfarrer
Johann Hitz in Moasheim. Es wurde
auch, wie in eineni Fall ausdrücklich be-
merkt ist, ein Taufschein ausgestellt.
Wiederholt ist auch beigefügt, daß das
suk conclitionc getaufte Kind am Wall-
fahrtsort begraben murde.
Nur in einem der oben aufgezählten
Fälle unterblieb die Taufe. Jin Septem-
ber 1722 murde ein Kind (inksliciter, natus
mortuus in utero) ohne Wissen des
Pfarrers zu Uttenweiler von da nach
Moosheim gebracht; es gab keine Lebens-
zeichen von sich, und Pfr. Hitz in Moos-
heim ließ es in ungemeihtem Boden be-
graben.
Jnwieweit fich das gewöhnliche Volk
in einzelnen Orten diesem Brauche an-
schlaß, hing offenbar davon ab, wie sich der
Ortspfarrerdazustellte. Jn vielenKirchen-
büchern fehlen derartige Einträge. (f. hiezu
auch den Art. „Die Taufe totgeborener
Kinder ist noch heute üblich" von R. An-
dree in „Zeitschr. des Vereins f. Volks-
kunde", XXI., 4. Heft, 1911, S. 333.)
llclc. Lttesüljsche;-
Baum, Julius, Die Ulmer Plastik
um 1500; Stuttgart, Verlag von Jul.
Hoffmann 1911, 176 Seiten Text, in
schwarzem Pappbd. mit Goldpressung
geb., Preis?30 Mk.
Dic Ulmer Plastik in ihrcr Vlütczeit, von
ctwa 1470—1520 haUbisher'-'zwar reichliche Be-
wunderung, nber nvch kcine eingehendere wissen-
schaftlichc Untersuchung erfahrcn.UNebcn einzel-
nen Schöpfungen, die seit langem irn Mittelpnnkt
der Erörterungenchstehen, rvie z. B.s'dem Ulmer
Chorgcstiihl und dem Blaubeurer Hochaltar, gibt
es andere, nicht minder bedeutcndcPdie fast^gar
nicht bekannt geworden sind. Sie in die Kunst-
nnssenschast einzufiihren, eine nuf"-gründlicher
Kenntnis aller Monumente beruhende Analyse
der gesamten Uliner Plastik dieser Epoche zu geben
und^damit^die feste Grundlage fiir weiteres Stu-
dium zu schaffen. ist der Zweck vorstehenden
Werkes, dessen Verfasser sich seit Jahren mit der
Materie vertraut gemacht hat und zu den besten
Kennern der Ulmer Plastik zählt. Das in Quart-
form erschienenc Vuch giüt in einem einleitenden
Kapitel einen Ueberblick iiber die Entwicklung
dcr Ulmcr Plastik v. I. 1356, dem Entstehungs-
jahr des schönen Dreikönig-Portales ani Miinster,
bis zum Tode Multschers. Der Hauptteil ist
zunächst den Seulpturen des älteren Sprlin
gewidmet, Ausführlich werdcn die Figuren dcs
Betpultes, der auferstehendc Christus des
Dreisitzes, die Büsten und Giebelreliefs am
Levitenftuhl und Chorgestühl, sowie der
Fischkastcn analysiert, um die Grundlage für
weitere Zuschreibungen zu gewinncn. Eins be-
svnders eingehendo Untersuchung erfährt das Ber-
hältnis des Stuttgarter Altarrisses und
des Tiefenbronner Hochaltars zu Sprlins
Geüilden. Gegcnüber der bisherigen Ansicht fast
ganz verändert ist das Bild, das dcr Vf. im
2. Abschnitte, zuin Teil auf Grund neuer archi-
valischer Funde von dein jüngeren Syrlin
entivirft, dcr jetzt nls Schöpfer des Bingener
Altars seinem Vater als künstlcrisch gleichwer-
tig angereiht iverden kann. In den Exeursen
iiber die beiden Syrlin kvinmt Vf. n. A. auch
auf die in der lctzten Zeit öfters erwähnten,
nus der alten Weingartner Klosterkirche
stainmenden, jetzt im bair. Nationalmuseum zu
München befindlichen 12 Eichenhvlzbüsten
zu sprechcn und wcist auf den Konstanzer Mei-
ster Hainrich Iselin (Eiselen, Eisele cc.) hin
(S. 89—42). Bis noch vor Kurzem wurde ver-
geüens immer nach dein Meister dieser Büsten
gesucht und natiirlich dabei auch der Name Syr-
lin genannt. Erstmals hat Bcck in einem
Art. im „Schwäb. Archiv", XXVIII, 1910, No. 9,
143/144: „Ein Werk aus der altcn Klosterkirche
von Weingarten" auf Iselin, bezw. auf einen
im „Anz. f. Kunde der d. Vorzeit", VIII,
1861, seinerzeit von Archivar Marmon in Kon-
stanz veröffentlichten Ratspruch aus d. I.
149 0 hingewiesen, ivonach Meister Symon
Haider sel. (Tischmacher) und sein Sohn Hans
Haider ovn Konstanz in Weingarten „ein
Werk (wnhrscheinlich ein Chorgestühl) gcinacht,
aber nit Bild gehowen, sondern dem Maister
Hainrich DseIin ihrem Tochtermann u. Schiva-
ger by 100 guldin geben, ihnen Vild zu schnidcn."
OhneZwcifel hatman also in dem Konstanzer Mei-
ster H. Uselin trotz der Zweifel Habichts den
künstlcrischcn Urhebcr der gcn. Büstcn zu suchen.
Becks Combination wurde schon vor seiner
vorangeführten Veröffentlichung im Frühjahr
1910 Herrn Conservator Or. Ph. M. Halm ani
b. Nationalmuseum in Münchcn, sowie Bild-
hauer Th. Schnell in Ravensburg mitgeteilt,
was dicse beidcn Hcrren er. bezcugen werden.
Es hätte nun doch erwartet werden
dürfen, daß bei der Besprechung dieser
Büsten und ihres mntmaszlichcn M c i st e r s
in dcm Werkc iiber II. Plastik (S. 40—42) Vecks
Hinweis und Fingerzeig (zumal gegenüber
von a. viel unwichtigeren Citaten) angcführt
worden wäre! Bei Hereinziehung der aus Ra-
vcnsburg stammenden, jctzt im Frankfurter
städt. Museum befindlichen Statue des hl. Georg