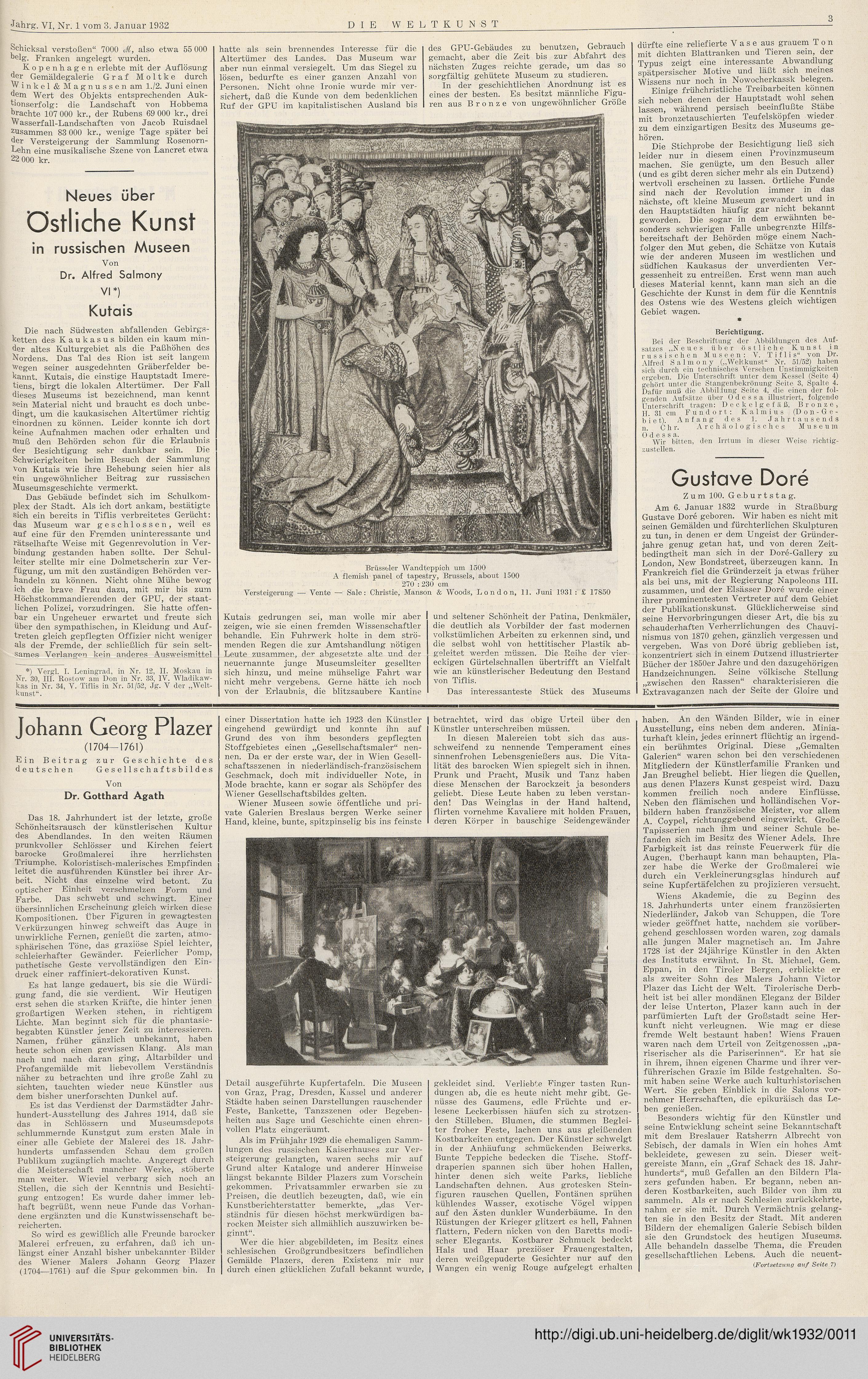Jahrg. VI, Nr. 1 vom 3. Januar 1932
DIE WELTKUNST
3
Schicksal verstoßen“ 7000 M, also etwa 55 000
belg. Franken angelegt wurden.
Kopenhagen erlebte mit der Auflösung
der Gemäldegalerie Graf Moltke durch
Winkel & Magnussen am 1./2. Juni einen
dem Wert des Objekts entsprechenden Auk-
tionserfolg: die Landschaft von Hobbema
brachte 107 000 kr., der Rubens 69 000 kr., drei
Wasserfall-Landschaften von Jacob Ruisdael
zusammen 83 000 kr., wenige Tage später bei
der Versteigerung der Sammlung Rosenorn-
Lehn eine musikalische Szene von Lancret etwa
22 000 kr.
Neues über
Östliche Kunst
in russischen Museen
Von
Dr. Alfred Salmony
VI*)
Kutais
Die nach Südwesten abfallenden Gebirgs-
ketten des Kaukasus bilden ein kaum min-
der altes Kulturgebiet als die Paßhöhen des
Nordens. Das Tal des Rion ist seit langem
^egen seiner ausgedehnten Gräberfelder be-
kannt. Kutais, die einstige Hauptstadt Imere-
tiens, birgt die lokalen Altertümer. Der Fall
dieses Museums ist bezeichnend, man kennt
sein Material nicht und braucht es doch unbe-
dingt, um die kaukasischen Altertümer richtig
einordnen zu können. Leider konnte ich dort
keine Aufnahmen machen oder erhalten und
muß den Behörden schon für die Erlaubnis
der Besichtigung sehr dankbar sein. Die
Schwierigkeiten beim Besuch der Sammlung
Von Kutais wie ihre Behebung seien hier als
ein ungewöhnlicher Beitrag zur russischen
Museumsgeschichte vermerkt.
Das Gebäude befindet sich im Schulkom-
plex der Stadt. Als ich dort ankam, bestätigte
sich ein bereits in Tiflis verbreitetes Gerücht:
das Museum war geschlossen, weil es
auf eine für den Fremden uninteressante und
rätselhafte Weise mit Gegenrevolution in Ver-
bindung gestanden haben sollte. Der Schul-
leiter stellte mir eine Dolmetscherin zur Ver-
fügung, um mit den zuständigen Behörden ver-
handeln zu können. Nicht ohne Mühe bewog
ich die brave Frau dazu, mit mir bis zum
Höchstkommandierenden der GPU, der staat-
lichen Polizei, vorzudringen. Sie hatte offen-
bar ein Ungeheuer erwartet und freute sich
über den sympathischen, in Kleidung und Auf-
treten gleich gepflegten Offizier nicht weniger
als der Fremde, der schließlich für sein selt-
sames Verlangen kein anderes Ausweismittel
*) Vergl. I. Leningrad, in Nr. 12, II. Moskau in
Nr. 30, III. Rostow am Don in Nr. 33, IV. Wladikaw-
kas in Nr. 34, V. Tiflis in Nr. 51/52, Jg. V der „Welt-
kunst“.
hatte als sein brennendes Interesse für die
Altertümer des Landes. Das Museum war
aber nun einmal versiegelt. Um das Siegel zu
lösen, bedurfte es einer ganzen Anzahl von
Personen. Nicht ohne Ironie wurde mir ver-
sichert, daß die Kunde von dem bedenklichen
Ruf der GPU im kapitalistischen Ausland bis
des GPU-Gebäudes zu benutzen, Gebrauch
gemacht, aber die Zeit bis zur Abfahrt des
nächsten Zuges reichte gerade, um das so
sorgfältig gehütete Museum zu studieren.
In der geschichtlichen Anordnung ist es
eines der besten. Es besitzt männliche Figu-
ren aus Bronze von ungewöhnlicher Größe
Brüsseler Wandteppich um 1500
A flemisli panel of tapestry, Brussels, about 1500
270 :230 cm
Versteigerung — Vente — Sale: Christie, Manson & Woods, London, 11. Juni 1931 : £ 17850
Kutais gedrungen sei, man wolle mir aber
zeigen, wie sie einen fremden Wissenschaftler
behandle. Ein Fuhrwerk holte in dem strö-
menden Regen die zur Amtshandlung nötigen
Leute zusammen, der abgesetzte alte und der
neuernannte junge Museumsleiter gesellten
sich hinzu, und meine mühselige Fahrt war
nicht mehr vergebens. Gerne hätte ich noch
von der Erlaubnis, die blitzsaubere Kantine
und seltener Schönheit der Patina, Denkmäler,
die deutlich als Vorbilder der fast modernen
volkstümlichen Arbeiten zu erkennen sind, und
die selbst wohl von hettitischer Plastik ab-
geleitet werden müssen. Die Reihe der vier-
eckigen Gürtelschnallen übertrifft an Vielfalt
wie an künstlerischer Bedeutung den Bestand
von Tiflis.
Das interessanteste Stück des Museums
dürfte eine reliefierte V a s e aus grauem Ton
mit dichten Blattranken und Tieren sein, der
Typus zeigt eine interessante Abwandlung
spätpersischer Motive und läßt sich meines
Wissens nur noch in Nowocherkassk belegen.
Einige frühchristliche Treibarbeiten können
sich neben denen der Hauptstadt wohl sehen
lassen, während persisch beeinflußte Stäbe
mit bronzetauschierten Teufelsköpfen wieder
zu dem einzigartigen Besitz des Museums ge-
hören.
Die Stichprobe der Besichtigung ließ sich
leider nur in diesem einen Provinzmuseum
machen. Sie genügte, um den Besuch aller
(und es gibt deren sicher mehr als ein Dutzend)
wertvoll erscheinen zu lassen. Örtliche, Funde
sind nach der Revolution immer in das
nächste, oft kleine Museum gewandert und in
den Hauptstädten häufig gar nicht bekannt
geworden. Die sogar in dem erwähnten be-
sonders schwierigen Falle unbegrenzte Hilfs-
bereitschaft der Behörden möge einem Nach-
folger den Mut geben, die Schätze von Kutais
wie der anderen Museen im westlichen und
südlichen Kaukasus der unverdienten Ver-
gessenheit zu entreißen. Erst wenn man auch
dieses Material kennt, kann man sich an die
Geschichte der Kunst in dem für die Kenntnis
des Ostens wie des Westens gleich wichtigen
Gebiet wagen.
•
Berichtigung.
Bei der Beschriftung der Abbildungen des Auf-
satzes „Neues über östliche Kunst in
russischen Museen: V. Tiflis“ von Dr.
Alfred S a 1 m o n y („Weltkunst“ Nr. 51/52) haben
sich durch ein technisches Versehen Unstimmigkeiten
ergeben. Die Unterschrift unter dem Kessel (Seite 4)
gehört unter die Stangenbekrönung Seite 3, Spalte 4.
Dafür muß die Abbildung Seite 4. die einen der fol-
genden Aufsätze über Odessa illustriert, folgende
Unterschrift tragen: Deckel gefäß. Bronze,
H. 31 cm Fundort: K a 1 m i u s (Don-Ge-
biet). Anfang des 1. .Jahrtausends
n. C h r. Archäologisches Museum
Odessa.
Wir bitten, den Irrtum in dieser Weise richtig-
zustellen.
Gustave Dore
Zum 100. Geburtstag.
Am 6. Januar 1832 wurde in Straßburg
Gustave Dore geboren. Wir haben es nicht mit
seinen Gemälden und fürchterlichen Skulpturen
zu tun, in denen er dem Ungeist der Gründer-
jahre genug getan hat, und von deren Zeit-
bedingtheit man sich in der Dore-Gallery zu
London, New Bondstreet, überzeugen kann. In
Frankreich fiel die Gründerzeit ja etwas früher
als bei uns, mit der Regierung Napoleons III.
zusammen, und der Elsässer Dore wurde einer
ihrer prominentesten Vertreter auf dem Gebiet
der Publikationskunst. Glücklicherweise sind
seine Hervorbringungen dieser Art, die bis zu
schauderhaften Verherrlichungen des Chauvi-
nismus von 1870 gehen, gänzlich vergessen und
vergeben. Was von Dore übrig geblieben ist,
konzentriert sich in einem Dutzend illustrierter
Bücher der 1850er Jahre und den dazugehörigen
Handzeichnungen. Seine völkische Stellung
„zwischen den Rassen“ charakterisieren die
Extravaganzen nach der Seite der Gloire und
Johann Georg Plazer
(1704-1761)
Ein Beitrag zur Geschichte des
deutschen Gese11schaftsbi 1 des
Von
Dr. Gotthard Agath
Das 18. Jahrhundert ist der letzte, große
Schönheitsrausch der künstlerischen Kultui'
des Abendlandes. In den weiten Räumen
prunkvoller Schlösser und Kirchen feiert
barocke Großmalerei ihre herrlichsten
Triumphe. Koloristisch-malerisches Empfinden
leitet die ausführenden Künstler bei ihrer Ar-
beit. Nicht das einzelne wird betont. Zu
optischer Einheit verschmelzen Form und
Farbe. Das schwebt und schwingt. Einer
übersinnlichen Erscheinung gleich wirken diese
Kompositionen. Über Figuren in gewagtesten
Verkürzungen hinweg schweift das Auge in
unwirkliche Fernen, genießt die zarten, atmo-
sphärischen Töne, das graziöse Spiel leichter,
schleierhafter Gewänder. Feierlicher Pomp,
pathetische Geste vervollständigen den Ein-
druck einer raffiniert-dekorativen Kunst.
Es hat lange gedauert, bis sie die Würdi-
gung fand, die sie verdient. Wir Heutigen
erst sehen die starken Kräfte, die hinter jenen
großartigen Werken stehen, in richtigem
Lichte. Man beginnt sich für die phantasie-
begabten Künstler jener Zeit zu interessieren.
Namen, früher gänzlich unbekannt, haben
heute schon einen gewissen Klang. Als man
nach und nach daran ging, Altarbilder und
Profangemälde mit liebevollem Verständnis
näher zu betrachten und ihre große Zahl zu
sichten, tauchten wieder neue Künstler aus
dem bisher unerforschten Dunkel auf.
Es ist das Verdienst der Darmstädter Jahr-
hundert-Ausstellung des Jahres 1914, daß sie
das in Schlössern und Museumsdepots
schlummernde Kunstgut zum ersten Male in
einer alle Gebiete der Malerei des 18. Jahr-
hunderts umfassenden Schau dem großen
Publikum zugänglich machte. Angeregt durch
die Meisterschaft mancher Werke, stöberte
man weiter. Wieviel verbarg sich noch an
Stellen, die sich der Kenntnis und Besichti-
gung entzogen! Es wurde daher immer leb-
haft begrüßt, wenn neue Funde das Vorhan-
dene ergänzten und die Kunstwissenschaft be-
reicherten.
So wird es gewißlich alle Freunde barocker
Malerei erfreuen, zu erfahren, daß ich un-
längst einer Anzahl bisher unbekannter Bilder
des Wiener Malers Johann Georg Plazer
(1704—1761) auf die Spur gekommen bin. In
einer Dissertation hatte ich 1923 den Künstler
eingehend gewürdigt und konnte ihn auf
Grund des von ihm besonders gepflegten
Stoffgebietes einen „Gesellschaftsmaler“ nen-
nen. Da er der erste war, der in Wien Gesell-
schaftsszenen in niederländisch-französischem
Geschmack, doch mit individueller Note, in
Mode brachte, kann er sogar als Schöpfer des
Wiener Gesellschaftsbildes gelten.
Wiener Museen sowie öffentliche und pri-
vate Galerien Breslaus bergen Werke seiner
Hand, kleine, bunte, spitzpinselig bis ins feinste
betrachtet, wird das obige Urteil über den
Künstler unterschreiben müssen.
In diesen Malereien tobt sich das aus-
schweifend zu nennende Temperament eines
sinnenfrohen Lebensgenießers aus. Die Vita-
lität des barocken Wien spiegelt sich in ihnen.
Prunk und Pracht, Musik und Tanz haben
diese Menschen der Barockzeit ja besonders
geliebt. Diese Leute haben zu leben verstan-
den! Das Weinglas in der Hand haltend,
flirten vornehme Kavaliere mit holden Frauen,
deren Körper in bauschige Seidengewänder
Detail ausgeführte Kupfertafeln. Die Museen
von Graz, Prag, Dresden, Kassel und anderer
Städte haben seinen Darstellungen rauschender
Feste, Bankette, Tanzszenen oder Begeben-
heiten aus Sage und Geschichte einen ehren-
vollen Platz eingeräumt.
Als im Frühjahr 1929 die ehemaligen Samm-
lungen des russischen Kaiserhauses zur Ver-
steigerung gelangten, waren sechs mir auf
Grund alter Kataloge und anderer Hinweise
längst bekannte Bilder Plazers zum Vorschein
gekommen. Privatsammler erwarben sie zu
Preisen, die deutlich bezeugten, daß, wie ein
Kunstberichterstatter bemerkte, „das Ver-
ständnis für diesen höchst merkwürdigen ba-
rocken Meister sich allmählich auszuwirken be-
ginnt“.
Wer die hier abgebildeten, im Besitz eines
schlesischen Großgrundbesitzers befindlichen
Gemälde Plazers, deren Existenz mir nur
durch einen glücklichen Zufall bekannt wurde,
gekleidet sind. Verliebte Finger tasten Run-
dungen ab, die es heute nicht mehr gibt. Ge-
nüsse des Gaumens, edle Früchte und er-
lesene Leckerbissen häufen sich zu strotzen-
den Stilleben. Blumen, die stummen Beglei-
ter froher Feste, lachen uns aus gleißenden
Kostbarkeiten entgegen. Der Künstler schwelgt
in der Anhäufung schmückenden Beiwerks.
Bunte Teppiche bedecken die Tische. Stoff-
draperien spannen sich über hohen Hallen,
hinter denen sich weite Parks, liebliche
Landschaften dehnen. Aus grotesken Stein-
figuren rauschen Quellen, Fontänen sprühen
kühlendes Wasser, exotische Vögel wippen
auf den Ästen dunkler Wunderbäume. In den
Rüstungen der Krieger glitzert es hell, Fahnen
flattern, Federn nicken von den Baretts modi-
scher Elegants. Kostbarer Schmuck bedeckt
Hals und Haar preziöser Frauengestalten,
deren weißgepuderte Gesichter nur auf den
Wangen ein wenig Rouge aufgelegt erhalten
haben. An den Wänden Bilder, wie in einer
Ausstellung, eins neben dem anderen. Minia-
turhaft klein, jedes erinnert flüchtig an irgend-
ein berühmtes Original. Diese „Gemalten
Galerien“ waren schon bei den verschiedenen
Mitgliedern der Künstlerfamilie Franken und
Jan Breughel beliebt. Hier liegen die Quellen,
aus denen Plazers Kunst gespeist wird. Dazu
kommen freilich noch andere Einflüsse.
Neben den flämischen und holländischen Vor-
bildern haben französische Meister, vor allem
A. Coypel, richtunggebend eingewirkt. Große
Tapisserien nach ihm und seiner Schule be-
fanden sich im Besitz des Wiener Adels. Ihre
Farbigkeit ist das reinste Feuerwerk für die
Augen. Überhaupt kann man behaupten, Pla-
zer habe die Werke der Großmalerei wie
durch ein Verkleinerungsglas hindurch auf
seine Kupfertäfelchen zu projizieren versucht.
Wiens Akademie, die zu Beginn des
18. Jahrhunderts unter einem französierten
Niederländer, Jakob van Schuppen, die Tore
wieder geöffnet hatte, nachdem sie vorüber-
gehend geschlossen worden waren, zog damals
alle jungen Maler magnetisch an. Im Jahre
1728 ist der 24jährige Künstler in den Akten
des Instituts erwähnt. In St. Michael, Gern.
Eppan, in den Tiroler Bergen, erblickte er
als zweiter Sohn des Malers Johann Victor
Plazer das Licht der Welt. Tirolerische Derb-
heit ist bei aller mondänen Eleganz der Bilder
der leise Unterton, Plazer kann auch in der
parfümierten Luft der Großstadt seine Her-
kunft nicht verleugnen. Wie mag er diese
fremde Welt bestaunt haben! Wiens Frauen
waren nach dem. Urteil von Zeitgenossen „pa-
riserischer als die Pariserinnen“. Er hat sie
in ihrem, ihnen eigenen Charme und ihrer ver-
führerischen Grazie im Bilde festgehalten. So-
mit haben seine Werke auch kulturhistorischen
Wert. Sie geben Einblick in die Salons vor-
nehmer Herrschaften, die epikuräisch das Le-
ben genießen.
Besonders wichtig für den Künstler und
seine Entwicklung scheint seine Bekanntschaft
mit dem Breslauer Ratsherrn Albrecht von
Sebisch, der damals in Wien ein hohes Amt
bekleidete, gewesen zu sein. Dieser weit-
gereiste Mann, ein „Graf Schack des 18. Jahr-
hunderts“, muß Gefallen an den Bildern Pla-
zers gefunden haben. Er begann, neben an-
deren Kostbarkeiten, auch Bilder von ihm zu
sammeln. Als er nach Schlesien zurückkehrte,
nahm er sie mit. Durch Vermächtnis gelang-
ten sie in den Besitz der Stadt. Mit anderen
Bildern der ehemaligen Galerie Sebisch bilden
sie den Grundstock des heutigen Museums.
Alle behandeln dasselbe Thema, die Freuden
gesellschaftlichen Lebens. Auch die neuent-
(Fortsetzung auf Seite 7)
DIE WELTKUNST
3
Schicksal verstoßen“ 7000 M, also etwa 55 000
belg. Franken angelegt wurden.
Kopenhagen erlebte mit der Auflösung
der Gemäldegalerie Graf Moltke durch
Winkel & Magnussen am 1./2. Juni einen
dem Wert des Objekts entsprechenden Auk-
tionserfolg: die Landschaft von Hobbema
brachte 107 000 kr., der Rubens 69 000 kr., drei
Wasserfall-Landschaften von Jacob Ruisdael
zusammen 83 000 kr., wenige Tage später bei
der Versteigerung der Sammlung Rosenorn-
Lehn eine musikalische Szene von Lancret etwa
22 000 kr.
Neues über
Östliche Kunst
in russischen Museen
Von
Dr. Alfred Salmony
VI*)
Kutais
Die nach Südwesten abfallenden Gebirgs-
ketten des Kaukasus bilden ein kaum min-
der altes Kulturgebiet als die Paßhöhen des
Nordens. Das Tal des Rion ist seit langem
^egen seiner ausgedehnten Gräberfelder be-
kannt. Kutais, die einstige Hauptstadt Imere-
tiens, birgt die lokalen Altertümer. Der Fall
dieses Museums ist bezeichnend, man kennt
sein Material nicht und braucht es doch unbe-
dingt, um die kaukasischen Altertümer richtig
einordnen zu können. Leider konnte ich dort
keine Aufnahmen machen oder erhalten und
muß den Behörden schon für die Erlaubnis
der Besichtigung sehr dankbar sein. Die
Schwierigkeiten beim Besuch der Sammlung
Von Kutais wie ihre Behebung seien hier als
ein ungewöhnlicher Beitrag zur russischen
Museumsgeschichte vermerkt.
Das Gebäude befindet sich im Schulkom-
plex der Stadt. Als ich dort ankam, bestätigte
sich ein bereits in Tiflis verbreitetes Gerücht:
das Museum war geschlossen, weil es
auf eine für den Fremden uninteressante und
rätselhafte Weise mit Gegenrevolution in Ver-
bindung gestanden haben sollte. Der Schul-
leiter stellte mir eine Dolmetscherin zur Ver-
fügung, um mit den zuständigen Behörden ver-
handeln zu können. Nicht ohne Mühe bewog
ich die brave Frau dazu, mit mir bis zum
Höchstkommandierenden der GPU, der staat-
lichen Polizei, vorzudringen. Sie hatte offen-
bar ein Ungeheuer erwartet und freute sich
über den sympathischen, in Kleidung und Auf-
treten gleich gepflegten Offizier nicht weniger
als der Fremde, der schließlich für sein selt-
sames Verlangen kein anderes Ausweismittel
*) Vergl. I. Leningrad, in Nr. 12, II. Moskau in
Nr. 30, III. Rostow am Don in Nr. 33, IV. Wladikaw-
kas in Nr. 34, V. Tiflis in Nr. 51/52, Jg. V der „Welt-
kunst“.
hatte als sein brennendes Interesse für die
Altertümer des Landes. Das Museum war
aber nun einmal versiegelt. Um das Siegel zu
lösen, bedurfte es einer ganzen Anzahl von
Personen. Nicht ohne Ironie wurde mir ver-
sichert, daß die Kunde von dem bedenklichen
Ruf der GPU im kapitalistischen Ausland bis
des GPU-Gebäudes zu benutzen, Gebrauch
gemacht, aber die Zeit bis zur Abfahrt des
nächsten Zuges reichte gerade, um das so
sorgfältig gehütete Museum zu studieren.
In der geschichtlichen Anordnung ist es
eines der besten. Es besitzt männliche Figu-
ren aus Bronze von ungewöhnlicher Größe
Brüsseler Wandteppich um 1500
A flemisli panel of tapestry, Brussels, about 1500
270 :230 cm
Versteigerung — Vente — Sale: Christie, Manson & Woods, London, 11. Juni 1931 : £ 17850
Kutais gedrungen sei, man wolle mir aber
zeigen, wie sie einen fremden Wissenschaftler
behandle. Ein Fuhrwerk holte in dem strö-
menden Regen die zur Amtshandlung nötigen
Leute zusammen, der abgesetzte alte und der
neuernannte junge Museumsleiter gesellten
sich hinzu, und meine mühselige Fahrt war
nicht mehr vergebens. Gerne hätte ich noch
von der Erlaubnis, die blitzsaubere Kantine
und seltener Schönheit der Patina, Denkmäler,
die deutlich als Vorbilder der fast modernen
volkstümlichen Arbeiten zu erkennen sind, und
die selbst wohl von hettitischer Plastik ab-
geleitet werden müssen. Die Reihe der vier-
eckigen Gürtelschnallen übertrifft an Vielfalt
wie an künstlerischer Bedeutung den Bestand
von Tiflis.
Das interessanteste Stück des Museums
dürfte eine reliefierte V a s e aus grauem Ton
mit dichten Blattranken und Tieren sein, der
Typus zeigt eine interessante Abwandlung
spätpersischer Motive und läßt sich meines
Wissens nur noch in Nowocherkassk belegen.
Einige frühchristliche Treibarbeiten können
sich neben denen der Hauptstadt wohl sehen
lassen, während persisch beeinflußte Stäbe
mit bronzetauschierten Teufelsköpfen wieder
zu dem einzigartigen Besitz des Museums ge-
hören.
Die Stichprobe der Besichtigung ließ sich
leider nur in diesem einen Provinzmuseum
machen. Sie genügte, um den Besuch aller
(und es gibt deren sicher mehr als ein Dutzend)
wertvoll erscheinen zu lassen. Örtliche, Funde
sind nach der Revolution immer in das
nächste, oft kleine Museum gewandert und in
den Hauptstädten häufig gar nicht bekannt
geworden. Die sogar in dem erwähnten be-
sonders schwierigen Falle unbegrenzte Hilfs-
bereitschaft der Behörden möge einem Nach-
folger den Mut geben, die Schätze von Kutais
wie der anderen Museen im westlichen und
südlichen Kaukasus der unverdienten Ver-
gessenheit zu entreißen. Erst wenn man auch
dieses Material kennt, kann man sich an die
Geschichte der Kunst in dem für die Kenntnis
des Ostens wie des Westens gleich wichtigen
Gebiet wagen.
•
Berichtigung.
Bei der Beschriftung der Abbildungen des Auf-
satzes „Neues über östliche Kunst in
russischen Museen: V. Tiflis“ von Dr.
Alfred S a 1 m o n y („Weltkunst“ Nr. 51/52) haben
sich durch ein technisches Versehen Unstimmigkeiten
ergeben. Die Unterschrift unter dem Kessel (Seite 4)
gehört unter die Stangenbekrönung Seite 3, Spalte 4.
Dafür muß die Abbildung Seite 4. die einen der fol-
genden Aufsätze über Odessa illustriert, folgende
Unterschrift tragen: Deckel gefäß. Bronze,
H. 31 cm Fundort: K a 1 m i u s (Don-Ge-
biet). Anfang des 1. .Jahrtausends
n. C h r. Archäologisches Museum
Odessa.
Wir bitten, den Irrtum in dieser Weise richtig-
zustellen.
Gustave Dore
Zum 100. Geburtstag.
Am 6. Januar 1832 wurde in Straßburg
Gustave Dore geboren. Wir haben es nicht mit
seinen Gemälden und fürchterlichen Skulpturen
zu tun, in denen er dem Ungeist der Gründer-
jahre genug getan hat, und von deren Zeit-
bedingtheit man sich in der Dore-Gallery zu
London, New Bondstreet, überzeugen kann. In
Frankreich fiel die Gründerzeit ja etwas früher
als bei uns, mit der Regierung Napoleons III.
zusammen, und der Elsässer Dore wurde einer
ihrer prominentesten Vertreter auf dem Gebiet
der Publikationskunst. Glücklicherweise sind
seine Hervorbringungen dieser Art, die bis zu
schauderhaften Verherrlichungen des Chauvi-
nismus von 1870 gehen, gänzlich vergessen und
vergeben. Was von Dore übrig geblieben ist,
konzentriert sich in einem Dutzend illustrierter
Bücher der 1850er Jahre und den dazugehörigen
Handzeichnungen. Seine völkische Stellung
„zwischen den Rassen“ charakterisieren die
Extravaganzen nach der Seite der Gloire und
Johann Georg Plazer
(1704-1761)
Ein Beitrag zur Geschichte des
deutschen Gese11schaftsbi 1 des
Von
Dr. Gotthard Agath
Das 18. Jahrhundert ist der letzte, große
Schönheitsrausch der künstlerischen Kultui'
des Abendlandes. In den weiten Räumen
prunkvoller Schlösser und Kirchen feiert
barocke Großmalerei ihre herrlichsten
Triumphe. Koloristisch-malerisches Empfinden
leitet die ausführenden Künstler bei ihrer Ar-
beit. Nicht das einzelne wird betont. Zu
optischer Einheit verschmelzen Form und
Farbe. Das schwebt und schwingt. Einer
übersinnlichen Erscheinung gleich wirken diese
Kompositionen. Über Figuren in gewagtesten
Verkürzungen hinweg schweift das Auge in
unwirkliche Fernen, genießt die zarten, atmo-
sphärischen Töne, das graziöse Spiel leichter,
schleierhafter Gewänder. Feierlicher Pomp,
pathetische Geste vervollständigen den Ein-
druck einer raffiniert-dekorativen Kunst.
Es hat lange gedauert, bis sie die Würdi-
gung fand, die sie verdient. Wir Heutigen
erst sehen die starken Kräfte, die hinter jenen
großartigen Werken stehen, in richtigem
Lichte. Man beginnt sich für die phantasie-
begabten Künstler jener Zeit zu interessieren.
Namen, früher gänzlich unbekannt, haben
heute schon einen gewissen Klang. Als man
nach und nach daran ging, Altarbilder und
Profangemälde mit liebevollem Verständnis
näher zu betrachten und ihre große Zahl zu
sichten, tauchten wieder neue Künstler aus
dem bisher unerforschten Dunkel auf.
Es ist das Verdienst der Darmstädter Jahr-
hundert-Ausstellung des Jahres 1914, daß sie
das in Schlössern und Museumsdepots
schlummernde Kunstgut zum ersten Male in
einer alle Gebiete der Malerei des 18. Jahr-
hunderts umfassenden Schau dem großen
Publikum zugänglich machte. Angeregt durch
die Meisterschaft mancher Werke, stöberte
man weiter. Wieviel verbarg sich noch an
Stellen, die sich der Kenntnis und Besichti-
gung entzogen! Es wurde daher immer leb-
haft begrüßt, wenn neue Funde das Vorhan-
dene ergänzten und die Kunstwissenschaft be-
reicherten.
So wird es gewißlich alle Freunde barocker
Malerei erfreuen, zu erfahren, daß ich un-
längst einer Anzahl bisher unbekannter Bilder
des Wiener Malers Johann Georg Plazer
(1704—1761) auf die Spur gekommen bin. In
einer Dissertation hatte ich 1923 den Künstler
eingehend gewürdigt und konnte ihn auf
Grund des von ihm besonders gepflegten
Stoffgebietes einen „Gesellschaftsmaler“ nen-
nen. Da er der erste war, der in Wien Gesell-
schaftsszenen in niederländisch-französischem
Geschmack, doch mit individueller Note, in
Mode brachte, kann er sogar als Schöpfer des
Wiener Gesellschaftsbildes gelten.
Wiener Museen sowie öffentliche und pri-
vate Galerien Breslaus bergen Werke seiner
Hand, kleine, bunte, spitzpinselig bis ins feinste
betrachtet, wird das obige Urteil über den
Künstler unterschreiben müssen.
In diesen Malereien tobt sich das aus-
schweifend zu nennende Temperament eines
sinnenfrohen Lebensgenießers aus. Die Vita-
lität des barocken Wien spiegelt sich in ihnen.
Prunk und Pracht, Musik und Tanz haben
diese Menschen der Barockzeit ja besonders
geliebt. Diese Leute haben zu leben verstan-
den! Das Weinglas in der Hand haltend,
flirten vornehme Kavaliere mit holden Frauen,
deren Körper in bauschige Seidengewänder
Detail ausgeführte Kupfertafeln. Die Museen
von Graz, Prag, Dresden, Kassel und anderer
Städte haben seinen Darstellungen rauschender
Feste, Bankette, Tanzszenen oder Begeben-
heiten aus Sage und Geschichte einen ehren-
vollen Platz eingeräumt.
Als im Frühjahr 1929 die ehemaligen Samm-
lungen des russischen Kaiserhauses zur Ver-
steigerung gelangten, waren sechs mir auf
Grund alter Kataloge und anderer Hinweise
längst bekannte Bilder Plazers zum Vorschein
gekommen. Privatsammler erwarben sie zu
Preisen, die deutlich bezeugten, daß, wie ein
Kunstberichterstatter bemerkte, „das Ver-
ständnis für diesen höchst merkwürdigen ba-
rocken Meister sich allmählich auszuwirken be-
ginnt“.
Wer die hier abgebildeten, im Besitz eines
schlesischen Großgrundbesitzers befindlichen
Gemälde Plazers, deren Existenz mir nur
durch einen glücklichen Zufall bekannt wurde,
gekleidet sind. Verliebte Finger tasten Run-
dungen ab, die es heute nicht mehr gibt. Ge-
nüsse des Gaumens, edle Früchte und er-
lesene Leckerbissen häufen sich zu strotzen-
den Stilleben. Blumen, die stummen Beglei-
ter froher Feste, lachen uns aus gleißenden
Kostbarkeiten entgegen. Der Künstler schwelgt
in der Anhäufung schmückenden Beiwerks.
Bunte Teppiche bedecken die Tische. Stoff-
draperien spannen sich über hohen Hallen,
hinter denen sich weite Parks, liebliche
Landschaften dehnen. Aus grotesken Stein-
figuren rauschen Quellen, Fontänen sprühen
kühlendes Wasser, exotische Vögel wippen
auf den Ästen dunkler Wunderbäume. In den
Rüstungen der Krieger glitzert es hell, Fahnen
flattern, Federn nicken von den Baretts modi-
scher Elegants. Kostbarer Schmuck bedeckt
Hals und Haar preziöser Frauengestalten,
deren weißgepuderte Gesichter nur auf den
Wangen ein wenig Rouge aufgelegt erhalten
haben. An den Wänden Bilder, wie in einer
Ausstellung, eins neben dem anderen. Minia-
turhaft klein, jedes erinnert flüchtig an irgend-
ein berühmtes Original. Diese „Gemalten
Galerien“ waren schon bei den verschiedenen
Mitgliedern der Künstlerfamilie Franken und
Jan Breughel beliebt. Hier liegen die Quellen,
aus denen Plazers Kunst gespeist wird. Dazu
kommen freilich noch andere Einflüsse.
Neben den flämischen und holländischen Vor-
bildern haben französische Meister, vor allem
A. Coypel, richtunggebend eingewirkt. Große
Tapisserien nach ihm und seiner Schule be-
fanden sich im Besitz des Wiener Adels. Ihre
Farbigkeit ist das reinste Feuerwerk für die
Augen. Überhaupt kann man behaupten, Pla-
zer habe die Werke der Großmalerei wie
durch ein Verkleinerungsglas hindurch auf
seine Kupfertäfelchen zu projizieren versucht.
Wiens Akademie, die zu Beginn des
18. Jahrhunderts unter einem französierten
Niederländer, Jakob van Schuppen, die Tore
wieder geöffnet hatte, nachdem sie vorüber-
gehend geschlossen worden waren, zog damals
alle jungen Maler magnetisch an. Im Jahre
1728 ist der 24jährige Künstler in den Akten
des Instituts erwähnt. In St. Michael, Gern.
Eppan, in den Tiroler Bergen, erblickte er
als zweiter Sohn des Malers Johann Victor
Plazer das Licht der Welt. Tirolerische Derb-
heit ist bei aller mondänen Eleganz der Bilder
der leise Unterton, Plazer kann auch in der
parfümierten Luft der Großstadt seine Her-
kunft nicht verleugnen. Wie mag er diese
fremde Welt bestaunt haben! Wiens Frauen
waren nach dem. Urteil von Zeitgenossen „pa-
riserischer als die Pariserinnen“. Er hat sie
in ihrem, ihnen eigenen Charme und ihrer ver-
führerischen Grazie im Bilde festgehalten. So-
mit haben seine Werke auch kulturhistorischen
Wert. Sie geben Einblick in die Salons vor-
nehmer Herrschaften, die epikuräisch das Le-
ben genießen.
Besonders wichtig für den Künstler und
seine Entwicklung scheint seine Bekanntschaft
mit dem Breslauer Ratsherrn Albrecht von
Sebisch, der damals in Wien ein hohes Amt
bekleidete, gewesen zu sein. Dieser weit-
gereiste Mann, ein „Graf Schack des 18. Jahr-
hunderts“, muß Gefallen an den Bildern Pla-
zers gefunden haben. Er begann, neben an-
deren Kostbarkeiten, auch Bilder von ihm zu
sammeln. Als er nach Schlesien zurückkehrte,
nahm er sie mit. Durch Vermächtnis gelang-
ten sie in den Besitz der Stadt. Mit anderen
Bildern der ehemaligen Galerie Sebisch bilden
sie den Grundstock des heutigen Museums.
Alle behandeln dasselbe Thema, die Freuden
gesellschaftlichen Lebens. Auch die neuent-
(Fortsetzung auf Seite 7)