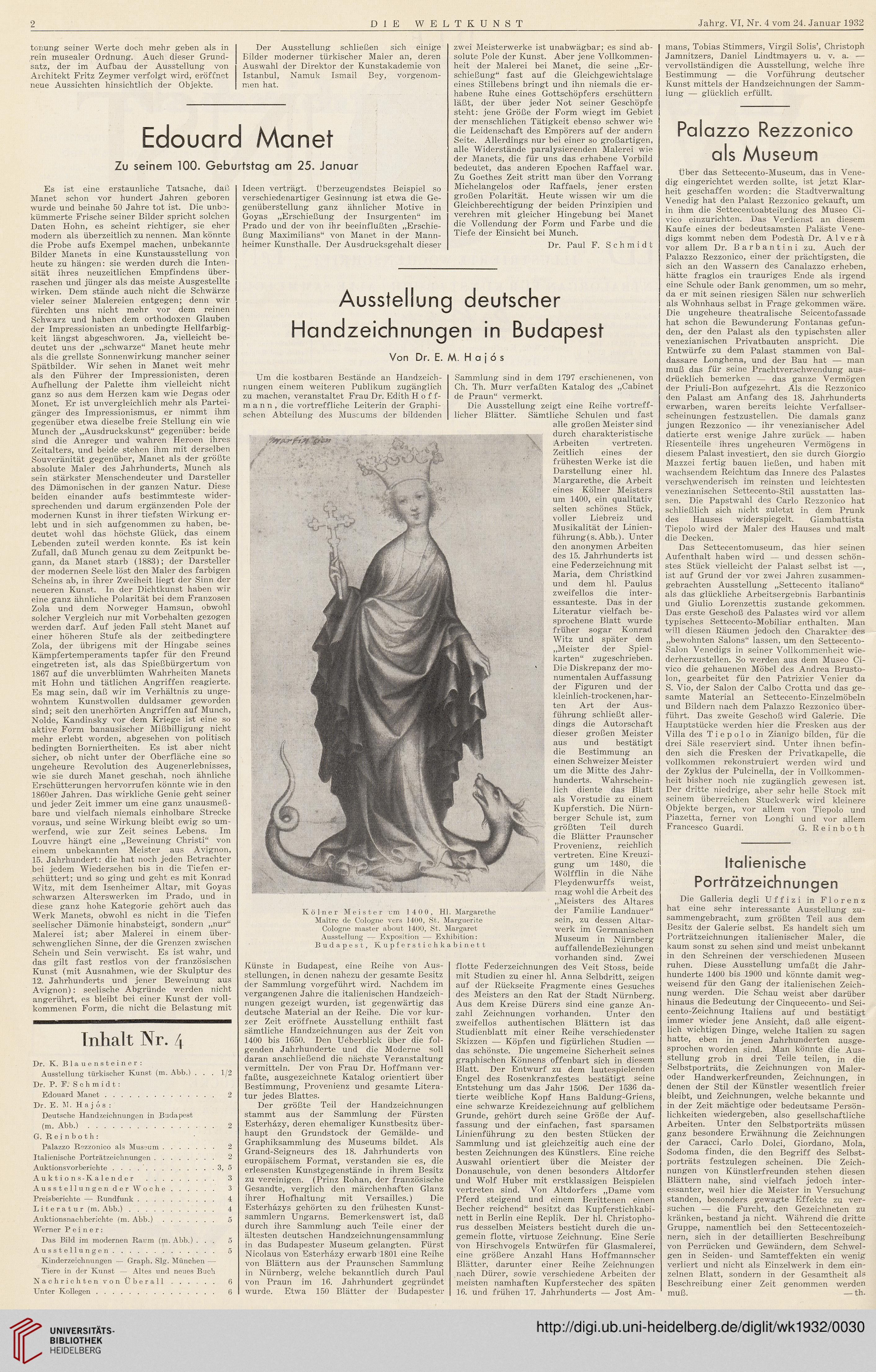2
DIE WELTKUNST
Jahrg. VI, Nr. 4 vom 24. Januar 1932
Edouard Manet
Zu seinem 100. Geburtstag am 25. Januar
im
Ausstellung deutscher
Handzeichnungen in Budapest
Von Dr. E.
Tnhalt Nr. 4
1/2
2
2
3,
6
6
5
5
Die vor
enthält
der Zeit
über die
kur-
fast
von
fol-
soll
und
Als
von
die
Um die kostbaren Bestände an Handzeich-
nungen einem weiteren Publikum zugänglich
zu machen, veranstaltet Frau Dr. Edith Hoff-
mann, die vortreffliche Leiterin der Graphi-
schen Abteilung des Museums der bildenden
2
2
5
3
3
4
4
5
tonung seiner Werte doch mehr geben als in
rein musealer Ordnung. Auch dieser Grund-
satz, der im Aufbau der Ausstellung von
Architekt Fritz Zeymer verfolgt wird, eröffnet
neue Aussichten hinsichtlich der Objekte.
Aber jene Vollkommen-
Manet, die seine „Er-
die Gleichgewichtslage
und ihn niemals die er-
Christkind
hl. Paulus
die inter-
Das in der
vertreten,
eines der
Der Ausstellung schließen sich einige
Bilder moderner türkischer Maler an, deren
Auswahl der Direktor der Kunstakademie von
Istanbul, Namuk Ismail Bey, vorgenom-
men hat.
zwei Meisterwerke ist unabwägbar; es sind ab-
solute Pole der Kunst.
heit der Malerei bei
schießung“ fast auf
eines Stillebens bringt
habene Ruhe eines Gottschöpfers erschüttern
läßt, der über jeder Not seiner Geschöpfe
steht: jene Größe der Form wiegt im Gebiet
der menschlichen Tätigkeit ebenso schwer wie
die Leidenschaft des Empörers auf der andern
Seite. Allerdings nur bei einer so großartigen,
alle Widerstände paralysierenden Malerei wie
der Manets, die für uns das erhabene Vorbild
bedeutet, das anderen Epochen Raffael war.
Zu Goethes Zeit stritt man über den Vorrang
Michelangelos oder Raffaels, jener ersten
großen Polarität. Heute wissen wir um die
Gleichberechtigung der beiden Prinzipien und
verehren mit gleicher Hingebung bei Manet
die Vollendung der Form und Farbe und die
Tiefe der Einsicht bei Munch.
Dr. Paul F. Schmidt
Es ist eine erstaunliche Tatsache, daß
Manet schon vor hundert Jahren geboren
wurde und beinahe 50 Jahre tot ist. Die unbe-
kümmerte Frische seiner Bilder spricht solchen
Daten Hohn, es scheint richtiger, sie eher
modern als überzeitlich zu nennen. Man könnte
die Probe aufs Exempel machen, unbekannte
Bilder Manets in eine Kunstausstellung von
heute zu hängen: sie werden durch die Inten-
sität ihres neuzeitlichen Empfindens über-
raschen und jünger als das meiste Ausgestellte
wirken. Dem stände auch nicht die Schwärze
vieler seiner Malereien entgegen; denn wir
fürchten uns nicht mehr vor dem reinen
Schwarz und haben dem orthodoxen Glauben
der Impressionisten an unbedingte Hellfarbig-
keit längst abgeschworen. Ja, vielleicht be-
deutet uns der „schwarze“ Manet heute mehr
als die grellste Sonnenwirkung mancher seiner
Spätbilder. Wir sehen in Manet weit mehr
als den Führer der Impressionisten, deren
Aufhellung der Palette ihm vielleicht nicht
ganz so aus dem Herzen kam wie Degas oder
Monet. Er ist unvergleichlich mehr als Partei-
gänger des Impressionismus, er nimmt ihm
gegenüber etwa dieselbe freie Stellung ein wie
Munch der „Ausdruckskunst“ gegenüber: beide
sind die Anreger und wahren Heroen ihres
Zeitalters, und beide stehen ihm mit derselben
Souveränität gegenüber, Manet als der größte
absolute Maler des Jahrhunderts, Munch als
sein stärkster Menschendeuter und Darsteller
des Dämonischen in der ganzen Natur. Diese
beiden einander aufs bestimmteste wider-
sprechenden und darum ergänzenden Pole der
modernen Kunst in ihrer tiefsten Wirkung er-
lebt und in sich aufgenommen zu haben, be-
deutet wohl das höchste Glück, das einem
Lebenden zuteil werden konnte. Es ist kein
Zufall, daß Munch genau zu dem Zeitpunkt be-
gann, da Manet starb (1883); der Darsteller
der modernen Seele löst den Maler des farbigen
Scheins ab, in ihrer Zweiheit liegt der Sinn der
neueren Kunst. In der Dichtkunst haben wir
eine ganz ähnliche Polarität bei dem Franzosen
Zola und dem Norweger Hamsun, obwohl
solcher Vergleich nur mit Vorbehalten gezogen
werden darf. Auf jeden Fall steht Manet auf
einer höheren Stufe als der zeitbedingtere
Zola, der übrigens mit der Hingabe seines
Kämpfertemperaments tapfer für den Freund
eingetreten ist, als das Spießbürgertum von
1867 auf die unverblümten Wahrheiten Manets
mit Hohn und tätlichen Angriffen reagierte.
Es mag sein, daß wir im Verhältnis zu unge-
wohntem Kunstwollen duldsamer geworden
sind; seit den unerhörten Angriffen auf Munch,
Nolde, Kandinsky vor dem Kriege ist eine so
aktive Form banausischer Mißbilligung nicht
mehr erlebt worden, abgesehen von politisch
bedingten Borniertheiten. Es ist aber nicht
sicher, ob nicht unter der Oberfläche eine so
ungeheure Revolution des Augenerlebnisses,
wie sie durch Manet geschah, noch ähnliche
Erschütterungen hervorrufen könnte wie in den
1860er Jahren. Das wirkliche Genie geht seiner
und jeder Zeit immer um eine ganz unausmeß-
bare und vielfach niemals einholbare Strecke
voraus, und seine Wirkung bleibt ewig so um-
werfend, wie zur Zeit seines Lebens. Im
Louvre hängt eine „Beweinung Christi“ von
einem unbekannten Meister aus Avignon,
15. Jahrhundert: die hat noch jeden Betrachter
bei jedem Wiedersehen bis in die Tiefen er-
schüttert; und so ging und geht es mit Konrad
Witz, mit dem Isenheimer Altar, mit Goyas
schwarzen Alterswerken im Prado, und in
diese ganz hohe Kategorie gehört auch das
Werk Manets, obwohl es nicht in die Tiefen
seelischer Dämonie hinabsteigt, sondern „nur“
Malerei ist; aber Malerei in einem über-
schwenglichen Sinne, der die Grenzen zwischen
Schein und Sein verwischt. Es ist wahr, und
das gilt fast restlos von der französischen
Kunst (mit Ausnahmen, wie der Skulptur des
12. Jahrhunderts und jener Beweinung aus
Avignon): seelische Abgründe werden nicht
angerührt, es bleibt bei einer Kunst der voll-
kommenen Form, die nicht die Belastung mit
Künste in Budapest, eine Reihe von Aus-
stellungen, in denen nahezu der gesamte Besitz
der Sammlung vorgeführt wird. Nachdem im
vergangenen Jahre die italienischen Handzeich-
nungen gezeigt wurden, ist gegenwärtig das
deutsche Material an der Reihe,
zer Zeit eröffnete Ausstellung
sämtliche Handzeichnungen aus
1400 bis 1650. Den Ueberblick
genden Jahrhunderte und die Moderne
daran anschließend die nächste Veranstaltung
vermitteln. Der von Frau Dr. Hoffmann ver-
faßte, ausgezeichnete Katalog orientiert über
Bestimmung, Provenienz und gesamte Litera-
tur jedes Blattes.
Der größte Teil der Handzeichnungen
stammt aus der Sammlung der Fürsten
Esterhazy, deren ehemaliger Kunstbesitz über-
haupt den Grundstock der Gemälde-
Graphiksammlung des Museums bildet.
Grand-Seigneurs des 18. Jahrhunderts
europäischem Format, verstanden sie es,
erlesensten Kunstgegenstände in ihrem Besitz
zu vereinigen. (Prinz Rohan, der französische
Gesandte, verglich den märchenhaften Glanz
ihrer Hofhaltung mit Versailles.) Die
Esterhazys gehörten zu den frühesten Kunst-
sammlern Ungarns. Bemerkenswert ist, daß
durch ihre Sammlung auch Teile einer der
ältesten deutschen Handzeichnungensammlung
in das Budapester Museum gelangten. Fürst
Nicolaus von Esterhazy erwarb 1801 eine Reihe
von Blättern aus der Praunschen Sammlung
in Nürnberg, welche bekanntlich durch Paul
von Praun im 16. Jahrhundert gegründet
wurde. Etwa 150 Blätter der Budapester
Kölner Meister cm 14 00, Hl. Margarethe
Maitre de Cologne vers 1400, St. Marguerite
Cologne master about 1400, St. Margaret
Ausstellung — Exposition — Exhibition:
Budapest, Kupferstich kabinett
Dr. K. Blauensteiner:
Ausstellung türkischer Kunst (m. Abb.) . . .
Dr. P. F. Schmidt:
Edouard Manet
Dr. E. M. Hajos:
Deutsche Handzeichnungen in Budapest
(m. Abb.)
G. R e i n b o t h :
Palazzo Rezzonico als Museum
Italienische Porträtzeichnungen
Auktionsvorberichte . . . . '
Auktions-Kalender .
A u s s t e 11 u n g e n d e r W o c h e
Preisberichte — Rundfunk
Literatur (m. Abb.)
Auktionsnachberichte (m. Abb.)
Werner P e i n e r:
Das Bild im modernen Raum (m. Abb.) . . .
Ausstellungen
Kinderzeichnungen — Graph. Slg. München —
Tiere in der Kunst — Altes und neues Buch
Nachrichten von Überall
Unter Kollegen
Ideen verträgt. Überzeugendstes Beispiel so
verschiedenartiger Gesinnung ist etwa die Ge-
genüberstellung ganz ähnlicher Motive in
Goyas „Erschießung der Insurgenten“
Prado und der von ihr beeinflußten „Erschie-
ßung Maximilians“ von Manet in der Mann-
heimer Kunsthalle. Der Ausdrucksgehalt dieser
Sammlung sind in dem 1797 erschienenen, von
Ch. Th. Murr verfaßten Katalog des „Cabinet
de Praun“ vermerkt.
Die Ausstellung zeigt eine Reihe vortreff-
licher Blätter. Sämtliche Schulen und fast
alle großen Meister sind
durch charakteristische
Arbeiten
Zeitlich
frühesten Werke ist die
Darstellung einer hl.
Margarethe, die Arbeit
eines Kölner Meisters
um 1400, ein qualitativ
selten schönes Stück,
voller Liebreiz und
Musikalität der Linien-
führung (s. Abb.). Unter
den anonymen Arbeiten
des 15. Jahrhunderts ist
eine Federzeichnung mit
Maria, dem
und dem
zweifellos
essanteste.
Literatur vielfach be-
sprochene Blatt wurde
früher sogar Konrad
Witz und später dem
„Meister der Spiel-
karten“ zugeschrieben.
Die Diskrepanz der mo-
numentalen Auffassung
der Figuren und der
kleinlich-trockenen, har-
ten Art der Aus-
führung schließt aller-
dings die Autorschaft
dieser großen Meister
aus und bestätigt
die Bestimmung an
einen Schweizer Meister
um die Mitte des Jahr-
hunderts. Wahrschein-
lich diente das Blatt
als Vorstudie zu einem
Kupferstich. Die Nürn-
berger Schule ist, zum
größten Teil durch
die Blätter Praunscher
Provenienz, reichlich
vertreten. Eine Kreuzi-
gung um 1480, die
Wölfflin in die Nähe
Pleydenwurffs weist,
mag wohl die Arbeit des
„Meisters des Altares
der Familie Landauer“
sein, zu dessen Altar-
werk im Germanischen
Museum in Nürnberg
auffa'llendeBeziehungen
vorhanden sind. Zwei
flotte Federzeichnungen des Veit Stoss, beide
mit Studien zu einer hl. Anna Selbdritt, zeigen
auf der Rückseite Fragmente eines Gesuches
des Meisters an den Rat der Stadt Nürnberg.
Aus dem Kreise Dürers sind eine ganze An-
zahl Zeichnungen vorhanden. Unter den
zweifellos authentischen Blättern ist das
Studienblatt mit einer Reihe verschiedenster
Skizzen — Köpfen und figürlichen Studien —
das schönste. Die ungemeine Sicherheit seines
graphischen Könnens offenbart sich in diesem
Blatt. Der Entwurf zu dem lautespielenden
Engel des Rosenkranzfestes bestätigt seine
Entstehung um das Jahr 1506. Der 1536 da-
tierte weibliche Kopf Hans Baldung-Griens,
eine schwarze Kreidezeichnung auf gelblichem
Grunde, gehört durch seine Größe der Auf-
fassung und der einfachen, fast sparsamen
Linienführung zu den besten Stücken der
Sammlung und ist gleichzeitig auch eine der
besten Zeichnungen des Künstlers. Eine reiche
Auswahl orientiert über die Meister der
Donauschule, von denen besonders Altdorfer
und Wolf Huber mit erstklassigen Beispielen
vertreten sind. Von Altdorfers „Dame vom
Pferd steigend und einem Berittenen einen
Becher reichend“ besitzt das Kupferstichkabi-
nett in Berlin eine Replik. Der hl. Christopho-
rus desselben Meisters besticht durch die un-
gemein flotte, virtuose Zeichnung. Eine Serie
von Hirschvogels Entwürfen für Glasmalerei,
eine größere Anzahl Hans Hoffmannscher
Blätter, darunter einer Reihe Zeichnungen
nach Dürer, sowie verschiedene Arbeiten der
meisten namhaften Kupferstecher des späten
16. und frühen 17. Jahrhunderts — Jost Am-
F \
SÄ \
■
mans, Tobias Stimmers, Virgil Solis’, Christoph
Jamnitzers, Daniel Lindtmayers u. v. a. —
vervollständigen die Ausstellung, welche ihre
Bestimmung — die Vorführung deutscher
Kunst mittels der Handzeichnungen der Samm-
lung — glücklich erfüllt.
Palazzo Rezzonico
als Museum
Über das Settecento-Museum, das in Vene-
dig eingerichtet werden sollte, ist jetzt Klar-
heit geschaffen worden: die Stadtverwaltung
Venedig hat den Palast Rezzonico gekauft, um
in ihm die Settecentoabteilung des Museo Ci-
vico einzurichten. Das Verdienst an diesem
Kaufe eines der bedeutsamsten Paläste Vene-
digs kommt neben dem Podesta Dr. A1 v e r ä
vor allem Dr. B a r b a n t i n i zu. Auch der
Palazzo Rezzonico, einer der prächtigsten, die
sich an den Wassern des Canalazzo erheben,
hätte fraglos ein trauriges Ende als irgend
eine Schule oder Bank genommen, um so mehr,
da er mit seinen riesigen Sälen nur schwerlich
als Wohnhaus selbst in Frage gekommen wäre.
Die ungeheure theatralische Seicentofassade
hat schon die Bewunderung Fontanas gefun-
den, der den Palast als den typischsten aller
venezianischen Privatbauten anspricht. Die
Entwürfe zu dem Palast stammen von Bal-
dassare Longhena, und der Bau hat — man
muß das für seine Prachtverschwendung aus-
drücklich bemerken — das ganze Vermögen
der Priuli-Bon aufgezehrt. Als die Rezzonico
den Palast am Anfang des 18. Jahrhunderts
erwarben, waren bereits leichte Verfallser-
scheinungen festzustellen. Die damals ganz
jungen Rezzonico — ihr venezianischer Adel
datierte erst wenige Jahre zurück — haben
Riesenteile ihres ungeheuren Vermögens: in
diesem Palast investiert, den sie durch Giorgio
Mazzei fertig bauen ließen, und haben mit
wachsendem Reichtum das Innere des Palastes
verschwenderisch im reinsten und leichtesten
venezianischen Settecento-Stil ausstatten las-
sen. Die Papstwahl des Carlo Rezzonico hat
schließlich sich nicht zuletzt in dem Prunk
des Hauses widerspiegelt. Giambattista
Tiepolo wird der Maler des Hauses und malt
die Decken.
Das Settecentomuseum, das hier seinen
Aufenthalt haben wird — und dessen schön-
stes Stück vielleicht der Palast selbst ist —,
ist auf Grund der vor zwei Jahren zusammen-
gebrachten Ausstellung „Settecento italiano“
als das glückliche Arbeitsergebnis Barbantinis
und Giulio Lorenzettis zustande gekommen.
Das erste Geschoß des Palastes wird vor allem
typisches Settecento-Mobiliar enthalten. Man
will diesen Räumen jedoch den Charakter des
„bewohnten Salons“ lassen, um den Settecento-
Salon Venedigs in seiner Vollkommenheit wie-
derherzustellen. So werden aus dem Museo Ci-
vico die gehauenen Möbel des Andrea Brusto-
lon, gearbeitet für den Patrizier Venier da
S. Vio, der Salon der Calbo Crotta und das ge-
samte Material an Settecento-Einzelmöbeln
und Bildern nach dem Palazzo Rezzonico über-
führt. Das zweite Geschoß wird Galerie. Die
Hauptstücke werden hier die Fresken aus der
Villa des Tiepolo in Zianigo bilden, für die
drei Säle reserviert sind. Unter ihnen befin-
den sich die Fresken der Privatkapelle, die
vollkommen rekonstruiert werden wird und
der Zyklus der Pulcinella, der in Vollkommen-
heit bisher noch nie zugänglich gewesen ist.
Der dritte niedrige, aber sehr helle Stock mit
seinem überreichen Stückwerk wird kleinere
Objekte bergen, vor allem von Tiepolo und
Piazetta, ferner von Longhi und vor allem
Francesco Guardi. G. R e i n b o t h
Italienische
Porträtzeichnungen
Die Galleria degli Uffizi in Florenz
hat eine sehr interessante Ausstellung zu-
sammengebracht, zum größten Teil aus dem
Besitz der Galerie selbst. Es handelt sich um
Porträtzeichnungen italienischer Maler, die
kaum sonst zu sehen sind und meist unbekannt
in den Schreinen der verschiedenen Museen
ruhen. Diese Ausstellung umfaßt die Jahr-
hunderte 1400 bis 1900 und könnte damit weg-
weisend für den Gang der italienischen Zeich-
nung werden. Die Schau weist aber darüber
hinaus die Bedeutung der Cinquecento- und Sei-
cento-Zeichnung Italiens auf und bestätigt
immer wieder jene Ansicht, daß alle eigent-
lich wichtigen Dinge, welche Italien zu sagen
hatte, eben in jenen Jahrhunderten ausge-
sprochen worden sind. Man könnte die Aus-
stellung grob in drei Teile teilen, in die
Selbstporträts, die Zeichnungen von Maler-
oder Handwerkerfreunden, Zeichnungen, in
denen der Stil der Künstler wesentlich freier
bleibt, und Zeichnungen, welche bekannte und
in der Zeit mächtige oder bedeutsame Persön-
lichkeiten wiedergeben, also gesellschaftliche
Arbeiten. Unter den Selbstporträts müssen
ganz besondere Erwähnung die Zeichnungen
der Caracci, Carlo Dolci, Giordano, Mola,
Sodoma finden, die den Begriff des Selbst-
porträts festzulegen scheinen. Die Zeich-
nungen von Künstlerfreunden stehen diesen
Blättern nahe, sind vielfach jedoch inter-
essanter, weil hier die Meister in Versuchung
standen, besonders gewagte Effekte zu ver-
suchen —• die Furcht, den Gezeichneten zu
kränken, bestand ja nicht. Während die dritte
Gruppe, namentlich bei den Settecentozeich-
nern, sich in der detaillierten Beschreibung
von Perrücken und Gewändern, dem Schwel-
gen in Seiden- und Samteffekten ein wenig
verliert und nicht als Einzelwerk in dem ein-
zelnen Blatt, sondern in der Gesamtheit als
Beschreibung einer Zeit genommen werden
muß. —th.
DIE WELTKUNST
Jahrg. VI, Nr. 4 vom 24. Januar 1932
Edouard Manet
Zu seinem 100. Geburtstag am 25. Januar
im
Ausstellung deutscher
Handzeichnungen in Budapest
Von Dr. E.
Tnhalt Nr. 4
1/2
2
2
3,
6
6
5
5
Die vor
enthält
der Zeit
über die
kur-
fast
von
fol-
soll
und
Als
von
die
Um die kostbaren Bestände an Handzeich-
nungen einem weiteren Publikum zugänglich
zu machen, veranstaltet Frau Dr. Edith Hoff-
mann, die vortreffliche Leiterin der Graphi-
schen Abteilung des Museums der bildenden
2
2
5
3
3
4
4
5
tonung seiner Werte doch mehr geben als in
rein musealer Ordnung. Auch dieser Grund-
satz, der im Aufbau der Ausstellung von
Architekt Fritz Zeymer verfolgt wird, eröffnet
neue Aussichten hinsichtlich der Objekte.
Aber jene Vollkommen-
Manet, die seine „Er-
die Gleichgewichtslage
und ihn niemals die er-
Christkind
hl. Paulus
die inter-
Das in der
vertreten,
eines der
Der Ausstellung schließen sich einige
Bilder moderner türkischer Maler an, deren
Auswahl der Direktor der Kunstakademie von
Istanbul, Namuk Ismail Bey, vorgenom-
men hat.
zwei Meisterwerke ist unabwägbar; es sind ab-
solute Pole der Kunst.
heit der Malerei bei
schießung“ fast auf
eines Stillebens bringt
habene Ruhe eines Gottschöpfers erschüttern
läßt, der über jeder Not seiner Geschöpfe
steht: jene Größe der Form wiegt im Gebiet
der menschlichen Tätigkeit ebenso schwer wie
die Leidenschaft des Empörers auf der andern
Seite. Allerdings nur bei einer so großartigen,
alle Widerstände paralysierenden Malerei wie
der Manets, die für uns das erhabene Vorbild
bedeutet, das anderen Epochen Raffael war.
Zu Goethes Zeit stritt man über den Vorrang
Michelangelos oder Raffaels, jener ersten
großen Polarität. Heute wissen wir um die
Gleichberechtigung der beiden Prinzipien und
verehren mit gleicher Hingebung bei Manet
die Vollendung der Form und Farbe und die
Tiefe der Einsicht bei Munch.
Dr. Paul F. Schmidt
Es ist eine erstaunliche Tatsache, daß
Manet schon vor hundert Jahren geboren
wurde und beinahe 50 Jahre tot ist. Die unbe-
kümmerte Frische seiner Bilder spricht solchen
Daten Hohn, es scheint richtiger, sie eher
modern als überzeitlich zu nennen. Man könnte
die Probe aufs Exempel machen, unbekannte
Bilder Manets in eine Kunstausstellung von
heute zu hängen: sie werden durch die Inten-
sität ihres neuzeitlichen Empfindens über-
raschen und jünger als das meiste Ausgestellte
wirken. Dem stände auch nicht die Schwärze
vieler seiner Malereien entgegen; denn wir
fürchten uns nicht mehr vor dem reinen
Schwarz und haben dem orthodoxen Glauben
der Impressionisten an unbedingte Hellfarbig-
keit längst abgeschworen. Ja, vielleicht be-
deutet uns der „schwarze“ Manet heute mehr
als die grellste Sonnenwirkung mancher seiner
Spätbilder. Wir sehen in Manet weit mehr
als den Führer der Impressionisten, deren
Aufhellung der Palette ihm vielleicht nicht
ganz so aus dem Herzen kam wie Degas oder
Monet. Er ist unvergleichlich mehr als Partei-
gänger des Impressionismus, er nimmt ihm
gegenüber etwa dieselbe freie Stellung ein wie
Munch der „Ausdruckskunst“ gegenüber: beide
sind die Anreger und wahren Heroen ihres
Zeitalters, und beide stehen ihm mit derselben
Souveränität gegenüber, Manet als der größte
absolute Maler des Jahrhunderts, Munch als
sein stärkster Menschendeuter und Darsteller
des Dämonischen in der ganzen Natur. Diese
beiden einander aufs bestimmteste wider-
sprechenden und darum ergänzenden Pole der
modernen Kunst in ihrer tiefsten Wirkung er-
lebt und in sich aufgenommen zu haben, be-
deutet wohl das höchste Glück, das einem
Lebenden zuteil werden konnte. Es ist kein
Zufall, daß Munch genau zu dem Zeitpunkt be-
gann, da Manet starb (1883); der Darsteller
der modernen Seele löst den Maler des farbigen
Scheins ab, in ihrer Zweiheit liegt der Sinn der
neueren Kunst. In der Dichtkunst haben wir
eine ganz ähnliche Polarität bei dem Franzosen
Zola und dem Norweger Hamsun, obwohl
solcher Vergleich nur mit Vorbehalten gezogen
werden darf. Auf jeden Fall steht Manet auf
einer höheren Stufe als der zeitbedingtere
Zola, der übrigens mit der Hingabe seines
Kämpfertemperaments tapfer für den Freund
eingetreten ist, als das Spießbürgertum von
1867 auf die unverblümten Wahrheiten Manets
mit Hohn und tätlichen Angriffen reagierte.
Es mag sein, daß wir im Verhältnis zu unge-
wohntem Kunstwollen duldsamer geworden
sind; seit den unerhörten Angriffen auf Munch,
Nolde, Kandinsky vor dem Kriege ist eine so
aktive Form banausischer Mißbilligung nicht
mehr erlebt worden, abgesehen von politisch
bedingten Borniertheiten. Es ist aber nicht
sicher, ob nicht unter der Oberfläche eine so
ungeheure Revolution des Augenerlebnisses,
wie sie durch Manet geschah, noch ähnliche
Erschütterungen hervorrufen könnte wie in den
1860er Jahren. Das wirkliche Genie geht seiner
und jeder Zeit immer um eine ganz unausmeß-
bare und vielfach niemals einholbare Strecke
voraus, und seine Wirkung bleibt ewig so um-
werfend, wie zur Zeit seines Lebens. Im
Louvre hängt eine „Beweinung Christi“ von
einem unbekannten Meister aus Avignon,
15. Jahrhundert: die hat noch jeden Betrachter
bei jedem Wiedersehen bis in die Tiefen er-
schüttert; und so ging und geht es mit Konrad
Witz, mit dem Isenheimer Altar, mit Goyas
schwarzen Alterswerken im Prado, und in
diese ganz hohe Kategorie gehört auch das
Werk Manets, obwohl es nicht in die Tiefen
seelischer Dämonie hinabsteigt, sondern „nur“
Malerei ist; aber Malerei in einem über-
schwenglichen Sinne, der die Grenzen zwischen
Schein und Sein verwischt. Es ist wahr, und
das gilt fast restlos von der französischen
Kunst (mit Ausnahmen, wie der Skulptur des
12. Jahrhunderts und jener Beweinung aus
Avignon): seelische Abgründe werden nicht
angerührt, es bleibt bei einer Kunst der voll-
kommenen Form, die nicht die Belastung mit
Künste in Budapest, eine Reihe von Aus-
stellungen, in denen nahezu der gesamte Besitz
der Sammlung vorgeführt wird. Nachdem im
vergangenen Jahre die italienischen Handzeich-
nungen gezeigt wurden, ist gegenwärtig das
deutsche Material an der Reihe,
zer Zeit eröffnete Ausstellung
sämtliche Handzeichnungen aus
1400 bis 1650. Den Ueberblick
genden Jahrhunderte und die Moderne
daran anschließend die nächste Veranstaltung
vermitteln. Der von Frau Dr. Hoffmann ver-
faßte, ausgezeichnete Katalog orientiert über
Bestimmung, Provenienz und gesamte Litera-
tur jedes Blattes.
Der größte Teil der Handzeichnungen
stammt aus der Sammlung der Fürsten
Esterhazy, deren ehemaliger Kunstbesitz über-
haupt den Grundstock der Gemälde-
Graphiksammlung des Museums bildet.
Grand-Seigneurs des 18. Jahrhunderts
europäischem Format, verstanden sie es,
erlesensten Kunstgegenstände in ihrem Besitz
zu vereinigen. (Prinz Rohan, der französische
Gesandte, verglich den märchenhaften Glanz
ihrer Hofhaltung mit Versailles.) Die
Esterhazys gehörten zu den frühesten Kunst-
sammlern Ungarns. Bemerkenswert ist, daß
durch ihre Sammlung auch Teile einer der
ältesten deutschen Handzeichnungensammlung
in das Budapester Museum gelangten. Fürst
Nicolaus von Esterhazy erwarb 1801 eine Reihe
von Blättern aus der Praunschen Sammlung
in Nürnberg, welche bekanntlich durch Paul
von Praun im 16. Jahrhundert gegründet
wurde. Etwa 150 Blätter der Budapester
Kölner Meister cm 14 00, Hl. Margarethe
Maitre de Cologne vers 1400, St. Marguerite
Cologne master about 1400, St. Margaret
Ausstellung — Exposition — Exhibition:
Budapest, Kupferstich kabinett
Dr. K. Blauensteiner:
Ausstellung türkischer Kunst (m. Abb.) . . .
Dr. P. F. Schmidt:
Edouard Manet
Dr. E. M. Hajos:
Deutsche Handzeichnungen in Budapest
(m. Abb.)
G. R e i n b o t h :
Palazzo Rezzonico als Museum
Italienische Porträtzeichnungen
Auktionsvorberichte . . . . '
Auktions-Kalender .
A u s s t e 11 u n g e n d e r W o c h e
Preisberichte — Rundfunk
Literatur (m. Abb.)
Auktionsnachberichte (m. Abb.)
Werner P e i n e r:
Das Bild im modernen Raum (m. Abb.) . . .
Ausstellungen
Kinderzeichnungen — Graph. Slg. München —
Tiere in der Kunst — Altes und neues Buch
Nachrichten von Überall
Unter Kollegen
Ideen verträgt. Überzeugendstes Beispiel so
verschiedenartiger Gesinnung ist etwa die Ge-
genüberstellung ganz ähnlicher Motive in
Goyas „Erschießung der Insurgenten“
Prado und der von ihr beeinflußten „Erschie-
ßung Maximilians“ von Manet in der Mann-
heimer Kunsthalle. Der Ausdrucksgehalt dieser
Sammlung sind in dem 1797 erschienenen, von
Ch. Th. Murr verfaßten Katalog des „Cabinet
de Praun“ vermerkt.
Die Ausstellung zeigt eine Reihe vortreff-
licher Blätter. Sämtliche Schulen und fast
alle großen Meister sind
durch charakteristische
Arbeiten
Zeitlich
frühesten Werke ist die
Darstellung einer hl.
Margarethe, die Arbeit
eines Kölner Meisters
um 1400, ein qualitativ
selten schönes Stück,
voller Liebreiz und
Musikalität der Linien-
führung (s. Abb.). Unter
den anonymen Arbeiten
des 15. Jahrhunderts ist
eine Federzeichnung mit
Maria, dem
und dem
zweifellos
essanteste.
Literatur vielfach be-
sprochene Blatt wurde
früher sogar Konrad
Witz und später dem
„Meister der Spiel-
karten“ zugeschrieben.
Die Diskrepanz der mo-
numentalen Auffassung
der Figuren und der
kleinlich-trockenen, har-
ten Art der Aus-
führung schließt aller-
dings die Autorschaft
dieser großen Meister
aus und bestätigt
die Bestimmung an
einen Schweizer Meister
um die Mitte des Jahr-
hunderts. Wahrschein-
lich diente das Blatt
als Vorstudie zu einem
Kupferstich. Die Nürn-
berger Schule ist, zum
größten Teil durch
die Blätter Praunscher
Provenienz, reichlich
vertreten. Eine Kreuzi-
gung um 1480, die
Wölfflin in die Nähe
Pleydenwurffs weist,
mag wohl die Arbeit des
„Meisters des Altares
der Familie Landauer“
sein, zu dessen Altar-
werk im Germanischen
Museum in Nürnberg
auffa'llendeBeziehungen
vorhanden sind. Zwei
flotte Federzeichnungen des Veit Stoss, beide
mit Studien zu einer hl. Anna Selbdritt, zeigen
auf der Rückseite Fragmente eines Gesuches
des Meisters an den Rat der Stadt Nürnberg.
Aus dem Kreise Dürers sind eine ganze An-
zahl Zeichnungen vorhanden. Unter den
zweifellos authentischen Blättern ist das
Studienblatt mit einer Reihe verschiedenster
Skizzen — Köpfen und figürlichen Studien —
das schönste. Die ungemeine Sicherheit seines
graphischen Könnens offenbart sich in diesem
Blatt. Der Entwurf zu dem lautespielenden
Engel des Rosenkranzfestes bestätigt seine
Entstehung um das Jahr 1506. Der 1536 da-
tierte weibliche Kopf Hans Baldung-Griens,
eine schwarze Kreidezeichnung auf gelblichem
Grunde, gehört durch seine Größe der Auf-
fassung und der einfachen, fast sparsamen
Linienführung zu den besten Stücken der
Sammlung und ist gleichzeitig auch eine der
besten Zeichnungen des Künstlers. Eine reiche
Auswahl orientiert über die Meister der
Donauschule, von denen besonders Altdorfer
und Wolf Huber mit erstklassigen Beispielen
vertreten sind. Von Altdorfers „Dame vom
Pferd steigend und einem Berittenen einen
Becher reichend“ besitzt das Kupferstichkabi-
nett in Berlin eine Replik. Der hl. Christopho-
rus desselben Meisters besticht durch die un-
gemein flotte, virtuose Zeichnung. Eine Serie
von Hirschvogels Entwürfen für Glasmalerei,
eine größere Anzahl Hans Hoffmannscher
Blätter, darunter einer Reihe Zeichnungen
nach Dürer, sowie verschiedene Arbeiten der
meisten namhaften Kupferstecher des späten
16. und frühen 17. Jahrhunderts — Jost Am-
F \
SÄ \
■
mans, Tobias Stimmers, Virgil Solis’, Christoph
Jamnitzers, Daniel Lindtmayers u. v. a. —
vervollständigen die Ausstellung, welche ihre
Bestimmung — die Vorführung deutscher
Kunst mittels der Handzeichnungen der Samm-
lung — glücklich erfüllt.
Palazzo Rezzonico
als Museum
Über das Settecento-Museum, das in Vene-
dig eingerichtet werden sollte, ist jetzt Klar-
heit geschaffen worden: die Stadtverwaltung
Venedig hat den Palast Rezzonico gekauft, um
in ihm die Settecentoabteilung des Museo Ci-
vico einzurichten. Das Verdienst an diesem
Kaufe eines der bedeutsamsten Paläste Vene-
digs kommt neben dem Podesta Dr. A1 v e r ä
vor allem Dr. B a r b a n t i n i zu. Auch der
Palazzo Rezzonico, einer der prächtigsten, die
sich an den Wassern des Canalazzo erheben,
hätte fraglos ein trauriges Ende als irgend
eine Schule oder Bank genommen, um so mehr,
da er mit seinen riesigen Sälen nur schwerlich
als Wohnhaus selbst in Frage gekommen wäre.
Die ungeheure theatralische Seicentofassade
hat schon die Bewunderung Fontanas gefun-
den, der den Palast als den typischsten aller
venezianischen Privatbauten anspricht. Die
Entwürfe zu dem Palast stammen von Bal-
dassare Longhena, und der Bau hat — man
muß das für seine Prachtverschwendung aus-
drücklich bemerken — das ganze Vermögen
der Priuli-Bon aufgezehrt. Als die Rezzonico
den Palast am Anfang des 18. Jahrhunderts
erwarben, waren bereits leichte Verfallser-
scheinungen festzustellen. Die damals ganz
jungen Rezzonico — ihr venezianischer Adel
datierte erst wenige Jahre zurück — haben
Riesenteile ihres ungeheuren Vermögens: in
diesem Palast investiert, den sie durch Giorgio
Mazzei fertig bauen ließen, und haben mit
wachsendem Reichtum das Innere des Palastes
verschwenderisch im reinsten und leichtesten
venezianischen Settecento-Stil ausstatten las-
sen. Die Papstwahl des Carlo Rezzonico hat
schließlich sich nicht zuletzt in dem Prunk
des Hauses widerspiegelt. Giambattista
Tiepolo wird der Maler des Hauses und malt
die Decken.
Das Settecentomuseum, das hier seinen
Aufenthalt haben wird — und dessen schön-
stes Stück vielleicht der Palast selbst ist —,
ist auf Grund der vor zwei Jahren zusammen-
gebrachten Ausstellung „Settecento italiano“
als das glückliche Arbeitsergebnis Barbantinis
und Giulio Lorenzettis zustande gekommen.
Das erste Geschoß des Palastes wird vor allem
typisches Settecento-Mobiliar enthalten. Man
will diesen Räumen jedoch den Charakter des
„bewohnten Salons“ lassen, um den Settecento-
Salon Venedigs in seiner Vollkommenheit wie-
derherzustellen. So werden aus dem Museo Ci-
vico die gehauenen Möbel des Andrea Brusto-
lon, gearbeitet für den Patrizier Venier da
S. Vio, der Salon der Calbo Crotta und das ge-
samte Material an Settecento-Einzelmöbeln
und Bildern nach dem Palazzo Rezzonico über-
führt. Das zweite Geschoß wird Galerie. Die
Hauptstücke werden hier die Fresken aus der
Villa des Tiepolo in Zianigo bilden, für die
drei Säle reserviert sind. Unter ihnen befin-
den sich die Fresken der Privatkapelle, die
vollkommen rekonstruiert werden wird und
der Zyklus der Pulcinella, der in Vollkommen-
heit bisher noch nie zugänglich gewesen ist.
Der dritte niedrige, aber sehr helle Stock mit
seinem überreichen Stückwerk wird kleinere
Objekte bergen, vor allem von Tiepolo und
Piazetta, ferner von Longhi und vor allem
Francesco Guardi. G. R e i n b o t h
Italienische
Porträtzeichnungen
Die Galleria degli Uffizi in Florenz
hat eine sehr interessante Ausstellung zu-
sammengebracht, zum größten Teil aus dem
Besitz der Galerie selbst. Es handelt sich um
Porträtzeichnungen italienischer Maler, die
kaum sonst zu sehen sind und meist unbekannt
in den Schreinen der verschiedenen Museen
ruhen. Diese Ausstellung umfaßt die Jahr-
hunderte 1400 bis 1900 und könnte damit weg-
weisend für den Gang der italienischen Zeich-
nung werden. Die Schau weist aber darüber
hinaus die Bedeutung der Cinquecento- und Sei-
cento-Zeichnung Italiens auf und bestätigt
immer wieder jene Ansicht, daß alle eigent-
lich wichtigen Dinge, welche Italien zu sagen
hatte, eben in jenen Jahrhunderten ausge-
sprochen worden sind. Man könnte die Aus-
stellung grob in drei Teile teilen, in die
Selbstporträts, die Zeichnungen von Maler-
oder Handwerkerfreunden, Zeichnungen, in
denen der Stil der Künstler wesentlich freier
bleibt, und Zeichnungen, welche bekannte und
in der Zeit mächtige oder bedeutsame Persön-
lichkeiten wiedergeben, also gesellschaftliche
Arbeiten. Unter den Selbstporträts müssen
ganz besondere Erwähnung die Zeichnungen
der Caracci, Carlo Dolci, Giordano, Mola,
Sodoma finden, die den Begriff des Selbst-
porträts festzulegen scheinen. Die Zeich-
nungen von Künstlerfreunden stehen diesen
Blättern nahe, sind vielfach jedoch inter-
essanter, weil hier die Meister in Versuchung
standen, besonders gewagte Effekte zu ver-
suchen —• die Furcht, den Gezeichneten zu
kränken, bestand ja nicht. Während die dritte
Gruppe, namentlich bei den Settecentozeich-
nern, sich in der detaillierten Beschreibung
von Perrücken und Gewändern, dem Schwel-
gen in Seiden- und Samteffekten ein wenig
verliert und nicht als Einzelwerk in dem ein-
zelnen Blatt, sondern in der Gesamtheit als
Beschreibung einer Zeit genommen werden
muß. —th.