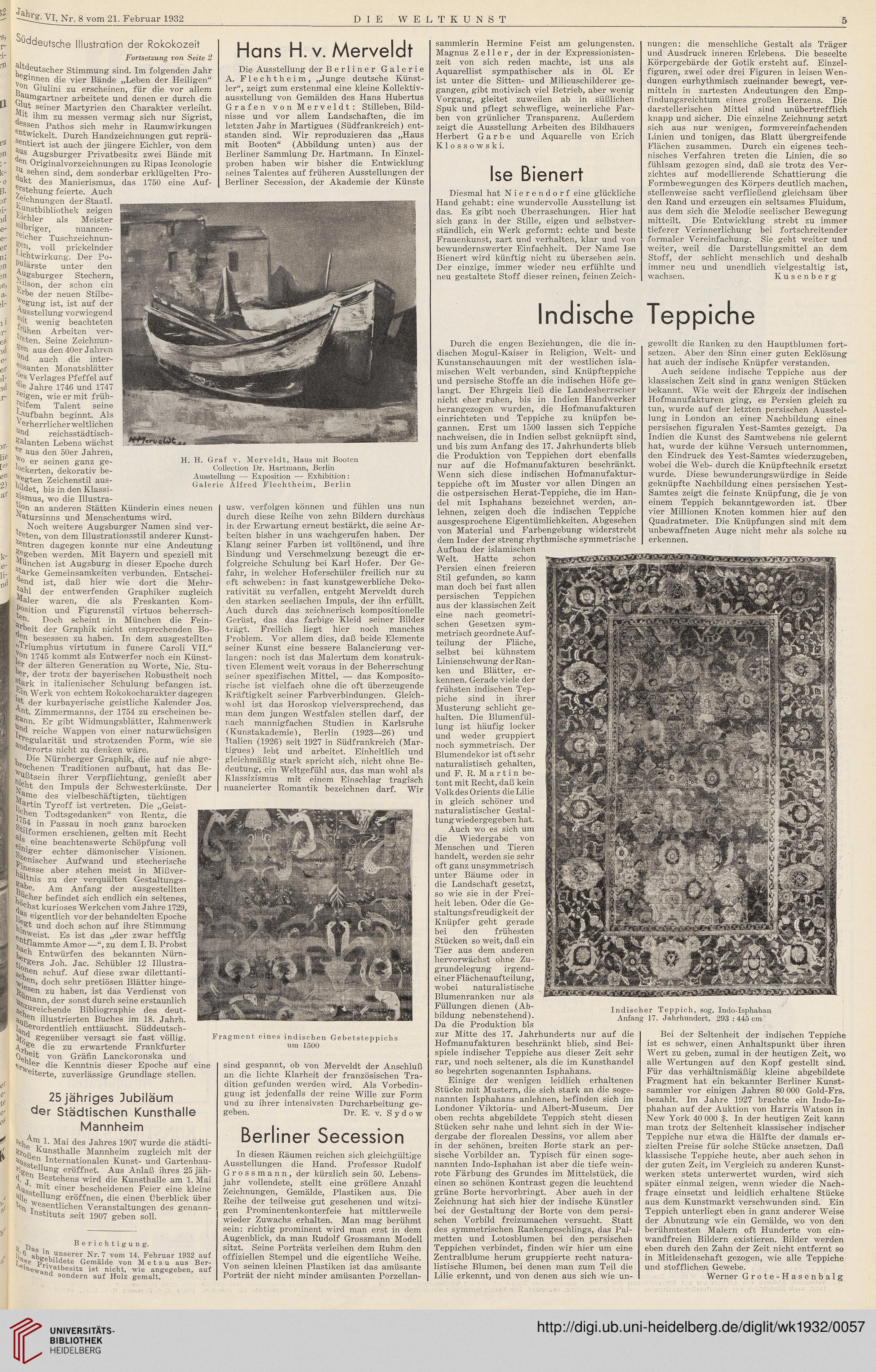DIE WELT KUNST
5
Nr. 8 vom 21. Februar 1932
Be-
aber
Der
sind gespannt, ob von Merveldt der Anschluß
an die lichte Klarheit der französischen Tra-
dition gefunden werden wird. Als Vorbedin-
gung ist jedenfalls der reine Wille zur Form
und zu ihrer intensivsten Durcharbeitung ge-
geben. Dr. E. v. S y d o w
H. H. Graf v. Merveldt, Haus mit Booten
Collection Dr. Hartmann, Berlin
Ausstellung — Exposition — Exhibition:
Galerie Alfred Flechtheim, Berlin
usw. verfolgen können und fühlen uns nun
durch diese Reihe von zehn Bildern durchaus
in der Erwartung erneut bestärkt, die seine Ar-
beiten bisher in uns wachgerufen haben. Der
Klang seiner Farben ist volltönend, und ihre
Bindung und Verschmelzung bezeugt die er-
folgreiche Schulung bei Karl Hofer. Der Ge-
fahr, in welcher Hoferschüler freilich nur zu
oft schweben: in fast kunstgewerbliche Deko-
rativität zu verfallen, entgeht Merveldt durch
den starken seelischen Impuls, der ihn erfüllt.
Auch durch das zeichnerisch kompositionelle
Gerüst, das das farbige Kleid seiner Bilder
trägt. Freilich liegt hier noch manches
Problem. Vor allem dies, daß beide Elemente
seiner Kunst eine bessere Balancierung ver-
langen: noch ist das Malertum dem konstruk-
tiven Element weit voraus in der Beherrschung
seiner spezifischen Mittel, —- das Komposito-
rische ist vielfach ohne die oft überzeugende
Kräftigkeit seiner Farbverbindungen. Gleich-
wohl ist das Horoskop vielversprechend, das
man dem jungen Westfalen stellen darf, der
nach mannigfachen Studien in Karlsruhe
(Kunstakademie), Berlin (1923—26) und
Italien (1926) seit 1927 in Südfrankreich (Mar-
tigues) lebt und arbeitet. Einheitlich und
gleichmäßig stark spricht sich, nicht ohne Be-
deutung, ein Weltgefühl aus, das man wohl als
Klassizismus mit einem Einschlag tragisch
nuancierter Romantik bezeichnen darf. Wir
Hans H. v. Merveldt
Die Ausstellung der Berliner Galerie
A. Flechtheim, „Junge deutsche Künst-
ler“, zeigt zum erstenmal eine kleine Kollektiv-
ausstellung von Gemälden des Hans Hubertus
Grafen von Merveldt: Stilleben, Bild-
nisse und vor allem Landschaften, die im
letzten Jahr in Martigues (Südfrankreich) ent-
standen sind. Wir reproduzieren das „Haus
mit Booten“ (Abbildung unten) aus der
Berliner Sammlung Dr. Hartmann. In Einzel-
proben haben wir bisher die Entwicklung
seines Talentes auf früheren Ausstellungen der
Berliner Secession, der Akademie der Künste
- - eine
'eiterte, zuverlässige Grundlage stellen.
Süddeutsche Illustration der Rokokozeit
Fortsetzung von Seite 2
^deutscher Stimmung sind. Im folgenden Jahr
Rinnen die vier Bände „Leben der Heiligen“
Giulini zu erscheinen, für die vor allem
aumgartner arbeitete und denen er durch die
lut seiner Martyrien den Charakter verleiht.
,llt ihm zu messen vermag sich nur Sigrist,
essen Pathos sich mehr in Raumwirkungen
"wickelt. Durch Handzeichnungen gut reprä-
entiert ist auch der jüngere Eichler, von dem
.Hs Augsburger Privatbesitz zwei Bände mit
en Originalvorzeichnungen zu Ripas Iconologie
sehen sind, dem sonderbar erklügelten Prö-
das 1750 eine Auf-
Berliner Secession
In diesen Räumen reichen sich gleichgültige
Ausstellungen die Hand. Professor Rudolf
Grossmann, der kürzlich sein 50. Lebens-
jahr vollendete, stellt eine größere Anzahl
Zeichnungen, Gemälde, Plastiken aus. Die
Reihe der teilweise gut gesehenen und witzi-
gen Prominentenkonterfeie hat mittlerweile
wieder Zuwachs erhalten. Man mag berühmt
sein: richtig prominent wird man erst in dem
Augenblick, da man Rudolf Grossmann Modell
sitzt. Seine Porträts verleihen dem Ruhm den
offiziellen Stempel und die eigentliche Weihe.
Von seinen kleinen Plastiken ist das amüsante
Porträt der nicht minder amüsanten Porzellan-
Fragment eines indischen Gebetsteppichs
um 1500
> ^iicll ö-llldj öUIlCl
ukt des Manierismus,
rstehung feierte. Auch
Dehnungen der Staatl.
,;Unstbibliothek zeigen
fehler als Meister
übriger, nuancen¬
weher Tuschzeichnun-
I?11, voll prickelnder-
. lchtwirkung. Der Po¬
larste unter den
^ügsburger Stechern,
JÜSon, der schon ein
•rbe der neuen Stilbe-
'JWgung ist, ist auf der
/■ksstellung vorwiegend
'M wenig beachteten
Mhen Arbeiten ver-
‘Men. Seine Zeichnun-
'Mi aus den 40er Jahren
""d auch die inter¬
essanten Monatsblätter
'“'s Verlages Pfeffel auf
We Jahre 1746 und 1747
Mgen, wie er mit früh¬
stem Talent seine
:-;<ufbahn beginnt. Als
’erher rlicher weltlichen
Md reichsstädtisch-
kalanten Lebens -wächst
aus den 50er Jahren,
f 0 er seinen ganz ge-
ackerten, dekorativ be¬
ugten Zeichenstil aus-
‘‘det, bis in den Klassi-
Mmus, wo die Illustra-
S an anderen Stätten Künderin eines neuen
'katursinns und Menschentums wird.
Noch weitere Augsburger Namen sind ver-
beten, von dem Illustrationsstil anderer Kunst-
zentren dagegen konnte nur eine Andeutung
gegeben werden. Mit Bayern und speziell mit
München ist Augsburg in dieser Epoche durch
barke Gemeinsamkeiten verbunden. Entschei-
dend ist, daß hier wie dort die Mehr-
Mil der entwerfenden Graphiker zugleich
“aler waren, die als Freskanten Kom-
position und Figurenstil virtuos beherrsch-
en. Doch scheint in München die Fein-
heit der Graphik nicht entsprechenden Bo-
den besessen zu haben. In dem ausgestellten
’Ariumphus virtutum in funere Caroli VII.“
,v°n 1745 kommt als Entwerfer noch ein Künst-
ler der älteren Generation zu Worte, Nie. Stu-
ber, der trotz der bayerischen Robustheit noch
>brk in italienischer Schulung befangen ist.
Mn Werk von echtem Rokokocharakter dagegen
bt der kurbayerische geistliche Kalender Jos.
^■ht. Zimmermanns, der 1754 zu erscheinen be-
|ann. Er gibt Widmungsblätter, Rahmenwerk
reiche Wappen von einer naturwüchsigen
Regularität und strotzenden Form, wie sie
hierorts nicht zu denken wäre.
Die Nürnberger Graphik, die auf nie abge-
"oehenen Traditionen aufbaut, hat das
jbßtsein ihrer Verpflichtung, genießt
jlcht den Impuls der Schwesterkünste.
i'Me des vielbeschäftigten, tüchtigen
i Mitin Tyroff ist vertreten. Die „Geist-
S:n Todtsgedanken“ von Rentz, die
in Passau in noch ganz barocken
'^formen erschienen, gelten mit Recht
eine beachtenswerte Schöpfung voll
l^higer echter dämonischer Visionen,
jonischer Aufwand und stecherische
j.Tesse aber stehen meist in Mißver-
JÜtnis zu der verquälten Gestaltungs¬
ide. Am Anfang der ausgestellten
jj.dher befindet sich endlich ein seltenes,
fl°chst kurioses Werkchen vom Jahre 1729,
eigentlich vor der behandelten Epoche
v?St und doch schon auf ihre Stimmung
"*eist. Es ist das „der zwar hefftlg
'-flammte Amor —“, zu dem I. B. Probst
k ch Entwürfen des bekannten Nürn-
Mers Joh. Jac. Schübler 12 Illustra-
w"eh schuf. Auf diese zwar dilettanti-
I1> doch sehr pretiösen Blätter hinge-
L.6sen zu haben, ist das Verdienst von
'hann, der sonst durch seine erstaunlich
reichende Bibliographie des deut-
inp1 illustrierten Buches im 18. Jahrh.
L ^ordentlich enttäuscht. Süddeutsch-
lijU' gegenüber versagt sie fast völlig.
^’e zu erwartende Frankfurter
von Gräfin Lanckoronska und
? "Her die Kenntnis dieser Epoche auf
25 jähriges Jubiläum
äer Städtischen Kunsthalle
Mannheim
ü®s Jahres 1907 wurde die städti-
Kunsthalle Mannheim zugleich mit der
internationalen Kunst- und Gartenbau-
figg yung eröffnet. Aus Anlaß ihres 25jäh-
d. j" Bestehens wird die Kunsthalle am 1. Mai
e'ner bescheidenen Feier eine kleine
e" ung eröffnen, die einen Überblick über
'M , esentlichen Veranstaltungen des genann-
^stituts seit 1907 geben soll.
£ Berichtigung.
ii'6 abPj?T.’i?serer Nr- 7 vom 14- Februar 1932 auf
Ri . Gemälde von M e t s u aus Ber-
vatbesitz ist nicht, wie angegeben, auf
d sondern auf Holz gemalt.
Sammlerin Hermine Feist am gelungensten.
Magnus Zeller, der in der Expressionisten-
zeit von sich reden machte, ist uns als
Aquarellist sympathischer als in Öl. Er
ist unter die Sitten- und Milieuschilderer ge-
gangen, gibt motivisch viel Betrieb, aber wenig
Vorgang, gleitet zuweilen ab in süßlichen
Spuk und pflegt schweflige, weinerliche Far-
ben von grünlicher Transparenz. Außerdem
zeigt die Ausstellung Arbeiten des Bildhauers
Herbert Garbe und Aquarelle von Erich
Klossowski.
Ise Bienert
Diesmal hat Nierendorf eine glückliche
Hand gehabt: eine wundervolle Ausstellung ist
das. Es gibt noch Überraschungen. Hier hat
sich ganz in der Stille, eigen und selbstver-
ständlich, ein Werk geformt: echte und beste
Frauenkunst, zart und verhalten, klar und von
bewundernswerter Einfachheit. Der Name Ise
Bienert wird künftig nicht zu übersehen sein.
Der einzige, immer wieder neu erfühlte und
neu gestaltete Stoff dieser reinen, feinen Zeich¬
nungen: die menschliche Gestalt als Träger
und Ausdruck inneren Erlebens. Die beseelte
Körpergebärde der Gotik ersteht auf. Einzel-
figuren, zwei oder drei Figuren in leisen Wen-
dungen eurhythmisch zueinander bewegt, ver-
mitteln in zartesten Andeutungen den Emp-
findungsreichtum eines großen Herzens. Die
darstellerischen Mittel sind unübertrefflich
knapp und sicher. Die einzelne Zeichnung setzt
sich aus nur wenigen, formvereinfachenden
Linien und tonigen, das Blatt übergreifende
Flächen zusammen. Durch ein eigenes tech-
nisches Verfahren treten die Linien, die so
fühlsam gezogen sind, daß sie trotz des Ver-
zichtes auf modellierende Schattierung die
Formbewegungen des Körpers deutlich machen,
stellenweise sacht verfließend gleichsam über
den Rand und erzeugen ein seltsames Fluidum,
aus dem sich die Melodie seelischer Bewegung
mitteilt. Die Entwicklung strebt zu immer
tieferer Verinnerlichung bei fortschreitender
formaler Vereinfachung. Sie geht weiter und
weiter, weil die Darstellungsmittel an dem
Stoff, der schlicht menschlich und deshalb
immer neu und unendlich vielgestaltig ist,
wachsen. Kusenberg
Indische Teppiche
Durch die engen Beziehungen, die die in-
dischen Mogul-Kaiser in Religion, Welt- und
Kunstanschauungen mit der westlichen isla-
mischen Welt verbanden, sind Knüpfteppiche
und persische Stoffe an die indischen Höfe ge-
langt. Der Ehrgeiz ließ die Landesherrscher
nicht eher ruhen, bis in Indien Handwerker
herangezogen wurden, die Hofmanufakturen
einrichteten und Teppiche zu knüpfen be-
gannen. Erst um 1500 lassen sich Teppiche
nachweisen, die in Indien selbst geknüpft sind,
und bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts blieb
die Produktion von Teppichen dort ebenfalls
nur auf die Hofmanufakturen beschränkt.
Wenn sich diese indischen Hofmanufaktur-
teppiche oft im Muster vor allen Dingen an
die ostpersischen Herat-Teppiche, die im Han-
del mit Isphahans bezeichnet werden, an-
lehnen, zeigen doch die indischen Teppiche
ausgesprochene Eigentümlichkeiten. Abgesehen
von Material und Farbengebung widerstrebt
dem Inder der streng rhythmische symmetrische
Aufbau der islamischen
Welt. Hatte schon
Persien einen freieren
Stil gefunden, so kann
man doch bei fast allen
persischen Teppichen
aus der klassischen Zeit
eine nach geometri¬
schen Gesetzen sym¬
metrisch geordnete Auf¬
teilung der Fläche,
selbst bei kühnstem
Linienschwung der Ran-
ken und Blätter, er-
kennen. Gerade viele der
frühsten indischen Tep-
piche sind in ihrer
Musterung schlicht ge-
halten. Die Blumenfül-
lung ist häufig locker
und weder gruppiert
noch symmetrisch. Der
Blumendekor ist oft sehr
naturalistisch gehalten,
und F. R. Martin be-
tont mit Recht, daß kein
Volk des Orients die Lilie
in gleich schöner und
naturalistischer Gestal-
tungwiedergegeben hat.
Auch wo es sich um
die Wiedergabe von
Menschen und Tieren
handelt, werden sie sehr
oft ganz unsymmetrisch
unter Bäume oder in
die Landschaft gesetzt,
so wie sie in der Frei-
heit leben. Oder die Ge¬
staltungsfreudigkeit der
Knüpfer geht gerade
bei den frühesten
Stücken so weit, daß ein
Tier aus dem anderen
hervorwächst ohne Zu-
grundelegung irgend-
einer Flächenaufteilung,
wobei naturalistische
Blumenranken nur als
Füllungen dienen (Ab¬
bildung nebenstehend).
Da die Produktion bis
zur Mitte des 17. Jahrhunderts nur auf die
Hofmanufakturen beschränkt blieb, sind Bei-
spiele indischer Teppiche aus dieser Zeit sehr
rar, und noch seltener, als die im Kunsthandel
so begehrten sogenannten Isphahans.
Einige der wenigen leidlich erhaltenen
Stücke mit Mustern, die sich stark an die soge-
nannten Isphahans anlehnen, befinden sich im
Londoner Viktoria- und Albert-Museum. Der
oben rechts abgebildete Teppich steht diesen
Stücken sehr nahe und lehnt sich in der Wie-
dergabe der florealen Dessins, vor allem aber
in der schönen, breiten Borte stark an per-
sische Vorbilder an. Typisch für einen soge-
nannten Indo-Isphahan ist aber die tiefe wein-
rote Färbung des Grundes im Mittelstück, die
einen so schönen Kontrast gegen die leuchtend
grüne Borte hervorbringt. Aber auch in der
Zeichnung hat sich hier der indische Künstler
bei der Gestaltung der Borte von dem persi-
schen Vorbild freizumachen versucht. Statt
des symmetrischen Rankengeschlings, das Pal-
metten und Lotosblumen bei den persischen
Teppichen verbindet, finden wir hier um eine
Zentralblume herum gruppierte recht natura-
listische Blumen, bei denen man zum Teil die
Lilie erkennt, und von denen aus sich wie un¬
gewollt die Ranken zu den Hauptblumen fort-
setzen. Aber den Sinn einer guten Ecklösung
hat auch der indische Knüpfer verstanden.
Auch seidene indische Teppiche aus der
klassischen Zeit sind in ganz wenigen Stücken
bekannt. Wie weit der Ehrgeiz der indischen
Hofmanufakturen ging, es Persien gleich zu
tun, wurde auf der letzten persischen Ausstel-
lung in London an einer Nachbildung eines
persischen figuralen Yest-Samtes gezeigt. Da
Indien die Kunst des Samtwebens nie gelernt
hat, wurde der kühne Versuch unternommen,
den Eindruck des Yest-Samtes wiederzugeben,
wobei die Web- durch die Knüpftechnik ersetzt
wurde. Diese bewunderungswürdige in Seide
geknüpfte Nachbildung eines persischen Yest-
Samtes zeigt die feinste Knüpfung, die je von
einem Teppich bekanntgeworden ist. Über
vier Millionen Knoten kommen hier auf den
Quadratmeter. Die Knüpfungen sind mit dem
unbewaffneten Auge nicht mehr als solche zu
erkennen.
Bei der Seltenheit der indischen Teppiche
ist es schwer, einen Anhaltspunkt über ihren
Wert zu geben, zumal in der heutigen Zeit, wo
alle Wertungen auf den Kopf gestellt sind.
Für das verhältnismäßig kleine abgebildete
Fragment hat ein bekannter Berliner Kunst-
sammler vor einigen Jahren 80 000 Gold-Frs.
bezahlt. Im Jahre 1927 brachte ein Indo-Is-
phahan auf der Auktion von Harris Watson in
New York 40 000 $. In der heutigen Zeit kann
man trotz der Seltenheit klassischer indischer
Teppiche nur etwa die Hälfte der damals er-
zielten Preise für solche Stücke ansetzen. Daß
klassische Teppiche heute, aber auch schon in
der guten Zeit, im Vergleich zu anderen Kunst-
werken stets unterwertet wurden, wird sich
später einmal zeigen, wenn wieder die Nach-
frage einsetzt und leidlich erhaltene Stücke
aus dem Kunstmarkt verschwunden sind. Ein
Teppich unterliegt eben in ganz anderer Weise
der Abnutzung wie ein Gemälde, wo von den
berühmtesten Malern oft Hunderte von ein-
wandfreien Bildern existieren. Bilder werden
eben durch den Zahn der Zeit nicht entfernt so
in Mitleidenschaft gezogen, wie alle Teppiche
und stofflichen Gewebe.
Werner Grote- Hasenbalg
Indischer Teppich, sog. Indo-Isphahan
Anfang 17. Jahrhundert. 293 : 445 cm
5
Nr. 8 vom 21. Februar 1932
Be-
aber
Der
sind gespannt, ob von Merveldt der Anschluß
an die lichte Klarheit der französischen Tra-
dition gefunden werden wird. Als Vorbedin-
gung ist jedenfalls der reine Wille zur Form
und zu ihrer intensivsten Durcharbeitung ge-
geben. Dr. E. v. S y d o w
H. H. Graf v. Merveldt, Haus mit Booten
Collection Dr. Hartmann, Berlin
Ausstellung — Exposition — Exhibition:
Galerie Alfred Flechtheim, Berlin
usw. verfolgen können und fühlen uns nun
durch diese Reihe von zehn Bildern durchaus
in der Erwartung erneut bestärkt, die seine Ar-
beiten bisher in uns wachgerufen haben. Der
Klang seiner Farben ist volltönend, und ihre
Bindung und Verschmelzung bezeugt die er-
folgreiche Schulung bei Karl Hofer. Der Ge-
fahr, in welcher Hoferschüler freilich nur zu
oft schweben: in fast kunstgewerbliche Deko-
rativität zu verfallen, entgeht Merveldt durch
den starken seelischen Impuls, der ihn erfüllt.
Auch durch das zeichnerisch kompositionelle
Gerüst, das das farbige Kleid seiner Bilder
trägt. Freilich liegt hier noch manches
Problem. Vor allem dies, daß beide Elemente
seiner Kunst eine bessere Balancierung ver-
langen: noch ist das Malertum dem konstruk-
tiven Element weit voraus in der Beherrschung
seiner spezifischen Mittel, —- das Komposito-
rische ist vielfach ohne die oft überzeugende
Kräftigkeit seiner Farbverbindungen. Gleich-
wohl ist das Horoskop vielversprechend, das
man dem jungen Westfalen stellen darf, der
nach mannigfachen Studien in Karlsruhe
(Kunstakademie), Berlin (1923—26) und
Italien (1926) seit 1927 in Südfrankreich (Mar-
tigues) lebt und arbeitet. Einheitlich und
gleichmäßig stark spricht sich, nicht ohne Be-
deutung, ein Weltgefühl aus, das man wohl als
Klassizismus mit einem Einschlag tragisch
nuancierter Romantik bezeichnen darf. Wir
Hans H. v. Merveldt
Die Ausstellung der Berliner Galerie
A. Flechtheim, „Junge deutsche Künst-
ler“, zeigt zum erstenmal eine kleine Kollektiv-
ausstellung von Gemälden des Hans Hubertus
Grafen von Merveldt: Stilleben, Bild-
nisse und vor allem Landschaften, die im
letzten Jahr in Martigues (Südfrankreich) ent-
standen sind. Wir reproduzieren das „Haus
mit Booten“ (Abbildung unten) aus der
Berliner Sammlung Dr. Hartmann. In Einzel-
proben haben wir bisher die Entwicklung
seines Talentes auf früheren Ausstellungen der
Berliner Secession, der Akademie der Künste
- - eine
'eiterte, zuverlässige Grundlage stellen.
Süddeutsche Illustration der Rokokozeit
Fortsetzung von Seite 2
^deutscher Stimmung sind. Im folgenden Jahr
Rinnen die vier Bände „Leben der Heiligen“
Giulini zu erscheinen, für die vor allem
aumgartner arbeitete und denen er durch die
lut seiner Martyrien den Charakter verleiht.
,llt ihm zu messen vermag sich nur Sigrist,
essen Pathos sich mehr in Raumwirkungen
"wickelt. Durch Handzeichnungen gut reprä-
entiert ist auch der jüngere Eichler, von dem
.Hs Augsburger Privatbesitz zwei Bände mit
en Originalvorzeichnungen zu Ripas Iconologie
sehen sind, dem sonderbar erklügelten Prö-
das 1750 eine Auf-
Berliner Secession
In diesen Räumen reichen sich gleichgültige
Ausstellungen die Hand. Professor Rudolf
Grossmann, der kürzlich sein 50. Lebens-
jahr vollendete, stellt eine größere Anzahl
Zeichnungen, Gemälde, Plastiken aus. Die
Reihe der teilweise gut gesehenen und witzi-
gen Prominentenkonterfeie hat mittlerweile
wieder Zuwachs erhalten. Man mag berühmt
sein: richtig prominent wird man erst in dem
Augenblick, da man Rudolf Grossmann Modell
sitzt. Seine Porträts verleihen dem Ruhm den
offiziellen Stempel und die eigentliche Weihe.
Von seinen kleinen Plastiken ist das amüsante
Porträt der nicht minder amüsanten Porzellan-
Fragment eines indischen Gebetsteppichs
um 1500
> ^iicll ö-llldj öUIlCl
ukt des Manierismus,
rstehung feierte. Auch
Dehnungen der Staatl.
,;Unstbibliothek zeigen
fehler als Meister
übriger, nuancen¬
weher Tuschzeichnun-
I?11, voll prickelnder-
. lchtwirkung. Der Po¬
larste unter den
^ügsburger Stechern,
JÜSon, der schon ein
•rbe der neuen Stilbe-
'JWgung ist, ist auf der
/■ksstellung vorwiegend
'M wenig beachteten
Mhen Arbeiten ver-
‘Men. Seine Zeichnun-
'Mi aus den 40er Jahren
""d auch die inter¬
essanten Monatsblätter
'“'s Verlages Pfeffel auf
We Jahre 1746 und 1747
Mgen, wie er mit früh¬
stem Talent seine
:-;<ufbahn beginnt. Als
’erher rlicher weltlichen
Md reichsstädtisch-
kalanten Lebens -wächst
aus den 50er Jahren,
f 0 er seinen ganz ge-
ackerten, dekorativ be¬
ugten Zeichenstil aus-
‘‘det, bis in den Klassi-
Mmus, wo die Illustra-
S an anderen Stätten Künderin eines neuen
'katursinns und Menschentums wird.
Noch weitere Augsburger Namen sind ver-
beten, von dem Illustrationsstil anderer Kunst-
zentren dagegen konnte nur eine Andeutung
gegeben werden. Mit Bayern und speziell mit
München ist Augsburg in dieser Epoche durch
barke Gemeinsamkeiten verbunden. Entschei-
dend ist, daß hier wie dort die Mehr-
Mil der entwerfenden Graphiker zugleich
“aler waren, die als Freskanten Kom-
position und Figurenstil virtuos beherrsch-
en. Doch scheint in München die Fein-
heit der Graphik nicht entsprechenden Bo-
den besessen zu haben. In dem ausgestellten
’Ariumphus virtutum in funere Caroli VII.“
,v°n 1745 kommt als Entwerfer noch ein Künst-
ler der älteren Generation zu Worte, Nie. Stu-
ber, der trotz der bayerischen Robustheit noch
>brk in italienischer Schulung befangen ist.
Mn Werk von echtem Rokokocharakter dagegen
bt der kurbayerische geistliche Kalender Jos.
^■ht. Zimmermanns, der 1754 zu erscheinen be-
|ann. Er gibt Widmungsblätter, Rahmenwerk
reiche Wappen von einer naturwüchsigen
Regularität und strotzenden Form, wie sie
hierorts nicht zu denken wäre.
Die Nürnberger Graphik, die auf nie abge-
"oehenen Traditionen aufbaut, hat das
jbßtsein ihrer Verpflichtung, genießt
jlcht den Impuls der Schwesterkünste.
i'Me des vielbeschäftigten, tüchtigen
i Mitin Tyroff ist vertreten. Die „Geist-
S:n Todtsgedanken“ von Rentz, die
in Passau in noch ganz barocken
'^formen erschienen, gelten mit Recht
eine beachtenswerte Schöpfung voll
l^higer echter dämonischer Visionen,
jonischer Aufwand und stecherische
j.Tesse aber stehen meist in Mißver-
JÜtnis zu der verquälten Gestaltungs¬
ide. Am Anfang der ausgestellten
jj.dher befindet sich endlich ein seltenes,
fl°chst kurioses Werkchen vom Jahre 1729,
eigentlich vor der behandelten Epoche
v?St und doch schon auf ihre Stimmung
"*eist. Es ist das „der zwar hefftlg
'-flammte Amor —“, zu dem I. B. Probst
k ch Entwürfen des bekannten Nürn-
Mers Joh. Jac. Schübler 12 Illustra-
w"eh schuf. Auf diese zwar dilettanti-
I1> doch sehr pretiösen Blätter hinge-
L.6sen zu haben, ist das Verdienst von
'hann, der sonst durch seine erstaunlich
reichende Bibliographie des deut-
inp1 illustrierten Buches im 18. Jahrh.
L ^ordentlich enttäuscht. Süddeutsch-
lijU' gegenüber versagt sie fast völlig.
^’e zu erwartende Frankfurter
von Gräfin Lanckoronska und
? "Her die Kenntnis dieser Epoche auf
25 jähriges Jubiläum
äer Städtischen Kunsthalle
Mannheim
ü®s Jahres 1907 wurde die städti-
Kunsthalle Mannheim zugleich mit der
internationalen Kunst- und Gartenbau-
figg yung eröffnet. Aus Anlaß ihres 25jäh-
d. j" Bestehens wird die Kunsthalle am 1. Mai
e'ner bescheidenen Feier eine kleine
e" ung eröffnen, die einen Überblick über
'M , esentlichen Veranstaltungen des genann-
^stituts seit 1907 geben soll.
£ Berichtigung.
ii'6 abPj?T.’i?serer Nr- 7 vom 14- Februar 1932 auf
Ri . Gemälde von M e t s u aus Ber-
vatbesitz ist nicht, wie angegeben, auf
d sondern auf Holz gemalt.
Sammlerin Hermine Feist am gelungensten.
Magnus Zeller, der in der Expressionisten-
zeit von sich reden machte, ist uns als
Aquarellist sympathischer als in Öl. Er
ist unter die Sitten- und Milieuschilderer ge-
gangen, gibt motivisch viel Betrieb, aber wenig
Vorgang, gleitet zuweilen ab in süßlichen
Spuk und pflegt schweflige, weinerliche Far-
ben von grünlicher Transparenz. Außerdem
zeigt die Ausstellung Arbeiten des Bildhauers
Herbert Garbe und Aquarelle von Erich
Klossowski.
Ise Bienert
Diesmal hat Nierendorf eine glückliche
Hand gehabt: eine wundervolle Ausstellung ist
das. Es gibt noch Überraschungen. Hier hat
sich ganz in der Stille, eigen und selbstver-
ständlich, ein Werk geformt: echte und beste
Frauenkunst, zart und verhalten, klar und von
bewundernswerter Einfachheit. Der Name Ise
Bienert wird künftig nicht zu übersehen sein.
Der einzige, immer wieder neu erfühlte und
neu gestaltete Stoff dieser reinen, feinen Zeich¬
nungen: die menschliche Gestalt als Träger
und Ausdruck inneren Erlebens. Die beseelte
Körpergebärde der Gotik ersteht auf. Einzel-
figuren, zwei oder drei Figuren in leisen Wen-
dungen eurhythmisch zueinander bewegt, ver-
mitteln in zartesten Andeutungen den Emp-
findungsreichtum eines großen Herzens. Die
darstellerischen Mittel sind unübertrefflich
knapp und sicher. Die einzelne Zeichnung setzt
sich aus nur wenigen, formvereinfachenden
Linien und tonigen, das Blatt übergreifende
Flächen zusammen. Durch ein eigenes tech-
nisches Verfahren treten die Linien, die so
fühlsam gezogen sind, daß sie trotz des Ver-
zichtes auf modellierende Schattierung die
Formbewegungen des Körpers deutlich machen,
stellenweise sacht verfließend gleichsam über
den Rand und erzeugen ein seltsames Fluidum,
aus dem sich die Melodie seelischer Bewegung
mitteilt. Die Entwicklung strebt zu immer
tieferer Verinnerlichung bei fortschreitender
formaler Vereinfachung. Sie geht weiter und
weiter, weil die Darstellungsmittel an dem
Stoff, der schlicht menschlich und deshalb
immer neu und unendlich vielgestaltig ist,
wachsen. Kusenberg
Indische Teppiche
Durch die engen Beziehungen, die die in-
dischen Mogul-Kaiser in Religion, Welt- und
Kunstanschauungen mit der westlichen isla-
mischen Welt verbanden, sind Knüpfteppiche
und persische Stoffe an die indischen Höfe ge-
langt. Der Ehrgeiz ließ die Landesherrscher
nicht eher ruhen, bis in Indien Handwerker
herangezogen wurden, die Hofmanufakturen
einrichteten und Teppiche zu knüpfen be-
gannen. Erst um 1500 lassen sich Teppiche
nachweisen, die in Indien selbst geknüpft sind,
und bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts blieb
die Produktion von Teppichen dort ebenfalls
nur auf die Hofmanufakturen beschränkt.
Wenn sich diese indischen Hofmanufaktur-
teppiche oft im Muster vor allen Dingen an
die ostpersischen Herat-Teppiche, die im Han-
del mit Isphahans bezeichnet werden, an-
lehnen, zeigen doch die indischen Teppiche
ausgesprochene Eigentümlichkeiten. Abgesehen
von Material und Farbengebung widerstrebt
dem Inder der streng rhythmische symmetrische
Aufbau der islamischen
Welt. Hatte schon
Persien einen freieren
Stil gefunden, so kann
man doch bei fast allen
persischen Teppichen
aus der klassischen Zeit
eine nach geometri¬
schen Gesetzen sym¬
metrisch geordnete Auf¬
teilung der Fläche,
selbst bei kühnstem
Linienschwung der Ran-
ken und Blätter, er-
kennen. Gerade viele der
frühsten indischen Tep-
piche sind in ihrer
Musterung schlicht ge-
halten. Die Blumenfül-
lung ist häufig locker
und weder gruppiert
noch symmetrisch. Der
Blumendekor ist oft sehr
naturalistisch gehalten,
und F. R. Martin be-
tont mit Recht, daß kein
Volk des Orients die Lilie
in gleich schöner und
naturalistischer Gestal-
tungwiedergegeben hat.
Auch wo es sich um
die Wiedergabe von
Menschen und Tieren
handelt, werden sie sehr
oft ganz unsymmetrisch
unter Bäume oder in
die Landschaft gesetzt,
so wie sie in der Frei-
heit leben. Oder die Ge¬
staltungsfreudigkeit der
Knüpfer geht gerade
bei den frühesten
Stücken so weit, daß ein
Tier aus dem anderen
hervorwächst ohne Zu-
grundelegung irgend-
einer Flächenaufteilung,
wobei naturalistische
Blumenranken nur als
Füllungen dienen (Ab¬
bildung nebenstehend).
Da die Produktion bis
zur Mitte des 17. Jahrhunderts nur auf die
Hofmanufakturen beschränkt blieb, sind Bei-
spiele indischer Teppiche aus dieser Zeit sehr
rar, und noch seltener, als die im Kunsthandel
so begehrten sogenannten Isphahans.
Einige der wenigen leidlich erhaltenen
Stücke mit Mustern, die sich stark an die soge-
nannten Isphahans anlehnen, befinden sich im
Londoner Viktoria- und Albert-Museum. Der
oben rechts abgebildete Teppich steht diesen
Stücken sehr nahe und lehnt sich in der Wie-
dergabe der florealen Dessins, vor allem aber
in der schönen, breiten Borte stark an per-
sische Vorbilder an. Typisch für einen soge-
nannten Indo-Isphahan ist aber die tiefe wein-
rote Färbung des Grundes im Mittelstück, die
einen so schönen Kontrast gegen die leuchtend
grüne Borte hervorbringt. Aber auch in der
Zeichnung hat sich hier der indische Künstler
bei der Gestaltung der Borte von dem persi-
schen Vorbild freizumachen versucht. Statt
des symmetrischen Rankengeschlings, das Pal-
metten und Lotosblumen bei den persischen
Teppichen verbindet, finden wir hier um eine
Zentralblume herum gruppierte recht natura-
listische Blumen, bei denen man zum Teil die
Lilie erkennt, und von denen aus sich wie un¬
gewollt die Ranken zu den Hauptblumen fort-
setzen. Aber den Sinn einer guten Ecklösung
hat auch der indische Knüpfer verstanden.
Auch seidene indische Teppiche aus der
klassischen Zeit sind in ganz wenigen Stücken
bekannt. Wie weit der Ehrgeiz der indischen
Hofmanufakturen ging, es Persien gleich zu
tun, wurde auf der letzten persischen Ausstel-
lung in London an einer Nachbildung eines
persischen figuralen Yest-Samtes gezeigt. Da
Indien die Kunst des Samtwebens nie gelernt
hat, wurde der kühne Versuch unternommen,
den Eindruck des Yest-Samtes wiederzugeben,
wobei die Web- durch die Knüpftechnik ersetzt
wurde. Diese bewunderungswürdige in Seide
geknüpfte Nachbildung eines persischen Yest-
Samtes zeigt die feinste Knüpfung, die je von
einem Teppich bekanntgeworden ist. Über
vier Millionen Knoten kommen hier auf den
Quadratmeter. Die Knüpfungen sind mit dem
unbewaffneten Auge nicht mehr als solche zu
erkennen.
Bei der Seltenheit der indischen Teppiche
ist es schwer, einen Anhaltspunkt über ihren
Wert zu geben, zumal in der heutigen Zeit, wo
alle Wertungen auf den Kopf gestellt sind.
Für das verhältnismäßig kleine abgebildete
Fragment hat ein bekannter Berliner Kunst-
sammler vor einigen Jahren 80 000 Gold-Frs.
bezahlt. Im Jahre 1927 brachte ein Indo-Is-
phahan auf der Auktion von Harris Watson in
New York 40 000 $. In der heutigen Zeit kann
man trotz der Seltenheit klassischer indischer
Teppiche nur etwa die Hälfte der damals er-
zielten Preise für solche Stücke ansetzen. Daß
klassische Teppiche heute, aber auch schon in
der guten Zeit, im Vergleich zu anderen Kunst-
werken stets unterwertet wurden, wird sich
später einmal zeigen, wenn wieder die Nach-
frage einsetzt und leidlich erhaltene Stücke
aus dem Kunstmarkt verschwunden sind. Ein
Teppich unterliegt eben in ganz anderer Weise
der Abnutzung wie ein Gemälde, wo von den
berühmtesten Malern oft Hunderte von ein-
wandfreien Bildern existieren. Bilder werden
eben durch den Zahn der Zeit nicht entfernt so
in Mitleidenschaft gezogen, wie alle Teppiche
und stofflichen Gewebe.
Werner Grote- Hasenbalg
Indischer Teppich, sog. Indo-Isphahan
Anfang 17. Jahrhundert. 293 : 445 cm