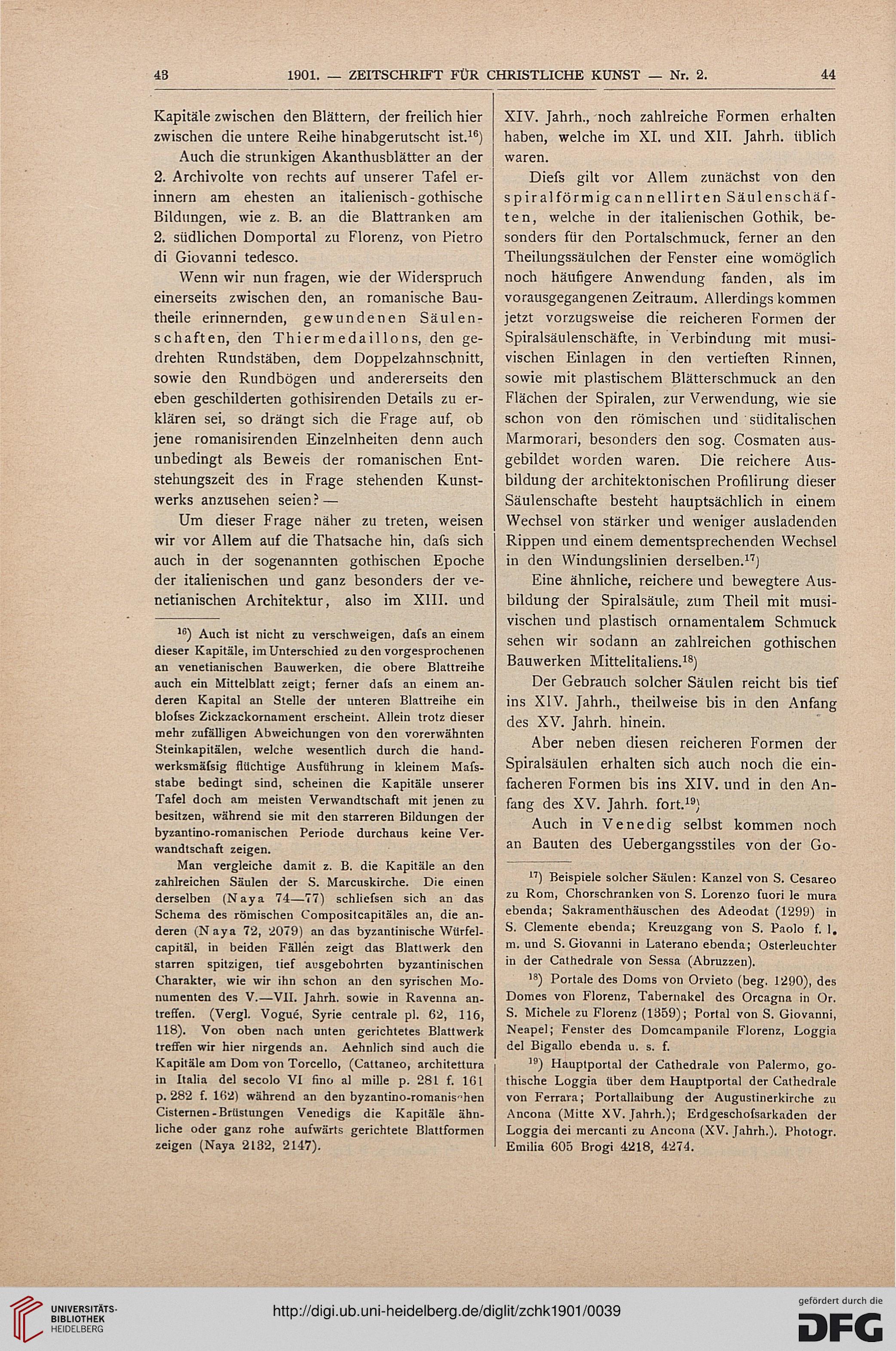43
1901. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 2.
44
Kapitale zwischen den Blättern, der freilich hier
zwischen die untere Reihe hinabgerutscht ist.16)
Auch die strunkigen Akanthusblätter an der
2. Archivolte von rechts auf unserer Tafel er-
innern am ehesten an italienisch - gothische
Bildungen, wie z. B. an die Blattranken am
2. südlichen Domportal zu Florenz, von Pietro
di Giovanni tedesco.
Wenn wir nun fragen, wie der Widerspruch
einerseits zwischen den, an romanische Bau-
theile erinnernden, gewundenen Säulen-
schaft en, den Thiermedaillons, den ge-
drehten Rundstäben, dem Doppelzahnschnitt,
sowie den Rundbögen und andererseits den
eben geschilderten gothisirenden Details zu er-
klären sei, so drängt sich die Frage auf, ob
jene romanisirenden Einzelnheiten denn auch
unbedingt als Beweis der romanischen Ent-
stehungszeit des in Frage stehenden Kunst-
werks anzusehen seien ? —
Um dieser Frage näher zu treten, weisen
wir vor Allem auf die Thatsache hin, dafs sich
auch in der sogenannten gothischen Epoche
der italienischen und ganz besonders der ve-
netianischen Architektur, also im XIII. und
16) Auch ist nicht zu verschweigen, dafs an einem
dieser Kapitale, im Unterschied zu den vorgesprochenen
an venetianischen Bauwerken, die obere Blattreihe
auch ein Mittelblatt zeigt; ferner dafs an einem an-
deren Kapital an Stelle der unteren Blattreihe ein
blofses Zickzackornament erscheint. Allein trotz dieser
mehr zufälligen Abweichungen von den vorerwähnten
Steinkapitälen, welche wesentlich durch die hand-
werksmäfsig flüchtige Ausführung in kleinem Mafs-
stabe bedingt sind, scheinen die Kapitale unserer
Tafel doch am meisten Verwandtschaft mit jenen zu
besitzen, während sie mit den starreren Bildungen der
byzantino-romanischen Periode durchaus keine Ver-
wandtschaft zeigen.
Man vergleiche damit z. B. die Kapitale an den
zahlreichen Säulen der S. Marcuskirche. Die einen
derselben (Naya 74—77) schliefsen sich an das
Schema des römischen Compositcapitäles an, die an-
deren (Naya 72, 2079) an das byzantinische Würfel-
capitäl, in beiden Fällen zeigt das Blattwerk den
starren spitzigen, tief ausgebohrten byzantinischen
Charakter, wie wir ihn schon an den syrischen Mo-
numenten des V.—VII. Jahrh. sowie in Ravenna an-
treffen. (Vergl. Vogue, Syrie centrale pl. 62, 116,
118). Von oben nach unten gerichtetes Blattwerk
treffen wir hier nirgends an. Aehnlich sind auch die
Kapitale am Dom von Torcello, (Cattaneo, architettura
in Italia del secolo VI fino al mille p. 28 L f. 161
p. 282 f. 162) während an den byzantino-romanis"hen
Cisterneu-Brüstungen Venedigs die Kapitale ähn-
liche oder ganz rohe aufwärts gerichtete Blattformen
zeigen (Naya 2132, 2147).
XIV. Jahrh., noch zahlreiche Formen erhalten
haben, welche im XI. und XII. Jahrh. üblich
waren.
Diefs gilt vor Allem zunächst von den
spiralförmig cannellirten Säulenschäf-
ten, welche in der italienischen Gothik, be-
sonders für den Portalschmuck, ferner an den
Theilungssäulchen der Fenster eine womöglich
noch häufigere Anwendung fanden, als im
vorausgegangenen Zeitraum. Allerdings kommen
jetzt vorzugsweise die reicheren Formen der
Spiralsäulenschäfte, in Verbindung mit musi-
vischen Einlagen in den vertieften Rinnen,
sowie mit plastischem Blätterschmuck an den
Flächen der Spiralen, zur Verwendung, wie sie
schon von den römischen und süditalischen
Marmorari, besonders den sog. Cosmaten aus-
gebildet worden waren. Die reichere Aus-
bildung der architektonischen Profilirung dieser
Säulenschafte besteht hauptsächlich in einem
Wechsel von stärker und weniger ausladenden
Rippen und einem dementsprechenden Wechsel
in den Windungslinien derselben.17)
Eine ähnliche, reichere und bewegtere Aus-
bildung der Spiralsäule, zum Theil mit musi-
vischen und plastisch ornamentalem Schmuck
sehen wir sodann an zahlreichen gothischen
Bauwerken Mittelitaliens.18)
Der Gebrauch solcher Säulen reicht bis tief
ins XIV. Jahrh., theilweise bis in den Anfang
des XV. Jahrh. hinein.
Aber neben diesen reicheren Formen der
Spiralsäulen erhalten sich auch noch die ein-
facheren Formen bis ins XIV. und in den An-
fang des XV. Jahrh. fort.19)
Auch in Venedig selbst kommen noch
an Bauten des Uebergangsstiles von der Go-
17) Beispiele solcher Säulen: Kanzel von S. Cesareo
zu Rom, Chorschranken von S. Lorenzo fuori le mura
ebenda; Sakramenthäuschen des Adeodat (1290) in
S. demente ebenda; Kreuzgang von S. Paolo f. 1.
m. und S.Giovanni in Laterano ebenda; Osterleuchter
in der Cathedrale von Sessa (Abruzzen).
18) Portale des Doms von Orvieto (beg. 1290), des
Domes von Florenz, Tabernakel des Orcagna in Or.
S. Michele zu Florenz (1359); Portal von S. Giovanni,
Neapel; Fenster des Domcampanile Florenz, Loggia
del Bigallo ebenda u. s. f.
19) Hauptportal der Cathedrale von Palermo, go-
thische Loggia über dem Hauptportal der Cathedrale
von Ferrara; Portallaibung der Augustinerkirche zu
Ancona (Mitte XV. Jahrh.); Erdgeschofsarkaden der
Loggia dei mercanti zu Ancona (XV. Jahrh.). Photogr.
Emilia 605 Brogi 4218, 4274.
1901. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 2.
44
Kapitale zwischen den Blättern, der freilich hier
zwischen die untere Reihe hinabgerutscht ist.16)
Auch die strunkigen Akanthusblätter an der
2. Archivolte von rechts auf unserer Tafel er-
innern am ehesten an italienisch - gothische
Bildungen, wie z. B. an die Blattranken am
2. südlichen Domportal zu Florenz, von Pietro
di Giovanni tedesco.
Wenn wir nun fragen, wie der Widerspruch
einerseits zwischen den, an romanische Bau-
theile erinnernden, gewundenen Säulen-
schaft en, den Thiermedaillons, den ge-
drehten Rundstäben, dem Doppelzahnschnitt,
sowie den Rundbögen und andererseits den
eben geschilderten gothisirenden Details zu er-
klären sei, so drängt sich die Frage auf, ob
jene romanisirenden Einzelnheiten denn auch
unbedingt als Beweis der romanischen Ent-
stehungszeit des in Frage stehenden Kunst-
werks anzusehen seien ? —
Um dieser Frage näher zu treten, weisen
wir vor Allem auf die Thatsache hin, dafs sich
auch in der sogenannten gothischen Epoche
der italienischen und ganz besonders der ve-
netianischen Architektur, also im XIII. und
16) Auch ist nicht zu verschweigen, dafs an einem
dieser Kapitale, im Unterschied zu den vorgesprochenen
an venetianischen Bauwerken, die obere Blattreihe
auch ein Mittelblatt zeigt; ferner dafs an einem an-
deren Kapital an Stelle der unteren Blattreihe ein
blofses Zickzackornament erscheint. Allein trotz dieser
mehr zufälligen Abweichungen von den vorerwähnten
Steinkapitälen, welche wesentlich durch die hand-
werksmäfsig flüchtige Ausführung in kleinem Mafs-
stabe bedingt sind, scheinen die Kapitale unserer
Tafel doch am meisten Verwandtschaft mit jenen zu
besitzen, während sie mit den starreren Bildungen der
byzantino-romanischen Periode durchaus keine Ver-
wandtschaft zeigen.
Man vergleiche damit z. B. die Kapitale an den
zahlreichen Säulen der S. Marcuskirche. Die einen
derselben (Naya 74—77) schliefsen sich an das
Schema des römischen Compositcapitäles an, die an-
deren (Naya 72, 2079) an das byzantinische Würfel-
capitäl, in beiden Fällen zeigt das Blattwerk den
starren spitzigen, tief ausgebohrten byzantinischen
Charakter, wie wir ihn schon an den syrischen Mo-
numenten des V.—VII. Jahrh. sowie in Ravenna an-
treffen. (Vergl. Vogue, Syrie centrale pl. 62, 116,
118). Von oben nach unten gerichtetes Blattwerk
treffen wir hier nirgends an. Aehnlich sind auch die
Kapitale am Dom von Torcello, (Cattaneo, architettura
in Italia del secolo VI fino al mille p. 28 L f. 161
p. 282 f. 162) während an den byzantino-romanis"hen
Cisterneu-Brüstungen Venedigs die Kapitale ähn-
liche oder ganz rohe aufwärts gerichtete Blattformen
zeigen (Naya 2132, 2147).
XIV. Jahrh., noch zahlreiche Formen erhalten
haben, welche im XI. und XII. Jahrh. üblich
waren.
Diefs gilt vor Allem zunächst von den
spiralförmig cannellirten Säulenschäf-
ten, welche in der italienischen Gothik, be-
sonders für den Portalschmuck, ferner an den
Theilungssäulchen der Fenster eine womöglich
noch häufigere Anwendung fanden, als im
vorausgegangenen Zeitraum. Allerdings kommen
jetzt vorzugsweise die reicheren Formen der
Spiralsäulenschäfte, in Verbindung mit musi-
vischen Einlagen in den vertieften Rinnen,
sowie mit plastischem Blätterschmuck an den
Flächen der Spiralen, zur Verwendung, wie sie
schon von den römischen und süditalischen
Marmorari, besonders den sog. Cosmaten aus-
gebildet worden waren. Die reichere Aus-
bildung der architektonischen Profilirung dieser
Säulenschafte besteht hauptsächlich in einem
Wechsel von stärker und weniger ausladenden
Rippen und einem dementsprechenden Wechsel
in den Windungslinien derselben.17)
Eine ähnliche, reichere und bewegtere Aus-
bildung der Spiralsäule, zum Theil mit musi-
vischen und plastisch ornamentalem Schmuck
sehen wir sodann an zahlreichen gothischen
Bauwerken Mittelitaliens.18)
Der Gebrauch solcher Säulen reicht bis tief
ins XIV. Jahrh., theilweise bis in den Anfang
des XV. Jahrh. hinein.
Aber neben diesen reicheren Formen der
Spiralsäulen erhalten sich auch noch die ein-
facheren Formen bis ins XIV. und in den An-
fang des XV. Jahrh. fort.19)
Auch in Venedig selbst kommen noch
an Bauten des Uebergangsstiles von der Go-
17) Beispiele solcher Säulen: Kanzel von S. Cesareo
zu Rom, Chorschranken von S. Lorenzo fuori le mura
ebenda; Sakramenthäuschen des Adeodat (1290) in
S. demente ebenda; Kreuzgang von S. Paolo f. 1.
m. und S.Giovanni in Laterano ebenda; Osterleuchter
in der Cathedrale von Sessa (Abruzzen).
18) Portale des Doms von Orvieto (beg. 1290), des
Domes von Florenz, Tabernakel des Orcagna in Or.
S. Michele zu Florenz (1359); Portal von S. Giovanni,
Neapel; Fenster des Domcampanile Florenz, Loggia
del Bigallo ebenda u. s. f.
19) Hauptportal der Cathedrale von Palermo, go-
thische Loggia über dem Hauptportal der Cathedrale
von Ferrara; Portallaibung der Augustinerkirche zu
Ancona (Mitte XV. Jahrh.); Erdgeschofsarkaden der
Loggia dei mercanti zu Ancona (XV. Jahrh.). Photogr.
Emilia 605 Brogi 4218, 4274.