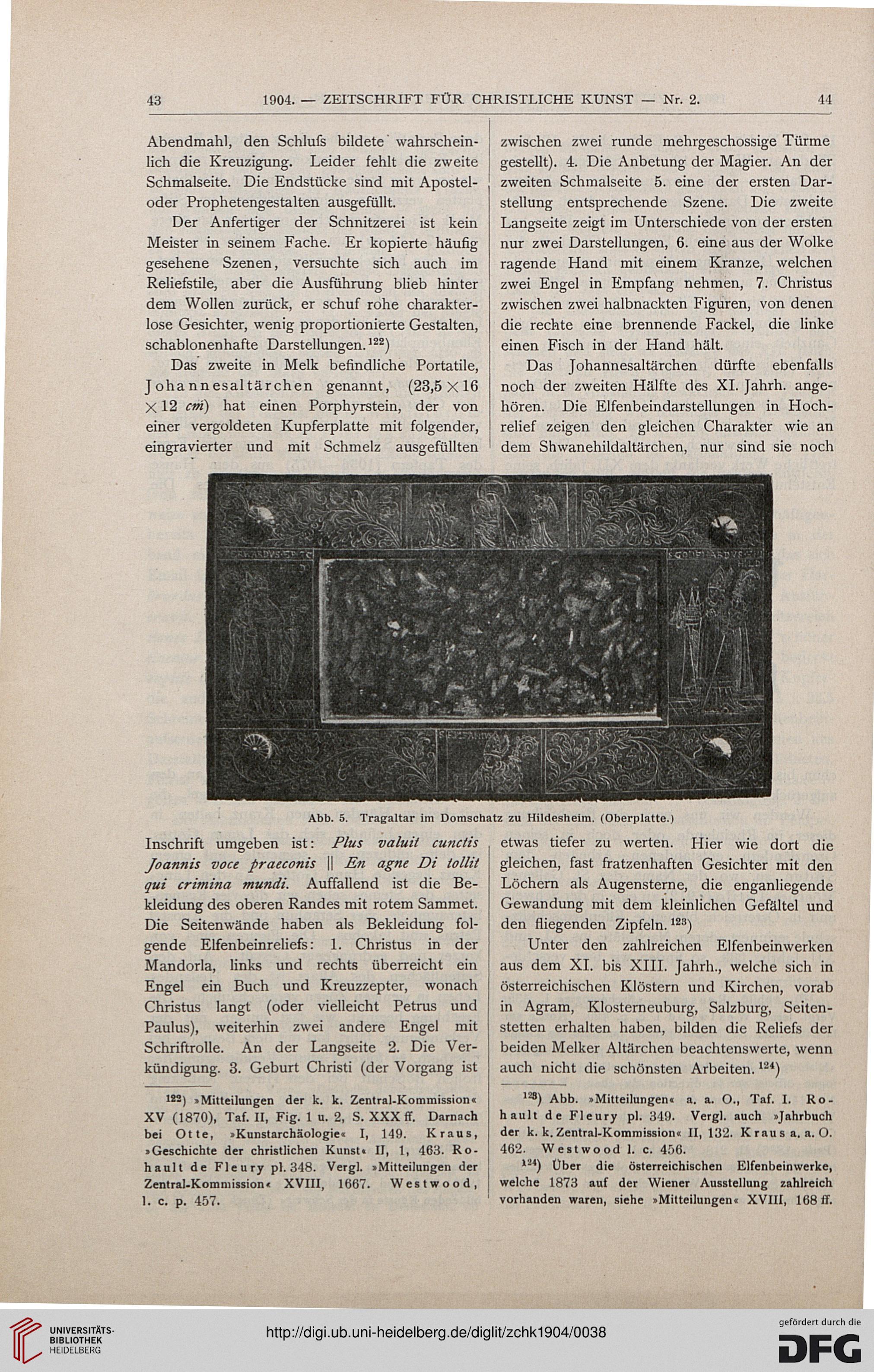43
1904. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 2.
44
Abendmahl, den Schlufs bildete' wahrschein-
lich die Kreuzigung. Leider fehlt die zweite
Schmalseite. Die Endstücke sind mit Apostel-
oder Prophetengestalten ausgefüllt.
Der Anfertiger der Schnitzerei ist kein
Meister in seinem Fache. Er kopierte häufig
gesehene Szenen, versuchte sich auch im
Reliefstile, aber die Ausführung blieb hinter
dem Wollen zurück, er schuf rohe charakter-
lose Gesichter, wenig proportionierte Gestalten,
schablonenhafte Darstellungen.12z)
Das zweite in Melk befindliche Portatile,
Joha nnesaltärchen genannt, (23,5X16
X12 cm) hat einen Porphyrstein, der von
einer vergoldeten Kupferplatte mit folgender,
eingravierter und mit Schmelz ausgefüllten
zwischen zwei runde mehrgeschossige Türme
gestellt). 4. Die Anbetung der Magier. An der
zweiten Schmalseite 5. eine der ersten Dar-
stellung entsprechende Szene. Die zweite
Langseite zeigt im Unterschiede von der ersten
nur zwei Darstellungen, 6. eine aus der Wolke
ragende Hand mit einem Kranze, welchen
zwei Engel in Empfang nehmen, 7. Christus
zwischen zwei halbnackten Figuren, von denen
die rechte eine brennende Fackel, die linke
einen Fisch in der Hand hält.
Das Johannesaltärchen dürfte ebenfalls
noch der zweiten Hälfte des XL Jahrh. ange-
hören. Die Elfenbeindarstellungen in Hoch-
relief zeigen den gleichen Charakter wie an
dem Shwanehildaltärchen, nur sind sie noch
Abb. 5. Tragaltar im Domschatz zu Hildesheim. (Oberplatte.)
Inschrift umgeben ist: Plus valuit cunctis etwas tiefer zu werten.
Joannis voce praeconis || En agne Di lollit
gut crimina mundi. Auffallend ist die Be-
kleidung des oberen Randes mit rotem Sammet.
Die Seitenwände haben als Bekleidung fol-
gende Elfenbeinreliefs: 1. Christus in der
Mandorla, links und rechts überreicht ein
Engel ein Buch und Kreuzzepter, wonach
Christus langt (oder vielleicht Petrus und
Paulus), weiterhin zwei andere Engel mit
Schriftrolle. An der Langseite 2. Die Ver-
kündigung. 3. Geburt Christi (der Vorgang ist
122) »Mitteilungen der k. k. Zentral-Kommission«
XV (1870), Taf. II, Fig. 1 u. 2, S. XXX ff. Darnach
bei Otte, >Kunstarchäologie« I, 149. Kraus,
»Geschichte der christlichen Kunst« II, 1, 463. Ro-
hault de Fleury pl. 348. Vergl. »Mitteilungen der
Zentral-Kommission« XVIII, 1667. Westwood,
1. c. p. 457.
Hier wie dort die
gleichen, fast fratzenhaften Gesichter mit den
Löchern als Augensterne, die enganliegende
Gewandung mit dem kleinlichen Gefältel und
den fliegenden Zipfeln.123)
Unter den zahlreichen Elfenbeinwerken
aus dem XL bis XIII. Jahrh., welche sich in
österreichischen Klöstern und Kirchen, vorab
in Agram, Klosterneuburg, Salzburg, Seiten-
stetten erhalten haben, bilden die Reliefs der
beiden Melker Altärchen beachtenswerte, wenn
auch nicht die schönsten Arbeiten.l24)
12S) Abb. »Mitteilungen« a. a. O., Taf. I. Ro-
ll au lt de Fleury pl, 349. Vergl. auch »Jahrbuch
der k. k. Zentral-Kommission« II, 132. Kraus a.a.O.
462. West wo od 1. c. 456.
rli) Über die österreichischen Elfenbeinwerke,
welche 1873 auf der Wiener Ausstellung zahlreich
vorhanden waren, siehe »Mitteilungen« XVIII, 168 ff.
1904. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 2.
44
Abendmahl, den Schlufs bildete' wahrschein-
lich die Kreuzigung. Leider fehlt die zweite
Schmalseite. Die Endstücke sind mit Apostel-
oder Prophetengestalten ausgefüllt.
Der Anfertiger der Schnitzerei ist kein
Meister in seinem Fache. Er kopierte häufig
gesehene Szenen, versuchte sich auch im
Reliefstile, aber die Ausführung blieb hinter
dem Wollen zurück, er schuf rohe charakter-
lose Gesichter, wenig proportionierte Gestalten,
schablonenhafte Darstellungen.12z)
Das zweite in Melk befindliche Portatile,
Joha nnesaltärchen genannt, (23,5X16
X12 cm) hat einen Porphyrstein, der von
einer vergoldeten Kupferplatte mit folgender,
eingravierter und mit Schmelz ausgefüllten
zwischen zwei runde mehrgeschossige Türme
gestellt). 4. Die Anbetung der Magier. An der
zweiten Schmalseite 5. eine der ersten Dar-
stellung entsprechende Szene. Die zweite
Langseite zeigt im Unterschiede von der ersten
nur zwei Darstellungen, 6. eine aus der Wolke
ragende Hand mit einem Kranze, welchen
zwei Engel in Empfang nehmen, 7. Christus
zwischen zwei halbnackten Figuren, von denen
die rechte eine brennende Fackel, die linke
einen Fisch in der Hand hält.
Das Johannesaltärchen dürfte ebenfalls
noch der zweiten Hälfte des XL Jahrh. ange-
hören. Die Elfenbeindarstellungen in Hoch-
relief zeigen den gleichen Charakter wie an
dem Shwanehildaltärchen, nur sind sie noch
Abb. 5. Tragaltar im Domschatz zu Hildesheim. (Oberplatte.)
Inschrift umgeben ist: Plus valuit cunctis etwas tiefer zu werten.
Joannis voce praeconis || En agne Di lollit
gut crimina mundi. Auffallend ist die Be-
kleidung des oberen Randes mit rotem Sammet.
Die Seitenwände haben als Bekleidung fol-
gende Elfenbeinreliefs: 1. Christus in der
Mandorla, links und rechts überreicht ein
Engel ein Buch und Kreuzzepter, wonach
Christus langt (oder vielleicht Petrus und
Paulus), weiterhin zwei andere Engel mit
Schriftrolle. An der Langseite 2. Die Ver-
kündigung. 3. Geburt Christi (der Vorgang ist
122) »Mitteilungen der k. k. Zentral-Kommission«
XV (1870), Taf. II, Fig. 1 u. 2, S. XXX ff. Darnach
bei Otte, >Kunstarchäologie« I, 149. Kraus,
»Geschichte der christlichen Kunst« II, 1, 463. Ro-
hault de Fleury pl. 348. Vergl. »Mitteilungen der
Zentral-Kommission« XVIII, 1667. Westwood,
1. c. p. 457.
Hier wie dort die
gleichen, fast fratzenhaften Gesichter mit den
Löchern als Augensterne, die enganliegende
Gewandung mit dem kleinlichen Gefältel und
den fliegenden Zipfeln.123)
Unter den zahlreichen Elfenbeinwerken
aus dem XL bis XIII. Jahrh., welche sich in
österreichischen Klöstern und Kirchen, vorab
in Agram, Klosterneuburg, Salzburg, Seiten-
stetten erhalten haben, bilden die Reliefs der
beiden Melker Altärchen beachtenswerte, wenn
auch nicht die schönsten Arbeiten.l24)
12S) Abb. »Mitteilungen« a. a. O., Taf. I. Ro-
ll au lt de Fleury pl, 349. Vergl. auch »Jahrbuch
der k. k. Zentral-Kommission« II, 132. Kraus a.a.O.
462. West wo od 1. c. 456.
rli) Über die österreichischen Elfenbeinwerke,
welche 1873 auf der Wiener Ausstellung zahlreich
vorhanden waren, siehe »Mitteilungen« XVIII, 168 ff.