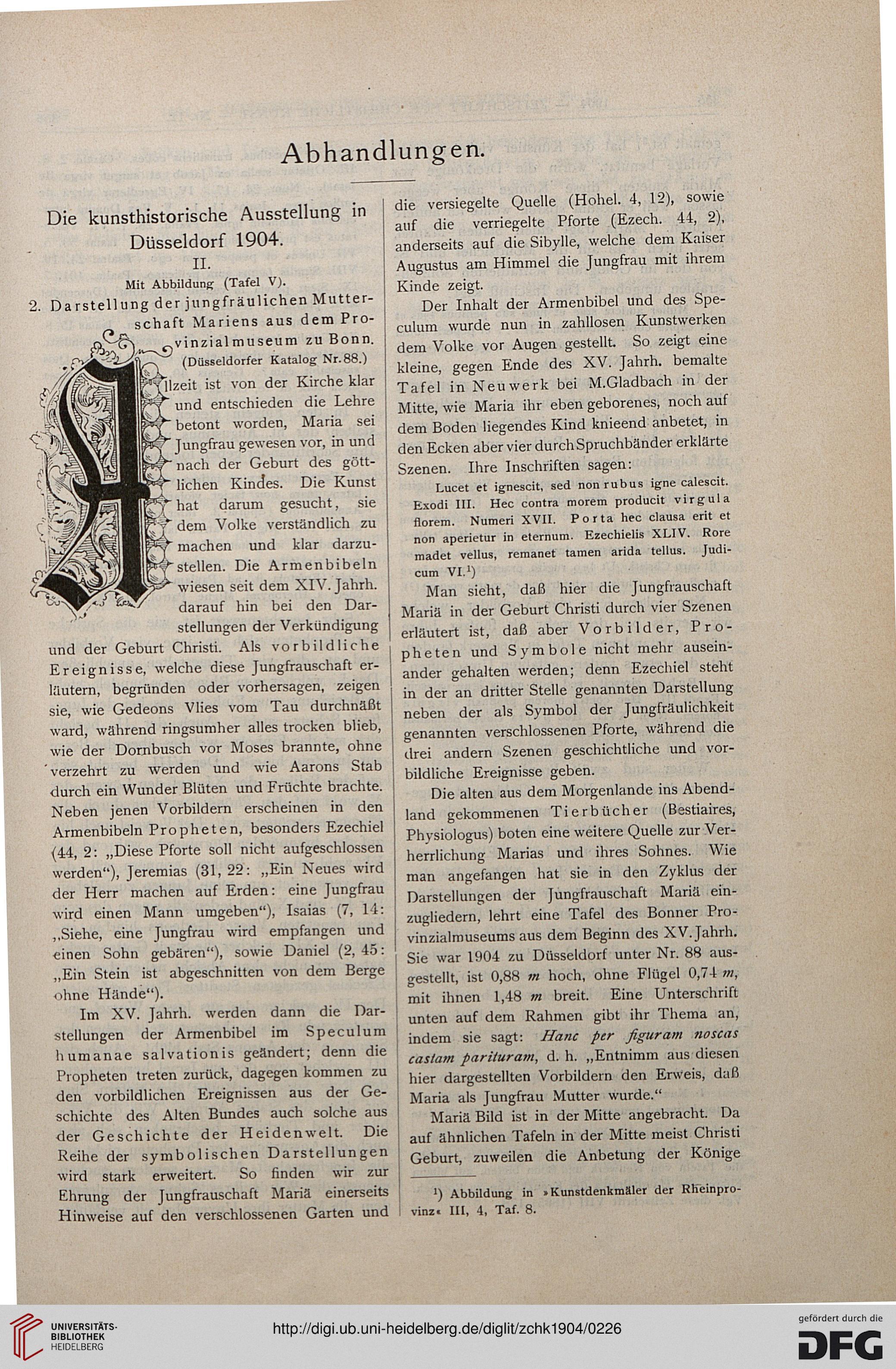Abhandlungen.
Die kunsthistorische Ausstellung in
Düsseldorf 1904.
IL
Mit Abbildung (Tafel V).
2. Darstellung der jung fraulichen Mutter-
schaft Mariens aus dem Pro-
vinzialmuseum zu Bonn.
(Düsseldorfer Katalog Nr. 88.)
fllzeit ist von der Kirche klar
und entschieden die Lehre
betont worden, Maria sei
' Jungfrau gewesen vor, in und
' nach der Geburt des gött-
lichen Kindes. Die Kunst
hat darum gesucht, sie
dem Volke verständlich zu
machen und klar darzu-
stellen. Die Armenbibeln
wiesen seit dem XIV. Jahrh.
darauf hin bei den Dar-
stellungen der Verkündigung
und der Geburt Christi. Als vorbildliche
Ereignisse, welche diese Jungfrauschaft er-
läutern, begründen oder vorhersagen, zeigen
sie, wie Gedeons Vlies vom Tau durchnäßt
ward, während ringsumher alles trocken blieb,
wie der Dornbusch vor Moses brannte, ohne
verzehrt zu werden und wie Aarons Stab
durch ein Wunder Blüten und Früchte brachte.
Neben jenen Vorbildern erscheinen in den
Armenbibeln Propheten, besonders Ezechiel
(44, 2: „Diese Pforte soll nicht aufgeschlossen
werden"), Jeremias (31, 22: „Ein Neues wird
der Herr machen auf Erden: eine Jungfrau
wird einen Mann umgeben"), Isaias (7, 14:
,.Siehe, eine Jungfrau wird empfangen und
einen Sohn gebären"), sowie Daniel (2, 45:
„Ein Stein ist abgeschnitten von dem Berge
ohne Hände").
Im XV. Jahrh. werden dann die Dar-
stellungen der Armenbibel im Speculum
humanae salvationis geändert; denn die
Propheten treten zurück, dagegen kommen zu
den vorbildlichen Ereignissen aus der Ge-
schichte des Alten Bundes auch solche aus
der Geschichte der Heidenwelt. Die
Reihe der symbolischen Darstellungen
wird stark erweitert. So finden wir zur
Ehrung der Jungfrauschaft Maria einerseits
Hinweise auf den verschlossenen Garten und
die versiegelte Quelle (Hohel. 4, 12), sowie
auf die verriegelte Pforte (Ezech. 44, 2),
anderseits auf die Sibylle, welche dem Kaiser
Augustus am Himmel die Jungfrau mit ihrem
Kinde zeigt.
Der Inhalt der Armenbibel und des Spe-
culum wurde nun in zahllosen Kunstwerken
dem Volke vor Augen gestellt. So zeigt eine
kleine, gegen Ende des XV. Jahrh. bemalte
Tafel in Neu werk bei M.Gladbach in der
Mitte, wie Maria ihr eben geborenes, noch auf
dem Boden liegendes Kind knieend anbetet, in
den Ecken aber vier durch Spruchbänder erklärte
Szenen. Ihre Inschriften sagen:
Lucet et ignescit, sed nonrubus igne calescit.
Exodi III. Hec contra morem producit virgula
fiorem. Numeri XVII. Porta hec clausa erit et
non aperietur in eternum. Ezechielis XLIV. Rore
madet vellus, remanet tarnen arida tellus. Judi-
cum VI.1)
Man sieht, daß hier die Jungfrauschaft
Maria in der Geburt Christi durch vier Szenen
erläutert ist, daß aber Vorbilder, Pro-
pheten und Symbole nicht mehr ausein-
ander gehalten werden; denn Ezechiel steht
in der an dritter Stelle genannten Darstellung
neben der als Symbol der Jungfräulichkeit
genannten verschlossenen Pforte, während die
drei andern Szenen geschichtliche und vor-
bildliche Ereignisse geben.
Die alten aus dem Morgenlande ins Abend-
land gekommenen Tierbücher (Bestiaires,
Physiologus) boten eine weitere Quelle zur Ver-
herrlichung Marias und ihres Sohnes. Wie
man angefangen hat sie in den Zyklus der
Darstellungen der Jungfrauschaft Maria ein-
zugliedern, lehrt eine Tafel des Bonner Pro-
vinzialmuseums aus dem Beginn des XV. Jahrh.
Sie war 1904 zu Düsseldorf unter Nr. 88 aus-
gestellt, ist 0,88 m hoch, ohne Flügel 0,74 in,
mit ihnen 1,48 m breit. Eine Unterschrift
unten auf dem Rahmen gibt ihr Thema an,
indem sie sagt: Hatte per figuram noscas
castam pariluram, d. h. „Entnimm aus diesen
hier dargestellten Vorbildern den Erweis, daß
Maria als Jungfrau Mutter wurde."
Maria Bild ist in der Mitte angebracht. Da
auf ähnlichen Tafeln in der Mitte meist Christi
Geburt, zuweilen die Anbetung der Könige
') Abbildung in »Kunstdenkmäler der Rheinpro-
vinz« III, 4, Taf. 8.
Die kunsthistorische Ausstellung in
Düsseldorf 1904.
IL
Mit Abbildung (Tafel V).
2. Darstellung der jung fraulichen Mutter-
schaft Mariens aus dem Pro-
vinzialmuseum zu Bonn.
(Düsseldorfer Katalog Nr. 88.)
fllzeit ist von der Kirche klar
und entschieden die Lehre
betont worden, Maria sei
' Jungfrau gewesen vor, in und
' nach der Geburt des gött-
lichen Kindes. Die Kunst
hat darum gesucht, sie
dem Volke verständlich zu
machen und klar darzu-
stellen. Die Armenbibeln
wiesen seit dem XIV. Jahrh.
darauf hin bei den Dar-
stellungen der Verkündigung
und der Geburt Christi. Als vorbildliche
Ereignisse, welche diese Jungfrauschaft er-
läutern, begründen oder vorhersagen, zeigen
sie, wie Gedeons Vlies vom Tau durchnäßt
ward, während ringsumher alles trocken blieb,
wie der Dornbusch vor Moses brannte, ohne
verzehrt zu werden und wie Aarons Stab
durch ein Wunder Blüten und Früchte brachte.
Neben jenen Vorbildern erscheinen in den
Armenbibeln Propheten, besonders Ezechiel
(44, 2: „Diese Pforte soll nicht aufgeschlossen
werden"), Jeremias (31, 22: „Ein Neues wird
der Herr machen auf Erden: eine Jungfrau
wird einen Mann umgeben"), Isaias (7, 14:
,.Siehe, eine Jungfrau wird empfangen und
einen Sohn gebären"), sowie Daniel (2, 45:
„Ein Stein ist abgeschnitten von dem Berge
ohne Hände").
Im XV. Jahrh. werden dann die Dar-
stellungen der Armenbibel im Speculum
humanae salvationis geändert; denn die
Propheten treten zurück, dagegen kommen zu
den vorbildlichen Ereignissen aus der Ge-
schichte des Alten Bundes auch solche aus
der Geschichte der Heidenwelt. Die
Reihe der symbolischen Darstellungen
wird stark erweitert. So finden wir zur
Ehrung der Jungfrauschaft Maria einerseits
Hinweise auf den verschlossenen Garten und
die versiegelte Quelle (Hohel. 4, 12), sowie
auf die verriegelte Pforte (Ezech. 44, 2),
anderseits auf die Sibylle, welche dem Kaiser
Augustus am Himmel die Jungfrau mit ihrem
Kinde zeigt.
Der Inhalt der Armenbibel und des Spe-
culum wurde nun in zahllosen Kunstwerken
dem Volke vor Augen gestellt. So zeigt eine
kleine, gegen Ende des XV. Jahrh. bemalte
Tafel in Neu werk bei M.Gladbach in der
Mitte, wie Maria ihr eben geborenes, noch auf
dem Boden liegendes Kind knieend anbetet, in
den Ecken aber vier durch Spruchbänder erklärte
Szenen. Ihre Inschriften sagen:
Lucet et ignescit, sed nonrubus igne calescit.
Exodi III. Hec contra morem producit virgula
fiorem. Numeri XVII. Porta hec clausa erit et
non aperietur in eternum. Ezechielis XLIV. Rore
madet vellus, remanet tarnen arida tellus. Judi-
cum VI.1)
Man sieht, daß hier die Jungfrauschaft
Maria in der Geburt Christi durch vier Szenen
erläutert ist, daß aber Vorbilder, Pro-
pheten und Symbole nicht mehr ausein-
ander gehalten werden; denn Ezechiel steht
in der an dritter Stelle genannten Darstellung
neben der als Symbol der Jungfräulichkeit
genannten verschlossenen Pforte, während die
drei andern Szenen geschichtliche und vor-
bildliche Ereignisse geben.
Die alten aus dem Morgenlande ins Abend-
land gekommenen Tierbücher (Bestiaires,
Physiologus) boten eine weitere Quelle zur Ver-
herrlichung Marias und ihres Sohnes. Wie
man angefangen hat sie in den Zyklus der
Darstellungen der Jungfrauschaft Maria ein-
zugliedern, lehrt eine Tafel des Bonner Pro-
vinzialmuseums aus dem Beginn des XV. Jahrh.
Sie war 1904 zu Düsseldorf unter Nr. 88 aus-
gestellt, ist 0,88 m hoch, ohne Flügel 0,74 in,
mit ihnen 1,48 m breit. Eine Unterschrift
unten auf dem Rahmen gibt ihr Thema an,
indem sie sagt: Hatte per figuram noscas
castam pariluram, d. h. „Entnimm aus diesen
hier dargestellten Vorbildern den Erweis, daß
Maria als Jungfrau Mutter wurde."
Maria Bild ist in der Mitte angebracht. Da
auf ähnlichen Tafeln in der Mitte meist Christi
Geburt, zuweilen die Anbetung der Könige
') Abbildung in »Kunstdenkmäler der Rheinpro-
vinz« III, 4, Taf. 8.