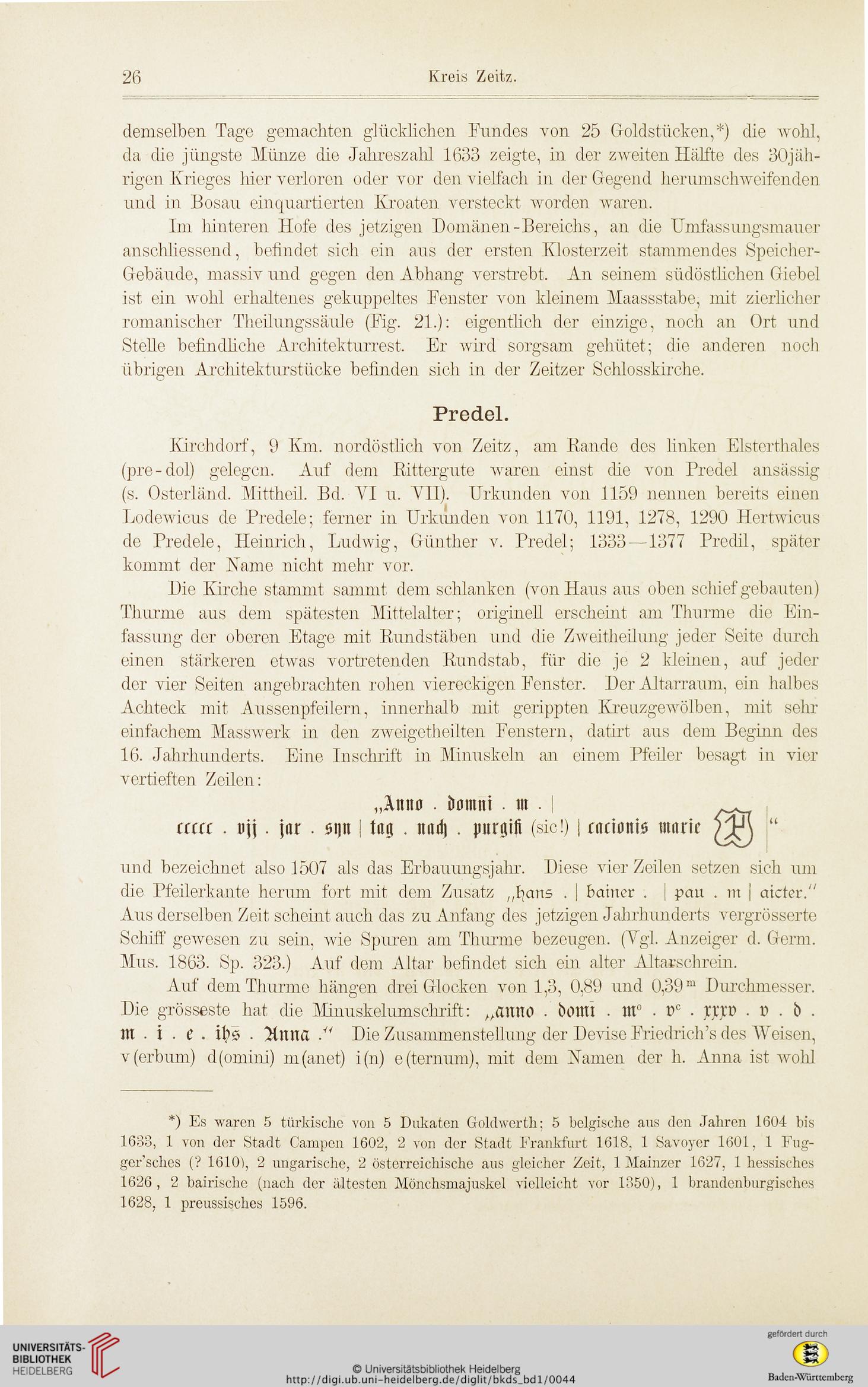26
Kreis Zeitz.
demselben Tage gemachten glücklichen Fundes von 25 Goldstücken,*) die wohl,
da die jüngste Münze die Jahreszahl 1633 zeigte, in der zweiten Hälfte des 30jäh-
rigen Krieges hier verloren oder vor den vielfach in der Gegend herumschweifenden
und in Bosau ein quartierten Kroaten versteckt worden waren.
Im hinteren Hofe des jetzigen Domänen-Bereichs, an die Umfassungsmauer
anschliessend, befindet sich ein aus der ersten Klosterzeit stammendes Speicher-
Gebäude, massiv und gegen den Abhang verstrebt. An seinem südöstlichen Giebel
ist ein wohl erhaltenes gekuppeltes Fenster von kleinem Maassstabe, mit zierlicher
romanischer Theilungssäule (Fig. 21.): eigentlich der einzige, noch an Ort und
Stelle befindliche Architekturrest. Er wird sorgsam gehütet; die anderen noch
übrigen Architekturstücke befinden sich in der Zeitzer Schlosskirche.
Predel.
Kirchdorf, 9 Km. nordöstlich von Zeitz, am Rande des linken Elsterthales
(pre-dol) gelegen. Auf dem Rittergute waren einst die von Predel ansässig
(s. Osterländ. Mittheil. Bd. YI u. YII). Urkunden von 1159 nennen bereits einen
Lodewicus de Predele; ferner in Urkunden von 1170, 1191, 1278, 1290 Hertwicus
de Predele, Heinrich, Ludwig, Günther v. Predel; 1333 —1377 Predil, später
kommt der Karne nicht mehr vor.
Die Kirche stammt sammt dem schlanken (von Haus aus oben schief gebauten)
Thurme aus dem spätesten Mittelalter; originell erscheint am Thurme die Ein-
fassung der oberen Etage mit Rundstäben und die Zweitheilung jeder Seite durch
einen stärkeren etwas vortretenden Rundstab, für che je 2 kleinen, auf jeder
der vier Seiten angebrachten rohen viereckigen Fenster. Der Altarraum, ein halbes
Achteck mit Aussenpfeilern, innerhalb mit gerippten Kreuzgewölben, mit sehr
einfachem Masswerk in den zweigeteilten Fenstern, datirt aus dem Beginn des
16. Jahrhunderts. Eine Inschrift in Minuskeln an einem Pfeiler besagt in vier
vertieften Zeilen:
„Anno . öomnt . nt . |
ccccc . I)jj . jnr . öi|it | tag . muJ) . purgifi (sic!) | rnriflniö tmtrtc
und bezeichnet also 1507 als das Erbauungsjahr. Diese vier Zeilen setzen sich um
die Pfeilerkante hemm fort mit dem Zusatz „bans . | bainer . | pau . nt | aicter."
Aus derselben Zeit scheint auch das zu Anfang des jetzigen Jahrhunderts vergrösserte
Schiff gewesen zu sein, wie Spuren am Thurme bezeugen. (Ygl. Anzeiger d. Germ.
Mus. 1863. Sp. 323.) Auf dem Altar befindet sich ein alter Altarschrein.
Auf dem Thurme hängen drei Glocken von 1,3, 0,89 und 0,39m Durchmesser.
Die grösseste hat die Minuskelumschrift: „amto . öoittt . m° . t)c . rrr» . 1) . b .
VX . i . e . ibs . Mn na .H Die Zusammenstellung der Devise Friedrich’s des Weisen,
v(erbum) d(omini) m(anet) i(n) e(ternum), mit dem Kamen der h. Anna ist wohl
*) Es waren 5 türkische von 5 Dukaten Goldwerth; 5 belgische aus den Jahren 1604 bis
1633, 1 von der Stadt Campen 1602, 2 von der Stadt Frankfurt 1618. 1 Savoyer 1601, 1 Fug-
ger’sches (? 1610), 2 ungarische, 2 österreichische aus gleicher Zeit, 1 Mainzer 1627, 1 hessisches
1626, 2 bairische (nach der ältesten Mönchsmajuskel vielleicht vor 1350), 1 brandenburgisches
1628, 1 preussisches 1596.
Kreis Zeitz.
demselben Tage gemachten glücklichen Fundes von 25 Goldstücken,*) die wohl,
da die jüngste Münze die Jahreszahl 1633 zeigte, in der zweiten Hälfte des 30jäh-
rigen Krieges hier verloren oder vor den vielfach in der Gegend herumschweifenden
und in Bosau ein quartierten Kroaten versteckt worden waren.
Im hinteren Hofe des jetzigen Domänen-Bereichs, an die Umfassungsmauer
anschliessend, befindet sich ein aus der ersten Klosterzeit stammendes Speicher-
Gebäude, massiv und gegen den Abhang verstrebt. An seinem südöstlichen Giebel
ist ein wohl erhaltenes gekuppeltes Fenster von kleinem Maassstabe, mit zierlicher
romanischer Theilungssäule (Fig. 21.): eigentlich der einzige, noch an Ort und
Stelle befindliche Architekturrest. Er wird sorgsam gehütet; die anderen noch
übrigen Architekturstücke befinden sich in der Zeitzer Schlosskirche.
Predel.
Kirchdorf, 9 Km. nordöstlich von Zeitz, am Rande des linken Elsterthales
(pre-dol) gelegen. Auf dem Rittergute waren einst die von Predel ansässig
(s. Osterländ. Mittheil. Bd. YI u. YII). Urkunden von 1159 nennen bereits einen
Lodewicus de Predele; ferner in Urkunden von 1170, 1191, 1278, 1290 Hertwicus
de Predele, Heinrich, Ludwig, Günther v. Predel; 1333 —1377 Predil, später
kommt der Karne nicht mehr vor.
Die Kirche stammt sammt dem schlanken (von Haus aus oben schief gebauten)
Thurme aus dem spätesten Mittelalter; originell erscheint am Thurme die Ein-
fassung der oberen Etage mit Rundstäben und die Zweitheilung jeder Seite durch
einen stärkeren etwas vortretenden Rundstab, für che je 2 kleinen, auf jeder
der vier Seiten angebrachten rohen viereckigen Fenster. Der Altarraum, ein halbes
Achteck mit Aussenpfeilern, innerhalb mit gerippten Kreuzgewölben, mit sehr
einfachem Masswerk in den zweigeteilten Fenstern, datirt aus dem Beginn des
16. Jahrhunderts. Eine Inschrift in Minuskeln an einem Pfeiler besagt in vier
vertieften Zeilen:
„Anno . öomnt . nt . |
ccccc . I)jj . jnr . öi|it | tag . muJ) . purgifi (sic!) | rnriflniö tmtrtc
und bezeichnet also 1507 als das Erbauungsjahr. Diese vier Zeilen setzen sich um
die Pfeilerkante hemm fort mit dem Zusatz „bans . | bainer . | pau . nt | aicter."
Aus derselben Zeit scheint auch das zu Anfang des jetzigen Jahrhunderts vergrösserte
Schiff gewesen zu sein, wie Spuren am Thurme bezeugen. (Ygl. Anzeiger d. Germ.
Mus. 1863. Sp. 323.) Auf dem Altar befindet sich ein alter Altarschrein.
Auf dem Thurme hängen drei Glocken von 1,3, 0,89 und 0,39m Durchmesser.
Die grösseste hat die Minuskelumschrift: „amto . öoittt . m° . t)c . rrr» . 1) . b .
VX . i . e . ibs . Mn na .H Die Zusammenstellung der Devise Friedrich’s des Weisen,
v(erbum) d(omini) m(anet) i(n) e(ternum), mit dem Kamen der h. Anna ist wohl
*) Es waren 5 türkische von 5 Dukaten Goldwerth; 5 belgische aus den Jahren 1604 bis
1633, 1 von der Stadt Campen 1602, 2 von der Stadt Frankfurt 1618. 1 Savoyer 1601, 1 Fug-
ger’sches (? 1610), 2 ungarische, 2 österreichische aus gleicher Zeit, 1 Mainzer 1627, 1 hessisches
1626, 2 bairische (nach der ältesten Mönchsmajuskel vielleicht vor 1350), 1 brandenburgisches
1628, 1 preussisches 1596.