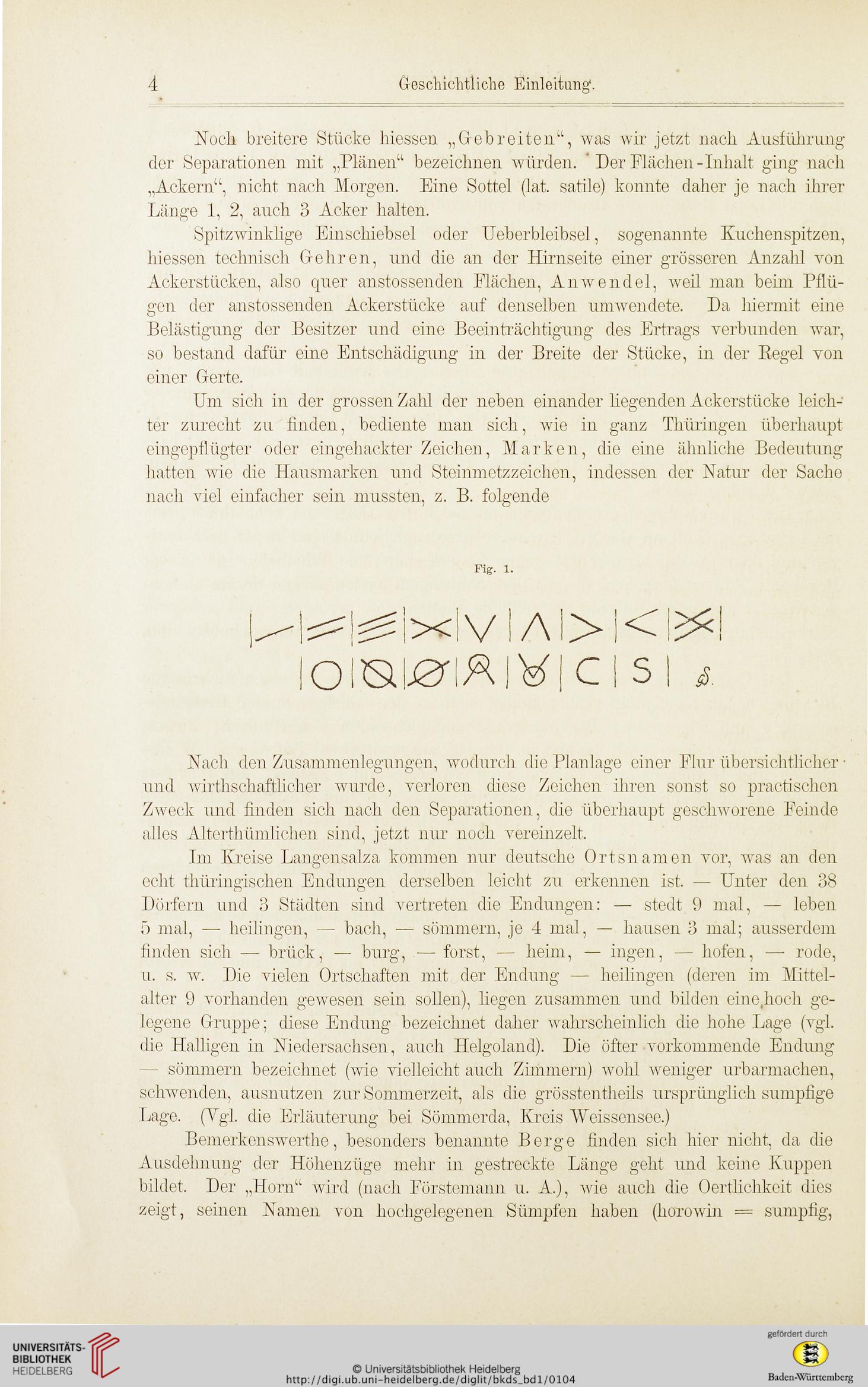4
Geschichtliche Einleitung*.
Noch breitere Stücke Messen „Grebreiten“, was wir jetzt nach Ausführung
der Separationen mit „Plänen“ bezeichnen würden. Der Flächen -Inhalt ging nach
„Ackern“, nicht nach Morgen. Eine Sottel (lat. sattle) konnte daher je nach ihrer
Länge 1, 2, auch 3 Acker halten.
Spitzwinklige Einschiebsel oder Ueberbleibsel, sogenannte Kuchenspitzen,
Messen technisch Gehren, und die an der Hirnseite einer grösseren Anzahl von
Ackerstücken, also quer anstossenden Elächen, Anwendel, weil man beim Pflü-
gen der anstossenden Ackerstücke auf denselben umwendete. Da hiermit eine
Belästigung der Besitzer und eine Beeinträchtigung des Ertrags verbunden war,
so bestand dafür eine Entschädigung in der Breite der Stücke, in der Begel von
einer Gerte.
Um sich in der grossen Zalil der neben einander hegenden Ackerstücke leich-
ter zurecht zu finden, bediente man sich, wie in ganz Thüringen überhaupt
eingepflügter oder eingehackter Zeichen, Marken, die eine ähnliche Bedeutung
hatten wie die Hausmarken und Steinmetzzeichen, indessen der Natur der Sache
nach viel einfacher sein mussten, z. B. folgende
Fig. 1.
^|^|x!v!Al>l<!^
OUSIJ31ÄIVI c 1 S | g.
Nach den Zusammenlegungen, wodurch die Planlage einer Flur übersichtlicher ■
und wirthschaftlicher wurde, verloren diese Zeichen ihren sonst so practischen
Zweck und finden sich nach den Separationen, die überhaupt geschworene Feinde
alles Alterthümlichen sind, jetzt nur noch vereinzelt.
Im Kreise Langensalza kommen nur deutsche Ortsnamen vor, was an den
echt thüringischen Endungen derselben leicht zu erkennen ist. — Unter den 38
Dörfern und 3 Städten sind vertreten die Endungen: — stedt 9 mal, — leben
5 mal, — heilingen, — bach, — sommern, je 4 mal, — hausen 3 mal; ausserdem
finden sich — brück, — bürg, — forst, — heim, — ingen, — hofen, — rode,
u. s. w. Die vielen Ortschaften mit der Endung — heihngen (deren im Mittel-
alter 9 vorhanden gewesen sein sollen), liegen zusammen und bilden eine(hoch ge-
legene Gruppe; diese Endung bezeichnet daher wahrscheinlich die hohe Lage (vgl.
die HaMgen in Niedersachsen, auch Helgoland). Die öfter vorkommende Endung
- sommern bezeichnet (wie vielleicht auch Zimmern) wohl weniger Urbarmachen,
schwenden, ausnutzen zur Sommerzeit, als die grösstentheils ursprünglich sumpfige
Lage. (Vgl. die Erläuterung bei Sömmerda, Kreis Weissensee.)
Bemerkenswerthe, besonders benannte Berge linden sich hier nicht, da die
Ausdehnung der Höhenzüge mehr in gestreckte Länge geht und keine Kuppen
bildet. Der „Horn“ wird (nach Eörstemann u. A.), wie auch die Oertliehkeit dies
zeigt, seinen Namen von hochgelegenen Sümpfen haben (horowin = sumpfig,
Geschichtliche Einleitung*.
Noch breitere Stücke Messen „Grebreiten“, was wir jetzt nach Ausführung
der Separationen mit „Plänen“ bezeichnen würden. Der Flächen -Inhalt ging nach
„Ackern“, nicht nach Morgen. Eine Sottel (lat. sattle) konnte daher je nach ihrer
Länge 1, 2, auch 3 Acker halten.
Spitzwinklige Einschiebsel oder Ueberbleibsel, sogenannte Kuchenspitzen,
Messen technisch Gehren, und die an der Hirnseite einer grösseren Anzahl von
Ackerstücken, also quer anstossenden Elächen, Anwendel, weil man beim Pflü-
gen der anstossenden Ackerstücke auf denselben umwendete. Da hiermit eine
Belästigung der Besitzer und eine Beeinträchtigung des Ertrags verbunden war,
so bestand dafür eine Entschädigung in der Breite der Stücke, in der Begel von
einer Gerte.
Um sich in der grossen Zalil der neben einander hegenden Ackerstücke leich-
ter zurecht zu finden, bediente man sich, wie in ganz Thüringen überhaupt
eingepflügter oder eingehackter Zeichen, Marken, die eine ähnliche Bedeutung
hatten wie die Hausmarken und Steinmetzzeichen, indessen der Natur der Sache
nach viel einfacher sein mussten, z. B. folgende
Fig. 1.
^|^|x!v!Al>l<!^
OUSIJ31ÄIVI c 1 S | g.
Nach den Zusammenlegungen, wodurch die Planlage einer Flur übersichtlicher ■
und wirthschaftlicher wurde, verloren diese Zeichen ihren sonst so practischen
Zweck und finden sich nach den Separationen, die überhaupt geschworene Feinde
alles Alterthümlichen sind, jetzt nur noch vereinzelt.
Im Kreise Langensalza kommen nur deutsche Ortsnamen vor, was an den
echt thüringischen Endungen derselben leicht zu erkennen ist. — Unter den 38
Dörfern und 3 Städten sind vertreten die Endungen: — stedt 9 mal, — leben
5 mal, — heilingen, — bach, — sommern, je 4 mal, — hausen 3 mal; ausserdem
finden sich — brück, — bürg, — forst, — heim, — ingen, — hofen, — rode,
u. s. w. Die vielen Ortschaften mit der Endung — heihngen (deren im Mittel-
alter 9 vorhanden gewesen sein sollen), liegen zusammen und bilden eine(hoch ge-
legene Gruppe; diese Endung bezeichnet daher wahrscheinlich die hohe Lage (vgl.
die HaMgen in Niedersachsen, auch Helgoland). Die öfter vorkommende Endung
- sommern bezeichnet (wie vielleicht auch Zimmern) wohl weniger Urbarmachen,
schwenden, ausnutzen zur Sommerzeit, als die grösstentheils ursprünglich sumpfige
Lage. (Vgl. die Erläuterung bei Sömmerda, Kreis Weissensee.)
Bemerkenswerthe, besonders benannte Berge linden sich hier nicht, da die
Ausdehnung der Höhenzüge mehr in gestreckte Länge geht und keine Kuppen
bildet. Der „Horn“ wird (nach Eörstemann u. A.), wie auch die Oertliehkeit dies
zeigt, seinen Namen von hochgelegenen Sümpfen haben (horowin = sumpfig,