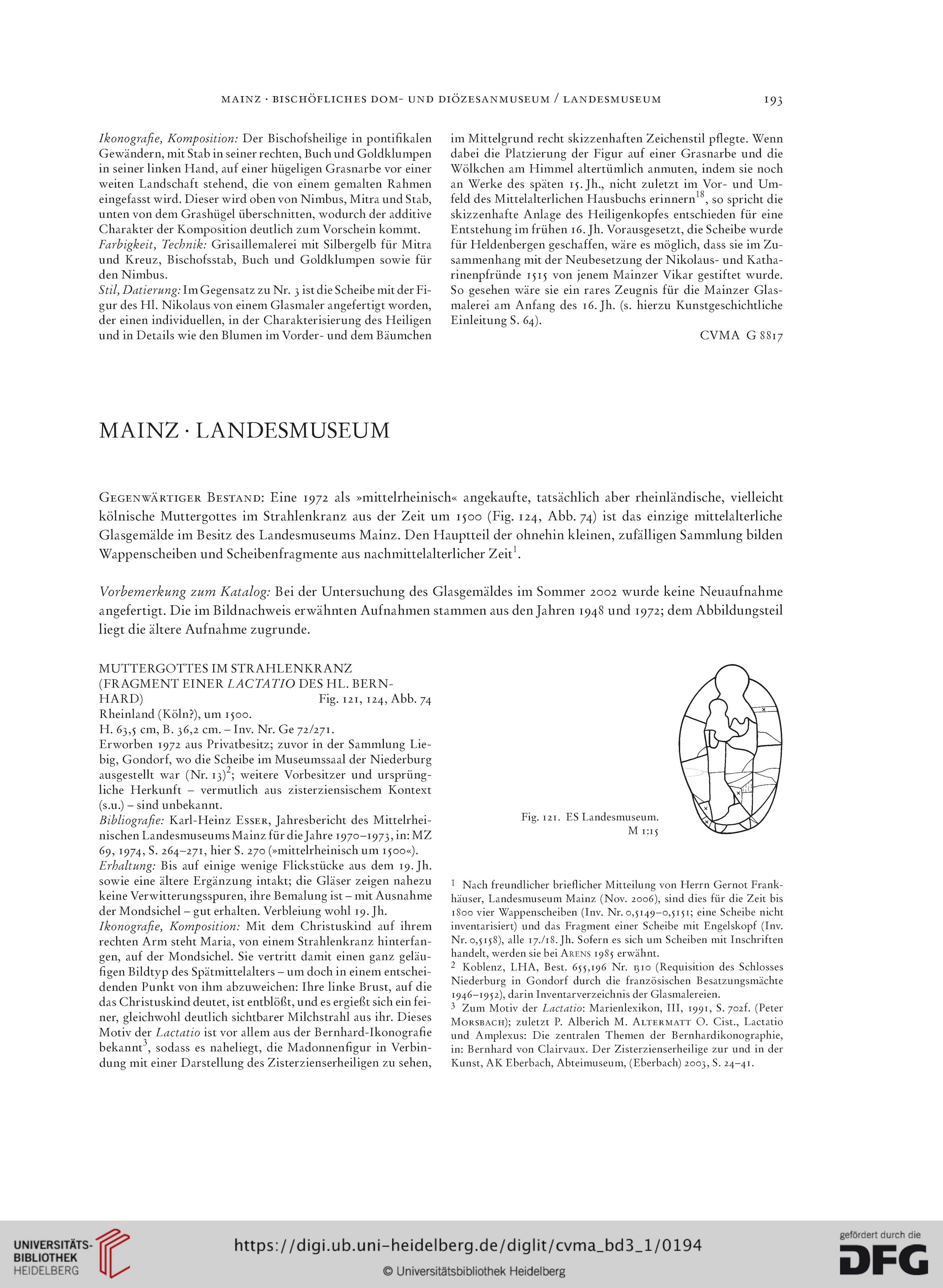MAINZ • BISCHÖFLICHES DOM- UND DIÖZESANMUSEUM / LANDESMUSEUM
I93
Ikonografie, Komposition: Der Bischofsheilige in pontifikalen
Gewändern, mit Stab in seiner rechten, Buch und Goldklumpen
in seiner linken Hand, auf einer hügeligen Grasnarbe vor einer
weiten Landschaft stehend, die von einem gemalten Rahmen
eingefasst wird. Dieser wird oben von Nimbus, Mitra und Stab,
unten von dem Grashügel überschnitten, wodurch der additive
Charakter der Komposition deutlich zum Vorschein kommt.
Farbigkeit, Technik: Grisaillemalerei mit Silbergelb für Mitra
und Kreuz, Bischofsstab, Buch und Goldklumpen sowie für
den Nimbus.
Stil, Datierung: Im Gegensatz zu Nr. 3 ist die Scheibe mit der Fi-
gur des Hl. Nikolaus von einem Glasmaler angefertigt worden,
der einen individuellen, in der Charakterisierung des Heiligen
und in Details wie den Blumen im Vorder- und dem Bäumchen
im Mittelgrund recht skizzenhaften Zeichenstil pflegte. Wenn
dabei die Platzierung der Figur auf einer Grasnarbe und die
Wölkchen am Himmel altertümlich anmuten, indem sie noch
an Werke des späten 15. Jh., nicht zuletzt im Vor- und Um-
feld des Mittelalterlichen Hausbuchs erinnern18, so spricht die
skizzenhafte Anlage des Heiligenkopfes entschieden für eine
Entstehung im frühen 16. Jh. Vorausgesetzt, die Scheibe wurde
für Heldenbergen geschaffen, wäre es möglich, dass sie im Zu-
sammenhang mit der Neubesetzung der Nikolaus- und Katha-
rinenpfründe 1515 von jenem Mainzer Vikar gestiftet wurde.
So gesehen wäre sie ein rares Zeugnis für die Mainzer Glas-
malerei am Anfang des i6.Jh. (s. hierzu Kunstgeschichtliche
Einleitung S. 64).
CVMA G 8817
MAINZ • LANDESMUSEUM
Gegenwärtiger Bestand: Eine 1972 als »mittelrheinisch« angekaufte, tatsächlich aber rheinländische, vielleicht
kölnische Muttergottes im Strahlenkranz aus der Zeit um 1500 (Fig. 124, Abb. 74) ist das einzige mittelalterliche
Glasgemälde im Besitz des Landesmuseums Mainz. Den Hauptteil der ohnehin kleinen, zufälligen Sammlung bilden
Wappenscheiben und Scheibenfragmente aus nachmittelalterlicher Zeit1.
Vorbemerkung zum Katalog: Bei der Untersuchung des Glasgemäldes im Sommer 2002 wurde keine Neuaufnahme
angefertigt. Die im Bildnachweis erwähnten Aufnahmen stammen aus den Jahren 1948 und 1972; dem Abbildungsteil
liegt die ältere Aufnahme zugrunde.
MUTTERGOTTES IM STRAHLENKRANZ
(FRAGMENT EINER LACTATIO DES HL. BERN-
HARD) Fig. 121, 124, Abb. 74
Rheinland (Köln?), um 1500.
H. 63,5 cm, B. 36,2 cm. - Inv. Nr. Ge 72/271.
Erworben 1972 aus Privatbesitz; zuvor in der Sammlung Lie-
big, Gondorf, wo die Scheibe im Museumssaal der Niederburg
ausgestellt war (Nr. 13) ; weitere Vorbesitzer und ursprüng-
liche Herkunft - vermutlich aus zisterziensischem Kontext
(s.u.) - sind unbekannt.
Bibliografie: Karl-Heinz Esser, Jahresbericht des Mittelrhei-
nischen Landesmuseums Mainz für die Jahre 1970-1973, in: MZ
69, 1974, S. 264-271, hier S. 270 (»mittelrheinisch um 1500«).
Erhaltung: Bis auf einige wenige Flickstücke aus dem 19. Jh.
sowie eine ältere Ergänzung intakt; die Gläser zeigen nahezu
keine Verwitterungsspuren, ihre Bemalung ist - mit Ausnahme
der Mondsichel - gut erhalten. Verbleiung wohl 19. Jh.
Ikonografie, Komposition: Mit dem Christuskind auf ihrem
rechten Arm steht Maria, von einem Strahlenkranz hinterfan-
gen, auf der Mondsichel. Sie vertritt damit einen ganz geläu-
figen Bildtyp des Spätmittelalters - um doch in einem entschei-
denden Punkt von ihm abzuweichen: Ihre linke Brust, auf die
das Christuskind deutet, ist entblößt, und es ergießt sich ein fei-
ner, gleichwohl deutlich sichtbarer Milchstrahl aus ihr. Dieses
Motiv der Lactatio ist vor allem aus der Bernhard-Ikonografie
bekannt3, sodass es naheliegt, die Madonnenfigur in Verbin-
dung mit einer Darstellung des Zisterzienserheiligen zu sehen,
Fig. 121.
ES Landesmuseum.
M 1:15
1 Nach freundlicher brieflicher Mitteilung von Herrn Gernot Frank-
häuser, Landesmuseum Mainz (Nov. 2006), sind dies für die Zeit bis
1800 vier Wappenscheiben (Inv. Nr. 0,5149-0,5151; eine Scheibe nicht
inventarisiert) und das Fragment einer Scheibe mit Engelskopf (Inv.
Nr. 0,5158), alle 17.Z18.Jh. Sofern es sich um Scheiben mit Inschriften
handelt, werden sie bei Arens 1985 erwähnt.
2 Koblenz, LHA, Best. 655,196 Nr. 510 (Requisition des Schlosses
Niederburg in Gondorf durch die französischen Besatzungsmächte
1946-1952), darin Inventarverzeichnis der Glasmalereien.
3 Zum Motiv der Lactatio'. Marienlexikon, III, 1991, S. 702!. (Peter
Morsbach); zuletzt P. Alberich M. Altermatt O. Cist., Lactatio
und Amplexus: Die zentralen Themen der Bernhardikonographie,
in: Bernhard von Clairvaux. Der Zisterzienserheilige zur und in der
Kunst, AK Eberbach, Abteimtisetim, (Eberbach) 2003, S. 24-41.
I93
Ikonografie, Komposition: Der Bischofsheilige in pontifikalen
Gewändern, mit Stab in seiner rechten, Buch und Goldklumpen
in seiner linken Hand, auf einer hügeligen Grasnarbe vor einer
weiten Landschaft stehend, die von einem gemalten Rahmen
eingefasst wird. Dieser wird oben von Nimbus, Mitra und Stab,
unten von dem Grashügel überschnitten, wodurch der additive
Charakter der Komposition deutlich zum Vorschein kommt.
Farbigkeit, Technik: Grisaillemalerei mit Silbergelb für Mitra
und Kreuz, Bischofsstab, Buch und Goldklumpen sowie für
den Nimbus.
Stil, Datierung: Im Gegensatz zu Nr. 3 ist die Scheibe mit der Fi-
gur des Hl. Nikolaus von einem Glasmaler angefertigt worden,
der einen individuellen, in der Charakterisierung des Heiligen
und in Details wie den Blumen im Vorder- und dem Bäumchen
im Mittelgrund recht skizzenhaften Zeichenstil pflegte. Wenn
dabei die Platzierung der Figur auf einer Grasnarbe und die
Wölkchen am Himmel altertümlich anmuten, indem sie noch
an Werke des späten 15. Jh., nicht zuletzt im Vor- und Um-
feld des Mittelalterlichen Hausbuchs erinnern18, so spricht die
skizzenhafte Anlage des Heiligenkopfes entschieden für eine
Entstehung im frühen 16. Jh. Vorausgesetzt, die Scheibe wurde
für Heldenbergen geschaffen, wäre es möglich, dass sie im Zu-
sammenhang mit der Neubesetzung der Nikolaus- und Katha-
rinenpfründe 1515 von jenem Mainzer Vikar gestiftet wurde.
So gesehen wäre sie ein rares Zeugnis für die Mainzer Glas-
malerei am Anfang des i6.Jh. (s. hierzu Kunstgeschichtliche
Einleitung S. 64).
CVMA G 8817
MAINZ • LANDESMUSEUM
Gegenwärtiger Bestand: Eine 1972 als »mittelrheinisch« angekaufte, tatsächlich aber rheinländische, vielleicht
kölnische Muttergottes im Strahlenkranz aus der Zeit um 1500 (Fig. 124, Abb. 74) ist das einzige mittelalterliche
Glasgemälde im Besitz des Landesmuseums Mainz. Den Hauptteil der ohnehin kleinen, zufälligen Sammlung bilden
Wappenscheiben und Scheibenfragmente aus nachmittelalterlicher Zeit1.
Vorbemerkung zum Katalog: Bei der Untersuchung des Glasgemäldes im Sommer 2002 wurde keine Neuaufnahme
angefertigt. Die im Bildnachweis erwähnten Aufnahmen stammen aus den Jahren 1948 und 1972; dem Abbildungsteil
liegt die ältere Aufnahme zugrunde.
MUTTERGOTTES IM STRAHLENKRANZ
(FRAGMENT EINER LACTATIO DES HL. BERN-
HARD) Fig. 121, 124, Abb. 74
Rheinland (Köln?), um 1500.
H. 63,5 cm, B. 36,2 cm. - Inv. Nr. Ge 72/271.
Erworben 1972 aus Privatbesitz; zuvor in der Sammlung Lie-
big, Gondorf, wo die Scheibe im Museumssaal der Niederburg
ausgestellt war (Nr. 13) ; weitere Vorbesitzer und ursprüng-
liche Herkunft - vermutlich aus zisterziensischem Kontext
(s.u.) - sind unbekannt.
Bibliografie: Karl-Heinz Esser, Jahresbericht des Mittelrhei-
nischen Landesmuseums Mainz für die Jahre 1970-1973, in: MZ
69, 1974, S. 264-271, hier S. 270 (»mittelrheinisch um 1500«).
Erhaltung: Bis auf einige wenige Flickstücke aus dem 19. Jh.
sowie eine ältere Ergänzung intakt; die Gläser zeigen nahezu
keine Verwitterungsspuren, ihre Bemalung ist - mit Ausnahme
der Mondsichel - gut erhalten. Verbleiung wohl 19. Jh.
Ikonografie, Komposition: Mit dem Christuskind auf ihrem
rechten Arm steht Maria, von einem Strahlenkranz hinterfan-
gen, auf der Mondsichel. Sie vertritt damit einen ganz geläu-
figen Bildtyp des Spätmittelalters - um doch in einem entschei-
denden Punkt von ihm abzuweichen: Ihre linke Brust, auf die
das Christuskind deutet, ist entblößt, und es ergießt sich ein fei-
ner, gleichwohl deutlich sichtbarer Milchstrahl aus ihr. Dieses
Motiv der Lactatio ist vor allem aus der Bernhard-Ikonografie
bekannt3, sodass es naheliegt, die Madonnenfigur in Verbin-
dung mit einer Darstellung des Zisterzienserheiligen zu sehen,
Fig. 121.
ES Landesmuseum.
M 1:15
1 Nach freundlicher brieflicher Mitteilung von Herrn Gernot Frank-
häuser, Landesmuseum Mainz (Nov. 2006), sind dies für die Zeit bis
1800 vier Wappenscheiben (Inv. Nr. 0,5149-0,5151; eine Scheibe nicht
inventarisiert) und das Fragment einer Scheibe mit Engelskopf (Inv.
Nr. 0,5158), alle 17.Z18.Jh. Sofern es sich um Scheiben mit Inschriften
handelt, werden sie bei Arens 1985 erwähnt.
2 Koblenz, LHA, Best. 655,196 Nr. 510 (Requisition des Schlosses
Niederburg in Gondorf durch die französischen Besatzungsmächte
1946-1952), darin Inventarverzeichnis der Glasmalereien.
3 Zum Motiv der Lactatio'. Marienlexikon, III, 1991, S. 702!. (Peter
Morsbach); zuletzt P. Alberich M. Altermatt O. Cist., Lactatio
und Amplexus: Die zentralen Themen der Bernhardikonographie,
in: Bernhard von Clairvaux. Der Zisterzienserheilige zur und in der
Kunst, AK Eberbach, Abteimtisetim, (Eberbach) 2003, S. 24-41.