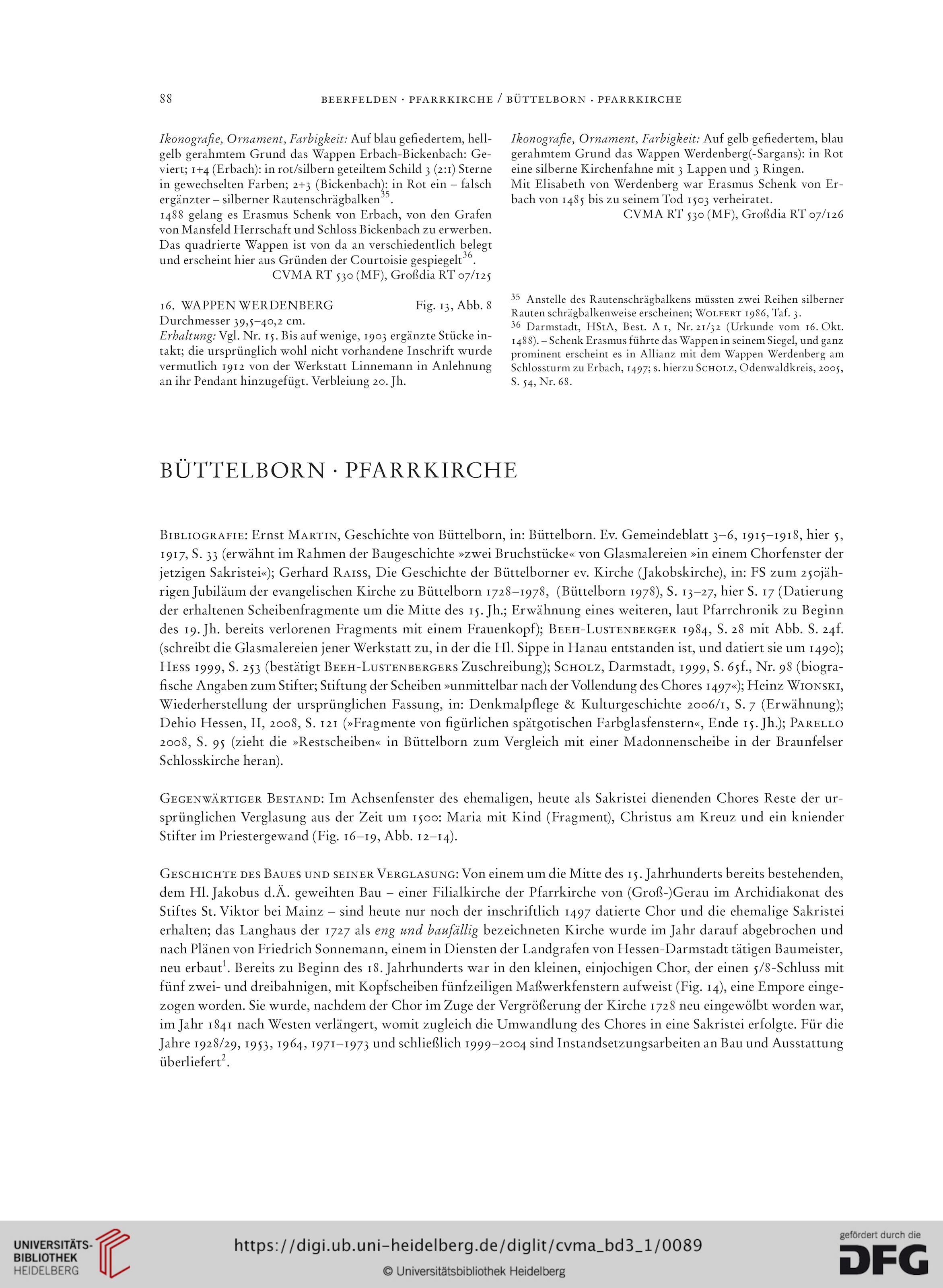88
BEERFELDEN ■ PFARRKIRCHE / BÜTTELBORN • PFARRKIRCHE
Ikonografie, Ornament, Farbigkeit: Auf blau gefiedertem, hell-
gelb gerahmtem Grund das Wappen Erbach-Bickenbach: Ge-
viert; 1+4 (Erbach): in rot/silbern geteiltem Schild 3 (2:1) Sterne
in gewechselten Farben; 2+3 (Bickenbach): in Rot ein - falsch
ergänzter - silberner Rautenschrägbalken35.
1488 gelang es Erasmus Schenk von Erbach, von den Grafen
von Mansfeld Flerrschaft und Schloss Bickenbach zu erwerben.
Das quadrierte Wappen ist von da an verschiedentlich belegt
und erscheint hier aus Gründen der Courtoisie gespiegelt56.
CVMA RT 530 (MF), Großdia RT 07/125
16. WAPPEN WERDENBERG Fig. 13, Abb. 8
Durchmesser 39,5-40,2 cm.
Erhaltung: Vgl. Nr. 15. Bis auf wenige, 1903 ergänzte Stücke in-
takt; die ursprünglich wohl nicht vorhandene Inschrift wurde
vermutlich 1912 von der Werkstatt Linnemann in Anlehnung
an ihr Pendant hinzugefügt. Verbleiung 20. Jh.
Ikonografie, Ornament, Farbigkeit: Auf gelb gefiedertem, blau
gerahmtem Grund das Wappen Werdenberg(-Sargans): in Rot
eine silberne Kirchenfahne mit 3 Lappen und 3 Ringen.
Mit Elisabeth von Werdenberg war Erasmus Schenk von Er-
bach von 1485 bis zu seinem Tod 1503 verheiratet.
CVMA RT 530 (MF), Großdia RT 07/126
35 Anstelle des Rautenschrägbalkens müssten zwei Reihen silberner
Rauten schrägbalkenweise erscheinen; Wolfert 1986, Taf. 3.
36 Darmstadt, HStA, Best. A 1, Nr. 21/32 (Urkunde vom 16. Okt.
1488). - Schenk Erasmus führte das Wappen in seinem Siegel, und ganz
prominent erscheint es in Allianz mit dem Wappen Werdenberg am
Schlossturm zu Erbach, 1497; s. hierzu Scholz, Odenwaldkreis, 2005,
S. 54, Nr. 68.
BÜTTELBORN • PFARRKIRCHE
Bibliografie: Ernst Martin, Geschichte von Büttelborn, in: Büttelborn. Ev. Gemeindeblatt 3-6, 1915-1918, hier 5,
1917, S. 33 (erwähnt im Rahmen der Baugeschichte »zwei Bruchstücke« von Glasmalereien »in einem Chorfenster der
jetzigen Sakristei«); Gerhard Raiss, Die Geschichte der Büttelborner ev. Kirche (Jakobskirche), in: FS zum 2jojäh-
rigen Jubiläum der evangelischen Kirche zu Büttelborn 1728-1978, (Büttelborn 1978), S. 13-27, hier S. 17 (Datierung
der erhaltenen Scheibenfragmente um die Mitte des 15. Jh.; Erwähnung eines weiteren, laut Pfarrchronik zu Beginn
des 19. Jh. bereits verlorenen Fragments mit einem Frauenkopf); Beeh-Lustenberger 1984, S. 28 mit Abb. S. 24b.
(schreibt die Glasmalereien jener Werkstatt zu, in der die Hl. Sippe in Hanau entstanden ist, und datiert sie um 1490);
Hess 1999, S. 253 (bestätigt Beeh-Lustenbergers Zuschreibung); Scholz, Darmstadt, 1999, S. 65L, Nr. 98 (biogra-
fische Angaben zum Stifter; Stiftung der Scheiben »unmittelbar nach der Vollendung des Chores 1497«); Heinz Wionski,
Wiederherstellung der ursprünglichen Fassung, in: Denkmalpflege & Kulturgeschichte 2006/1, S. 7 (Erwähnung);
Dehio Hessen, II, 2008, S. 121 (»Fragmente von figürlichen spätgotischen Farbglasfenstern«, Ende 15. Jh.); Parello
2008, S. 95 (zieht die »Restscheiben« in Büttelborn zum Vergleich mit einer Madonnenscheibe in der Braunfelser
Schlosskirche heran).
Gegenwärtiger Bestand: Im Achsenfenster des ehemaligen, heute als Sakristei dienenden Chores Reste der ur-
sprünglichen Verglasung aus der Zeit um 1500: Maria mit Kind (Fragment), Christus am Kreuz und ein kniender
Stifter im Priestergewand (Fig. 16-19, Abb. 12-14).
Geschichte des Baues und seiner Verglasung: Von einem um die Mitte des 15. Jahrhunderts bereits bestehenden,
dem Hl. Jakobus d.A. geweihten Bau - einer Filialkirche der Pfarrkirche von (Groß-)Gerau im Archidiakonat des
Stiftes St. Viktor bei Mainz - sind heute nur noch der inschriftlich 1497 datierte Chor und die ehemalige Sakristei
erhalten; das Langhaus der 1727 als eng und baufällig bezeichneten Kirche wurde im Jahr darauf abgebrochen und
nach Plänen von Friedrich Sonnemann, einem in Diensten der Landgrafen von Hessen-Darmstadt tätigen Baumeister,
neu erbaut . Bereits zu Beginn des 18. Jahrhunderts war in den kleinen, einjochigen Chor, der einen 5/8-Schluss mit
fünf zwei- und dreibahnigen, mit Kopfscheiben fünfzeiligen Maßwerkfenstern aufweist (Fig. 14), eine Empore einge-
zogen worden. Sie wurde, nachdem der Chor im Zuge der Vergrößerung der Kirche 1728 neu eingewölbt worden war,
im Jahr 1841 nach Westen verlängert, womit zugleich die Umwandlung des Chores in eine Sakristei erfolgte. Für die
Jahre 1928/29, 1953, 1964, 1971-1973 und schließlich 1999-2004 sind Instandsetzungsarbeiten an Bau und Ausstattung
überliefert2.
BEERFELDEN ■ PFARRKIRCHE / BÜTTELBORN • PFARRKIRCHE
Ikonografie, Ornament, Farbigkeit: Auf blau gefiedertem, hell-
gelb gerahmtem Grund das Wappen Erbach-Bickenbach: Ge-
viert; 1+4 (Erbach): in rot/silbern geteiltem Schild 3 (2:1) Sterne
in gewechselten Farben; 2+3 (Bickenbach): in Rot ein - falsch
ergänzter - silberner Rautenschrägbalken35.
1488 gelang es Erasmus Schenk von Erbach, von den Grafen
von Mansfeld Flerrschaft und Schloss Bickenbach zu erwerben.
Das quadrierte Wappen ist von da an verschiedentlich belegt
und erscheint hier aus Gründen der Courtoisie gespiegelt56.
CVMA RT 530 (MF), Großdia RT 07/125
16. WAPPEN WERDENBERG Fig. 13, Abb. 8
Durchmesser 39,5-40,2 cm.
Erhaltung: Vgl. Nr. 15. Bis auf wenige, 1903 ergänzte Stücke in-
takt; die ursprünglich wohl nicht vorhandene Inschrift wurde
vermutlich 1912 von der Werkstatt Linnemann in Anlehnung
an ihr Pendant hinzugefügt. Verbleiung 20. Jh.
Ikonografie, Ornament, Farbigkeit: Auf gelb gefiedertem, blau
gerahmtem Grund das Wappen Werdenberg(-Sargans): in Rot
eine silberne Kirchenfahne mit 3 Lappen und 3 Ringen.
Mit Elisabeth von Werdenberg war Erasmus Schenk von Er-
bach von 1485 bis zu seinem Tod 1503 verheiratet.
CVMA RT 530 (MF), Großdia RT 07/126
35 Anstelle des Rautenschrägbalkens müssten zwei Reihen silberner
Rauten schrägbalkenweise erscheinen; Wolfert 1986, Taf. 3.
36 Darmstadt, HStA, Best. A 1, Nr. 21/32 (Urkunde vom 16. Okt.
1488). - Schenk Erasmus führte das Wappen in seinem Siegel, und ganz
prominent erscheint es in Allianz mit dem Wappen Werdenberg am
Schlossturm zu Erbach, 1497; s. hierzu Scholz, Odenwaldkreis, 2005,
S. 54, Nr. 68.
BÜTTELBORN • PFARRKIRCHE
Bibliografie: Ernst Martin, Geschichte von Büttelborn, in: Büttelborn. Ev. Gemeindeblatt 3-6, 1915-1918, hier 5,
1917, S. 33 (erwähnt im Rahmen der Baugeschichte »zwei Bruchstücke« von Glasmalereien »in einem Chorfenster der
jetzigen Sakristei«); Gerhard Raiss, Die Geschichte der Büttelborner ev. Kirche (Jakobskirche), in: FS zum 2jojäh-
rigen Jubiläum der evangelischen Kirche zu Büttelborn 1728-1978, (Büttelborn 1978), S. 13-27, hier S. 17 (Datierung
der erhaltenen Scheibenfragmente um die Mitte des 15. Jh.; Erwähnung eines weiteren, laut Pfarrchronik zu Beginn
des 19. Jh. bereits verlorenen Fragments mit einem Frauenkopf); Beeh-Lustenberger 1984, S. 28 mit Abb. S. 24b.
(schreibt die Glasmalereien jener Werkstatt zu, in der die Hl. Sippe in Hanau entstanden ist, und datiert sie um 1490);
Hess 1999, S. 253 (bestätigt Beeh-Lustenbergers Zuschreibung); Scholz, Darmstadt, 1999, S. 65L, Nr. 98 (biogra-
fische Angaben zum Stifter; Stiftung der Scheiben »unmittelbar nach der Vollendung des Chores 1497«); Heinz Wionski,
Wiederherstellung der ursprünglichen Fassung, in: Denkmalpflege & Kulturgeschichte 2006/1, S. 7 (Erwähnung);
Dehio Hessen, II, 2008, S. 121 (»Fragmente von figürlichen spätgotischen Farbglasfenstern«, Ende 15. Jh.); Parello
2008, S. 95 (zieht die »Restscheiben« in Büttelborn zum Vergleich mit einer Madonnenscheibe in der Braunfelser
Schlosskirche heran).
Gegenwärtiger Bestand: Im Achsenfenster des ehemaligen, heute als Sakristei dienenden Chores Reste der ur-
sprünglichen Verglasung aus der Zeit um 1500: Maria mit Kind (Fragment), Christus am Kreuz und ein kniender
Stifter im Priestergewand (Fig. 16-19, Abb. 12-14).
Geschichte des Baues und seiner Verglasung: Von einem um die Mitte des 15. Jahrhunderts bereits bestehenden,
dem Hl. Jakobus d.A. geweihten Bau - einer Filialkirche der Pfarrkirche von (Groß-)Gerau im Archidiakonat des
Stiftes St. Viktor bei Mainz - sind heute nur noch der inschriftlich 1497 datierte Chor und die ehemalige Sakristei
erhalten; das Langhaus der 1727 als eng und baufällig bezeichneten Kirche wurde im Jahr darauf abgebrochen und
nach Plänen von Friedrich Sonnemann, einem in Diensten der Landgrafen von Hessen-Darmstadt tätigen Baumeister,
neu erbaut . Bereits zu Beginn des 18. Jahrhunderts war in den kleinen, einjochigen Chor, der einen 5/8-Schluss mit
fünf zwei- und dreibahnigen, mit Kopfscheiben fünfzeiligen Maßwerkfenstern aufweist (Fig. 14), eine Empore einge-
zogen worden. Sie wurde, nachdem der Chor im Zuge der Vergrößerung der Kirche 1728 neu eingewölbt worden war,
im Jahr 1841 nach Westen verlängert, womit zugleich die Umwandlung des Chores in eine Sakristei erfolgte. Für die
Jahre 1928/29, 1953, 1964, 1971-1973 und schließlich 1999-2004 sind Instandsetzungsarbeiten an Bau und Ausstattung
überliefert2.