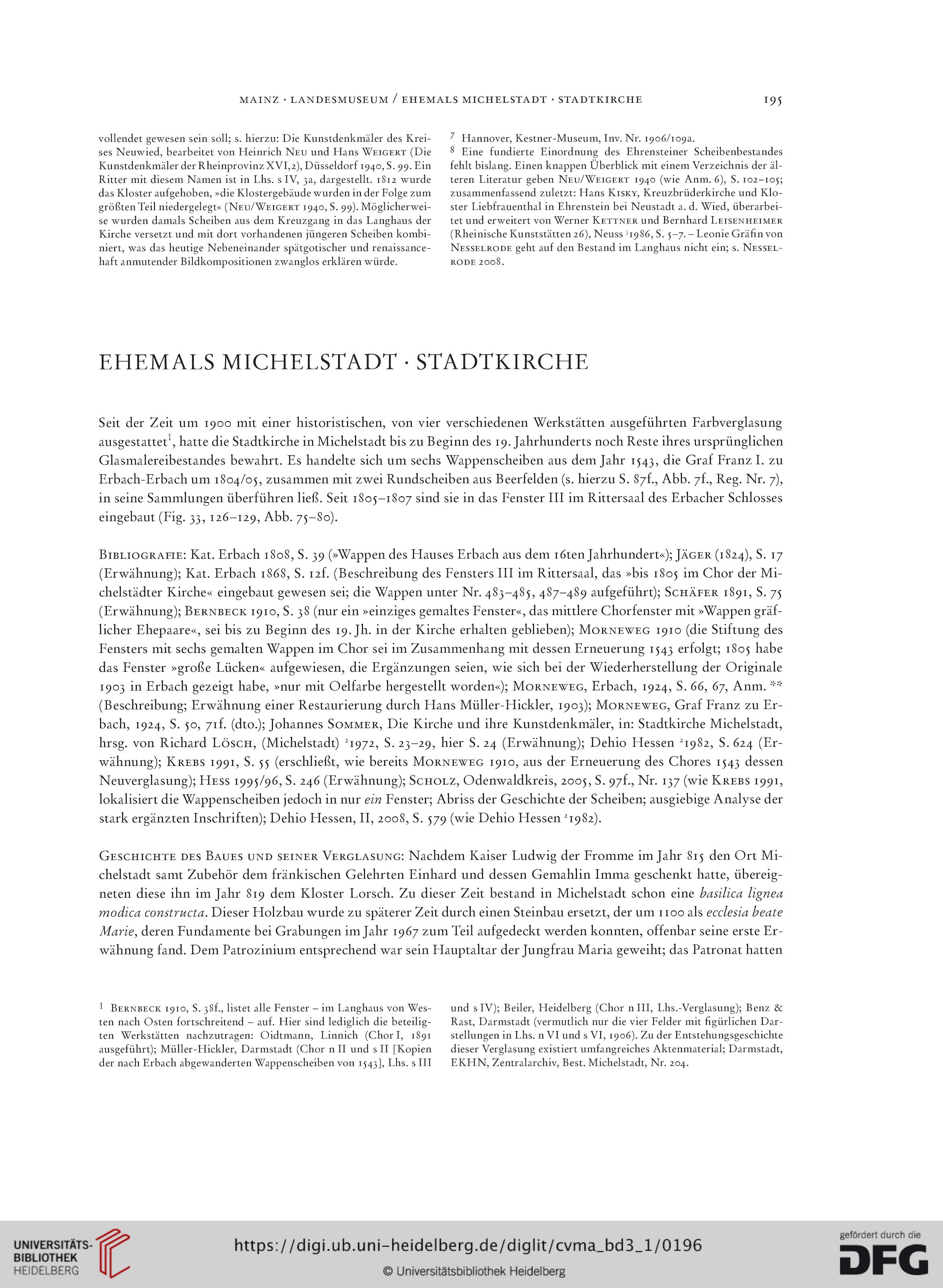MAINZ • LANDESMUSEUM / EHEMALS MICHELSTADT • STADTKIRCHE
05
vollendet gewesen sein soll; s. hierzu: Die Kunstdenkmäler des Krei-
ses Neuwied, bearbeitet von Heinrich Neu und Hans Weigert (Die
Kunstdenkmäler der Rheinprovinz XVI,2), Düsseldorf 1940, S. 99. Ein
Ritter mit diesem Namen ist in Lhs. s IV, 3a, dargestellt. 1812 wurde
das Kloster aufgehoben, »die Klostergebäude wurden in der Folge zum
größten Teil niedergelegt« (Neu/Weigert 1940, S. 99). Möglicherwei-
se wurden damals Scheiben aus dem Kreuzgang in das Langhaus der
Kirche versetzt und mit dort vorhandenen jüngeren Scheiben kombi-
niert, was das heutige Nebeneinander spätgotischer und renaissance-
haft anmutender Bildkompositionen zwanglos erklären würde.
7 Hannover, Kestner-Museum, Inv. Nr. ijoG/xoya.
8 Eine fundierte Einordnung des Ehrensteiner Scheibenbestandes
fehlt bislang. Einen knappen Überblick mit einem Verzeichnis der äl-
teren Literatur geben Neu/Weigert 1940 (wie Anm. 6), S. 102-105;
zusammenfassend zuletzt: Hans Kisky, Kreuzbrüderkirche und Klo-
ster Liebfrauenthal in Ehrenstein bei Neustadt a. d. Wied, überarbei-
tet und erweitert von Werner Kettner und Bernhard Leisenheimer
(Rheinische Kunststätten 26), Neuss 31986, S. 5-7. - Leonie Gräfin von
Nesselrode geht auf den Bestand im Langhaus nicht ein; s. Nessel-
rode 2008.
EHEMALS MICHELSTADT • STADTKIRCHE
Seit der Zeit um 1900 mit einer historistischen, von vier verschiedenen Werkstätten ausgeführten Farbverglasung
ausgestattet1, hatte die Stadtkirche in Michelstadt bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch Reste ihres ursprünglichen
Glasmalereibestandes bewahrt. Es handelte sich um sechs Wappenscheiben aus dem Jahr 1543, die Graf Franz I. zu
Erbach-Erbach um 1804/05, zusammen mit zwei Rundscheiben aus Beerfelden (s. hierzu S. 87L, Abb. 7E, Reg. Nr. 7),
in seine Sammlungen überführen ließ. Seit 1805-1807 sind sie in das Fenster III im Rittersaal des Erbacher Schlosses
eingebaut (Fig. 33, 126-129, Abb. 75-80).
Bibliografie: Kat. Erbach 1808, S. 39 (»Wappen des Hauses Erbach aus dem i6ten Jahrhundert«); Jäger (1824), S. 17
(Erwähnung); Kat. Erbach 1868, S. 12E (Beschreibung des Fensters III im Rittersaal, das »bis 1805 im Chor der Mi-
chelstädter Kirche« eingebaut gewesen sei; die Wappen unter Nr. 483—485, 487-489 aufgeführt); Schäfer 1891, S. 75
(Erwähnung); Bernbeck 1910, S. 38 (nur ein »einziges gemaltes Fenster«, das mittlere Chorfenster mit »Wappen gräf-
licher Ehepaare«, sei bis zu Beginn des 19. Jh. in der Kirche erhalten geblieben); Morneweg 1910 (die Stiftung des
Fensters mit sechs gemalten Wappen im Chor sei im Zusammenhang mit dessen Erneuerung 1543 erfolgt; 1805 habe
das Fenster »große Lücken« aufgewiesen, die Ergänzungen seien, wie sich bei der Wiederherstellung der Originale
1903 in Erbach gezeigt habe, »nur mit Oelfarbe hergestellt worden«); Morneweg, Erbach, 1924, S. 66, 67, Anm.**
(Beschreibung; Erwähnung einer Restaurierung durch Hans Müller-Hickler, 1903); Morneweg, Graf Franz zu Er-
bach, 1924, S. 50, 71 f. (dto.); Johannes Sommer, Die Kirche und ihre Kunstdenkmäler, in: Stadtkirche Michelstadt,
hrsg. von Richard Lösch, (Michelstadt) H972, S. 23-29, hier S. 24 (Erwähnung); Dehio Hessen H982, S. 624 (Er-
wähnung); Krebs 1991, S. 55 (erschließt, wie bereits Morneweg 1910, aus der Erneuerung des Chores 1543 dessen
Neuverglasung); Hess 1995/96, S. 246 (Erwähnung); Scholz, Odenwaldkreis, 2005, S. 97E, Nr. 137 (wie Krebs 1991,
lokalisiert die Wappenscheiben jedoch in nur ein Fenster; Abriss der Geschichte der Scheiben; ausgiebige Analyse der
stark ergänzten Inschriften); Dehio Hessen, II, 2008, S. 579 (wie Dehio Hessen H982).
Geschichte des Baues und seiner Verglasung: Nachdem Kaiser Ludwig der Fromme im Jahr 815 den Ort Mi-
chelstadt samt Zubehör dem fränkischen Gelehrten Einhard und dessen Gemahlin Imma geschenkt hatte, übereig-
neten diese ihn im Jahr 819 dem Kloster Lorsch. Zu dieser Zeit bestand in Michelstadt schon eine basilica lignea
modica constructa. Dieser Holzbau wurde zu späterer Zeit durch einen Steinbau ersetzt, der um 1100 als ecclesia beate
Marie, deren Fundamente bei Grabungen im Jahr 1967 zum Teil aufgedeckt werden konnten, offenbar seine erste Er-
wähnung fand. Dem Patrozinium entsprechend war sein Hauptaltar der Jungfrau Maria geweiht; das Patronat hatten
1 Bernbeck 1910, S. 38L, listet alle Fenster - im Langhaus von Wes-
ten nach Osten fortschreitend - auf. Hier sind lediglich die beteilig-
ten Werkstätten nachzutragen: Oidtmann, Linnich (Chor I, 1891
ausgeführt); Müller-Hickler, Darmstadt (Chor n II und s II [Kopien
der nach Erbach abgewanderten Wappenscheiben von 1543], Lhs. s III
und s IV); Beiler, Heidelberg (Chor n III, Lhs.-Verglasung); Benz &
Rast, Darmstadt (vermutlich nur die vier Felder mit figürlichen Dar-
stellungen in Lhs. n VI und s VI, 1906). Zu der Entstehungsgeschichte
dieser Verglasung existiert umfangreiches Aktenmaterial; Darmstadt,
EKHN, Zentralarchiv, Best. Michelstadt, Nr. 204.
05
vollendet gewesen sein soll; s. hierzu: Die Kunstdenkmäler des Krei-
ses Neuwied, bearbeitet von Heinrich Neu und Hans Weigert (Die
Kunstdenkmäler der Rheinprovinz XVI,2), Düsseldorf 1940, S. 99. Ein
Ritter mit diesem Namen ist in Lhs. s IV, 3a, dargestellt. 1812 wurde
das Kloster aufgehoben, »die Klostergebäude wurden in der Folge zum
größten Teil niedergelegt« (Neu/Weigert 1940, S. 99). Möglicherwei-
se wurden damals Scheiben aus dem Kreuzgang in das Langhaus der
Kirche versetzt und mit dort vorhandenen jüngeren Scheiben kombi-
niert, was das heutige Nebeneinander spätgotischer und renaissance-
haft anmutender Bildkompositionen zwanglos erklären würde.
7 Hannover, Kestner-Museum, Inv. Nr. ijoG/xoya.
8 Eine fundierte Einordnung des Ehrensteiner Scheibenbestandes
fehlt bislang. Einen knappen Überblick mit einem Verzeichnis der äl-
teren Literatur geben Neu/Weigert 1940 (wie Anm. 6), S. 102-105;
zusammenfassend zuletzt: Hans Kisky, Kreuzbrüderkirche und Klo-
ster Liebfrauenthal in Ehrenstein bei Neustadt a. d. Wied, überarbei-
tet und erweitert von Werner Kettner und Bernhard Leisenheimer
(Rheinische Kunststätten 26), Neuss 31986, S. 5-7. - Leonie Gräfin von
Nesselrode geht auf den Bestand im Langhaus nicht ein; s. Nessel-
rode 2008.
EHEMALS MICHELSTADT • STADTKIRCHE
Seit der Zeit um 1900 mit einer historistischen, von vier verschiedenen Werkstätten ausgeführten Farbverglasung
ausgestattet1, hatte die Stadtkirche in Michelstadt bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch Reste ihres ursprünglichen
Glasmalereibestandes bewahrt. Es handelte sich um sechs Wappenscheiben aus dem Jahr 1543, die Graf Franz I. zu
Erbach-Erbach um 1804/05, zusammen mit zwei Rundscheiben aus Beerfelden (s. hierzu S. 87L, Abb. 7E, Reg. Nr. 7),
in seine Sammlungen überführen ließ. Seit 1805-1807 sind sie in das Fenster III im Rittersaal des Erbacher Schlosses
eingebaut (Fig. 33, 126-129, Abb. 75-80).
Bibliografie: Kat. Erbach 1808, S. 39 (»Wappen des Hauses Erbach aus dem i6ten Jahrhundert«); Jäger (1824), S. 17
(Erwähnung); Kat. Erbach 1868, S. 12E (Beschreibung des Fensters III im Rittersaal, das »bis 1805 im Chor der Mi-
chelstädter Kirche« eingebaut gewesen sei; die Wappen unter Nr. 483—485, 487-489 aufgeführt); Schäfer 1891, S. 75
(Erwähnung); Bernbeck 1910, S. 38 (nur ein »einziges gemaltes Fenster«, das mittlere Chorfenster mit »Wappen gräf-
licher Ehepaare«, sei bis zu Beginn des 19. Jh. in der Kirche erhalten geblieben); Morneweg 1910 (die Stiftung des
Fensters mit sechs gemalten Wappen im Chor sei im Zusammenhang mit dessen Erneuerung 1543 erfolgt; 1805 habe
das Fenster »große Lücken« aufgewiesen, die Ergänzungen seien, wie sich bei der Wiederherstellung der Originale
1903 in Erbach gezeigt habe, »nur mit Oelfarbe hergestellt worden«); Morneweg, Erbach, 1924, S. 66, 67, Anm.**
(Beschreibung; Erwähnung einer Restaurierung durch Hans Müller-Hickler, 1903); Morneweg, Graf Franz zu Er-
bach, 1924, S. 50, 71 f. (dto.); Johannes Sommer, Die Kirche und ihre Kunstdenkmäler, in: Stadtkirche Michelstadt,
hrsg. von Richard Lösch, (Michelstadt) H972, S. 23-29, hier S. 24 (Erwähnung); Dehio Hessen H982, S. 624 (Er-
wähnung); Krebs 1991, S. 55 (erschließt, wie bereits Morneweg 1910, aus der Erneuerung des Chores 1543 dessen
Neuverglasung); Hess 1995/96, S. 246 (Erwähnung); Scholz, Odenwaldkreis, 2005, S. 97E, Nr. 137 (wie Krebs 1991,
lokalisiert die Wappenscheiben jedoch in nur ein Fenster; Abriss der Geschichte der Scheiben; ausgiebige Analyse der
stark ergänzten Inschriften); Dehio Hessen, II, 2008, S. 579 (wie Dehio Hessen H982).
Geschichte des Baues und seiner Verglasung: Nachdem Kaiser Ludwig der Fromme im Jahr 815 den Ort Mi-
chelstadt samt Zubehör dem fränkischen Gelehrten Einhard und dessen Gemahlin Imma geschenkt hatte, übereig-
neten diese ihn im Jahr 819 dem Kloster Lorsch. Zu dieser Zeit bestand in Michelstadt schon eine basilica lignea
modica constructa. Dieser Holzbau wurde zu späterer Zeit durch einen Steinbau ersetzt, der um 1100 als ecclesia beate
Marie, deren Fundamente bei Grabungen im Jahr 1967 zum Teil aufgedeckt werden konnten, offenbar seine erste Er-
wähnung fand. Dem Patrozinium entsprechend war sein Hauptaltar der Jungfrau Maria geweiht; das Patronat hatten
1 Bernbeck 1910, S. 38L, listet alle Fenster - im Langhaus von Wes-
ten nach Osten fortschreitend - auf. Hier sind lediglich die beteilig-
ten Werkstätten nachzutragen: Oidtmann, Linnich (Chor I, 1891
ausgeführt); Müller-Hickler, Darmstadt (Chor n II und s II [Kopien
der nach Erbach abgewanderten Wappenscheiben von 1543], Lhs. s III
und s IV); Beiler, Heidelberg (Chor n III, Lhs.-Verglasung); Benz &
Rast, Darmstadt (vermutlich nur die vier Felder mit figürlichen Dar-
stellungen in Lhs. n VI und s VI, 1906). Zu der Entstehungsgeschichte
dieser Verglasung existiert umfangreiches Aktenmaterial; Darmstadt,
EKHN, Zentralarchiv, Best. Michelstadt, Nr. 204.