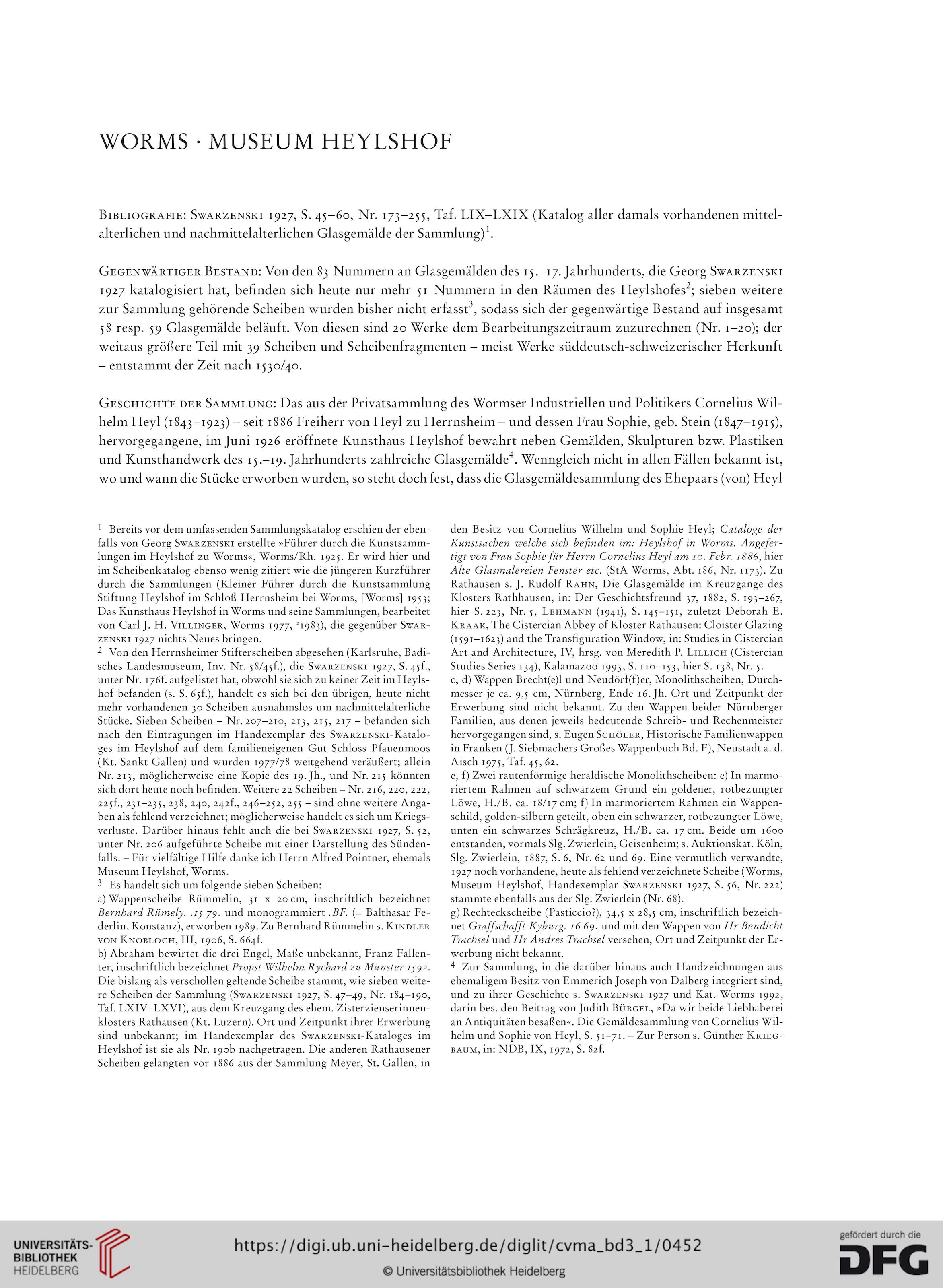WORMS • MUSEUM HEYLSHOF
Bibliografie: Swarzenski 1927, S. 45-60, Nr. 173-255, Taf. LIX-LXIX (Katalog aller damals vorhandenen mittel-
alterlichen und nachmittelalterlichen Glasgemälde der Sammlung)1.
Gegenwärtiger Bestand: Von den 83 Nummern an Glasgemälden des 15.-17. Jahrhunderts, die Georg Swarzenski
1927 katalogisiert hat, befinden sich heute nur mehr 51 Nummern in den Räumen des Heylshofes2; sieben weitere
zur Sammlung gehörende Scheiben wurden bisher nicht erfasst3, sodass sich der gegenwärtige Bestand auf insgesamt
58 resp. 59 Glasgemälde beläuft. Von diesen sind 20 Werke dem Bearbeitungszeitraum zuzurechnen (Nr. 1-20); der
weitaus größere Teil mit 39 Scheiben und Scheibenfragmenten - meist Werke süddeutsch-schweizerischer Herkunft
- entstammt der Zeit nach 1530/40.
Geschichte der Sammlung: Das aus der Privatsammlung des Wormser Industriellen und Politikers Cornelius Wil-
helm Heyl (1843-1923) - seit 1886 Freiherr von Heyl zu Herrnsheim - und dessen Frau Sophie, geb. Stein (1847-1915),
hervorgegangene, im Juni 1926 eröffnete Kunsthaus Heylshof bewahrt neben Gemälden, Skulpturen bzw. Plastiken
und Kunsthandwerk des 15.-19. Jahrhunderts zahlreiche Glasgemälde4. Wenngleich nicht in allen Fällen bekannt ist,
wo und wann die Stücke erworben wurden, so steht doch fest, dass die Glasgemäldesammlung des Ehepaars (von) Heyl
1 Bereits vor dem umfassenden Sammlungskatalog erschien der eben-
falls von Georg Swarzenski erstellte »Führer durch die Kunstsamm-
lungen im Heylshof zu Worms«, Worms/Rh. 1925. Er wird hier und
im Scheibenkatalog ebenso wenig zitiert wie die jüngeren Kurzführer
durch die Sammlungen (Kleiner Führer durch die Kunstsammlung
Stiftung Heylshof im Schloß Herrnsheim bei Worms, [Worms] 1953;
Das Kunsthaus Heylshof in Worms und seine Sammlungen, bearbeitet
von Carl J. H. Villinger, Worms 1977, 2i9§3), die gegenüber Swar-
zenski 1927 nichts Neues bringen.
Von den Herrnsheimer Stifterscheiben abgesehen (Karlsruhe, Badi-
sches Landesmusetim, Inv. Nr. 58/45!.), die Swarzenski 1927, S. 45k,
unter Nr. 176k aufgelistet hat, obwohl sie sich zu keiner Zeit im Heyls-
hof befanden (s. S. 65k), handelt es sich bei den übrigen, heute nicht
mehr vorhandenen 30 Scheiben ausnahmslos um nachmittelalterliche
Stücke. Sieben Scheiben - Nr. 207-210, 213, 215, 217 - befanden sich
nach den Eintragungen im Handexemplar des SwARZENSKi-Katalo-
ges im Heylshof auf dem familieneigenen Gut Schloss Pfauenmoos
(Kt. Sankt Gallen) und wurden 1977/78 weitgehend veräußert; allein
Nr. 213, möglicherweise eine Kopie des 19. Jh., und Nr. 215 könnten
sich dort heute noch befinden. Weitere 22 Scheiben - Nr. 216, 220, 222,
225!., 231-235, 238, 240, 242k, 246-252, 255 - sind ohne weitere Anga-
ben als fehlend verzeichnet; möglicherweise handelt es sich um Kriegs-
verluste. Darüber hinaus fehlt auch die bei Swarzenski 1927, S. 52,
unter Nr. 206 aufgeführte Scheibe mit einer Darstellung des Sünden-
falls. - Für vielfältige Hilfe danke ich Herrn Alfred Pointner, ehemals
Museum Heylshof, Worms.
3 Es handelt sich um folgende sieben Scheiben:
a) Wappenscheibe Rümmelin, 31 x 20 cm, inschriftlich bezeichnet
Bernhard Rümely. .17 79. und monogrammiert .BF. (= Balthasar Fe-
derlin, Konstanz), erworben 1989. Zu Bernhard Rümmelin s. Kindler
von Knobloch, III, 1906, S. 664k
b) Abraham bewirtet die drei Engel, Maße unbekannt, Franz Fallen-
ter, inschriftlich bezeichnet Propst Wilhelm Rychard zu Münster 1592.
Die bislang als verschollen geltende Scheibe stammt, wie sieben weite-
re Scheiben der Sammlung (Swarzenski 1927, S. 47-49, Nr. 184-190,
Taf. LXIV-LXVI), aus dem Kreuzgang des ehern. Zisterzienserinnen-
klosters Rathausen (Kt. Luzern). Ort und Zeitpunkt ihrer Erwerbung
sind unbekannt; im Handexemplar des SwARZENSKi-Kataloges im
Heylshof ist sie als Nr. 190b nachgetragen. Die anderen Rathausener
Scheiben gelangten vor 1886 aus der Sammlung Meyer, St. Gallen, in
den Besitz von Cornelius Wilhelm und Sophie Heyl; Cataloge der
Kunstsachen welche sich befinden im: Heylshof in Worms. Angefer-
tigt von Frau Sophie für Herrn Cornelius Heyl am 10. Febr. 1886, hier
Alte Glasmalereien Fenster etc. (StA Worms, Abt. 186, Nr. 1173). Zu
Rathausen s. J. Rudolf Rahn, Die Glasgemälde im Kreuzgange des
Klosters Rathhausen, in: Der Geschichtsfreund 37, 1882, S. 193-267,
hier S. 223, Nr. 5, Lehmann (1941), S. 145-151, zuletzt Deborah E.
Kraak, The Cistercian Abbey of Kloster Rathausen: Cloister Glazing
(1591-1623) and the Transfiguration Window, in: Studies in Cistercian
Art and Architecture, IV, hrsg. von Meredith P. Lillich (Cistercian
Studies Series 134), Kalamazoo 1993, S. 110-153, hier S. 138, Nr. 5.
c, d) Wappen Brecht(e)l und Neudörf(f)er, Monolithscheiben, Durch-
messer je ca. 9,5 cm, Nürnberg, Ende 16. Jh. Ort und Zeitpunkt der
Erwerbung sind nicht bekannt. Zu den Wappen beider Nürnberger
Familien, aus denen jeweils bedeutende Schreib- und Rechenmeister
hervorgegangen sind, s. Eugen Schöler, Historische Familienwappen
in Franken (J. Siebmachers Großes Wappenbuch Bd. F), Neustadt a. d.
Aisch 1975, Taf. 45, 62.
e, f) Zwei rautenförmige heraldische Monolithscheiben: e) In marmo-
riertem Rahmen auf schwarzem Grund ein goldener, rotbezungter
Löwe, H./B. ca. 18/17 cm; T 411 marmoriertem Rahmen ein Wappen-
schild, golden-silbern geteilt, oben ein schwarzer, rotbezungter Löwe,
unten ein schwarzes Schrägkreuz, H./B. ca. 17cm. Beide um 1600
entstanden, vormals Slg. Zwierlein, Geisenheim; s. Auktionskat. Köln,
Slg. Zwierlein, 1887, S. 6, Nr. 62 und 69. Eine vermutlich verwandte,
1927 noch vorhandene, heute als fehlend verzeichnete Scheibe (Worms,
Museum Heylshof, Handexemplar Swarzenski 1927, S. 56, Nr. 222)
stammte ebenfalls aus der Slg. Zwierlein (Nr. 68).
g) Rechteckscheibe (Pasticcio?), 34,5 x 28,5 cm, inschriftlich bezeich-
net Graffschafft Kyburg. 16 69. und mit den Wappen von Hr Bendicht
Trachsel und Hr Andres Trachsel versehen, Ort und Zeitpunkt der Er-
werbung nicht bekannt.
4 Zur Sammlung, in die darüber hinaus auch Handzeichnungen aus
ehemaligem Besitz von Emmerich Joseph von Dalberg integriert sind,
und zu ihrer Geschichte s. Swarzenski 1927 und Kat. Worms 1992,
darin bes. den Beitrag von Judith Bürgel, »Da wir beide Liebhaberei
an Antiquitäten besaßen«. Die Gemäldesammlung von Cornelius Wil-
helm und Sophie von Heyl, S. 51-71. - Zur Person s. Günther Krieg-
baum, in: NDB, IX, 1972, S. 82k
Bibliografie: Swarzenski 1927, S. 45-60, Nr. 173-255, Taf. LIX-LXIX (Katalog aller damals vorhandenen mittel-
alterlichen und nachmittelalterlichen Glasgemälde der Sammlung)1.
Gegenwärtiger Bestand: Von den 83 Nummern an Glasgemälden des 15.-17. Jahrhunderts, die Georg Swarzenski
1927 katalogisiert hat, befinden sich heute nur mehr 51 Nummern in den Räumen des Heylshofes2; sieben weitere
zur Sammlung gehörende Scheiben wurden bisher nicht erfasst3, sodass sich der gegenwärtige Bestand auf insgesamt
58 resp. 59 Glasgemälde beläuft. Von diesen sind 20 Werke dem Bearbeitungszeitraum zuzurechnen (Nr. 1-20); der
weitaus größere Teil mit 39 Scheiben und Scheibenfragmenten - meist Werke süddeutsch-schweizerischer Herkunft
- entstammt der Zeit nach 1530/40.
Geschichte der Sammlung: Das aus der Privatsammlung des Wormser Industriellen und Politikers Cornelius Wil-
helm Heyl (1843-1923) - seit 1886 Freiherr von Heyl zu Herrnsheim - und dessen Frau Sophie, geb. Stein (1847-1915),
hervorgegangene, im Juni 1926 eröffnete Kunsthaus Heylshof bewahrt neben Gemälden, Skulpturen bzw. Plastiken
und Kunsthandwerk des 15.-19. Jahrhunderts zahlreiche Glasgemälde4. Wenngleich nicht in allen Fällen bekannt ist,
wo und wann die Stücke erworben wurden, so steht doch fest, dass die Glasgemäldesammlung des Ehepaars (von) Heyl
1 Bereits vor dem umfassenden Sammlungskatalog erschien der eben-
falls von Georg Swarzenski erstellte »Führer durch die Kunstsamm-
lungen im Heylshof zu Worms«, Worms/Rh. 1925. Er wird hier und
im Scheibenkatalog ebenso wenig zitiert wie die jüngeren Kurzführer
durch die Sammlungen (Kleiner Führer durch die Kunstsammlung
Stiftung Heylshof im Schloß Herrnsheim bei Worms, [Worms] 1953;
Das Kunsthaus Heylshof in Worms und seine Sammlungen, bearbeitet
von Carl J. H. Villinger, Worms 1977, 2i9§3), die gegenüber Swar-
zenski 1927 nichts Neues bringen.
Von den Herrnsheimer Stifterscheiben abgesehen (Karlsruhe, Badi-
sches Landesmusetim, Inv. Nr. 58/45!.), die Swarzenski 1927, S. 45k,
unter Nr. 176k aufgelistet hat, obwohl sie sich zu keiner Zeit im Heyls-
hof befanden (s. S. 65k), handelt es sich bei den übrigen, heute nicht
mehr vorhandenen 30 Scheiben ausnahmslos um nachmittelalterliche
Stücke. Sieben Scheiben - Nr. 207-210, 213, 215, 217 - befanden sich
nach den Eintragungen im Handexemplar des SwARZENSKi-Katalo-
ges im Heylshof auf dem familieneigenen Gut Schloss Pfauenmoos
(Kt. Sankt Gallen) und wurden 1977/78 weitgehend veräußert; allein
Nr. 213, möglicherweise eine Kopie des 19. Jh., und Nr. 215 könnten
sich dort heute noch befinden. Weitere 22 Scheiben - Nr. 216, 220, 222,
225!., 231-235, 238, 240, 242k, 246-252, 255 - sind ohne weitere Anga-
ben als fehlend verzeichnet; möglicherweise handelt es sich um Kriegs-
verluste. Darüber hinaus fehlt auch die bei Swarzenski 1927, S. 52,
unter Nr. 206 aufgeführte Scheibe mit einer Darstellung des Sünden-
falls. - Für vielfältige Hilfe danke ich Herrn Alfred Pointner, ehemals
Museum Heylshof, Worms.
3 Es handelt sich um folgende sieben Scheiben:
a) Wappenscheibe Rümmelin, 31 x 20 cm, inschriftlich bezeichnet
Bernhard Rümely. .17 79. und monogrammiert .BF. (= Balthasar Fe-
derlin, Konstanz), erworben 1989. Zu Bernhard Rümmelin s. Kindler
von Knobloch, III, 1906, S. 664k
b) Abraham bewirtet die drei Engel, Maße unbekannt, Franz Fallen-
ter, inschriftlich bezeichnet Propst Wilhelm Rychard zu Münster 1592.
Die bislang als verschollen geltende Scheibe stammt, wie sieben weite-
re Scheiben der Sammlung (Swarzenski 1927, S. 47-49, Nr. 184-190,
Taf. LXIV-LXVI), aus dem Kreuzgang des ehern. Zisterzienserinnen-
klosters Rathausen (Kt. Luzern). Ort und Zeitpunkt ihrer Erwerbung
sind unbekannt; im Handexemplar des SwARZENSKi-Kataloges im
Heylshof ist sie als Nr. 190b nachgetragen. Die anderen Rathausener
Scheiben gelangten vor 1886 aus der Sammlung Meyer, St. Gallen, in
den Besitz von Cornelius Wilhelm und Sophie Heyl; Cataloge der
Kunstsachen welche sich befinden im: Heylshof in Worms. Angefer-
tigt von Frau Sophie für Herrn Cornelius Heyl am 10. Febr. 1886, hier
Alte Glasmalereien Fenster etc. (StA Worms, Abt. 186, Nr. 1173). Zu
Rathausen s. J. Rudolf Rahn, Die Glasgemälde im Kreuzgange des
Klosters Rathhausen, in: Der Geschichtsfreund 37, 1882, S. 193-267,
hier S. 223, Nr. 5, Lehmann (1941), S. 145-151, zuletzt Deborah E.
Kraak, The Cistercian Abbey of Kloster Rathausen: Cloister Glazing
(1591-1623) and the Transfiguration Window, in: Studies in Cistercian
Art and Architecture, IV, hrsg. von Meredith P. Lillich (Cistercian
Studies Series 134), Kalamazoo 1993, S. 110-153, hier S. 138, Nr. 5.
c, d) Wappen Brecht(e)l und Neudörf(f)er, Monolithscheiben, Durch-
messer je ca. 9,5 cm, Nürnberg, Ende 16. Jh. Ort und Zeitpunkt der
Erwerbung sind nicht bekannt. Zu den Wappen beider Nürnberger
Familien, aus denen jeweils bedeutende Schreib- und Rechenmeister
hervorgegangen sind, s. Eugen Schöler, Historische Familienwappen
in Franken (J. Siebmachers Großes Wappenbuch Bd. F), Neustadt a. d.
Aisch 1975, Taf. 45, 62.
e, f) Zwei rautenförmige heraldische Monolithscheiben: e) In marmo-
riertem Rahmen auf schwarzem Grund ein goldener, rotbezungter
Löwe, H./B. ca. 18/17 cm; T 411 marmoriertem Rahmen ein Wappen-
schild, golden-silbern geteilt, oben ein schwarzer, rotbezungter Löwe,
unten ein schwarzes Schrägkreuz, H./B. ca. 17cm. Beide um 1600
entstanden, vormals Slg. Zwierlein, Geisenheim; s. Auktionskat. Köln,
Slg. Zwierlein, 1887, S. 6, Nr. 62 und 69. Eine vermutlich verwandte,
1927 noch vorhandene, heute als fehlend verzeichnete Scheibe (Worms,
Museum Heylshof, Handexemplar Swarzenski 1927, S. 56, Nr. 222)
stammte ebenfalls aus der Slg. Zwierlein (Nr. 68).
g) Rechteckscheibe (Pasticcio?), 34,5 x 28,5 cm, inschriftlich bezeich-
net Graffschafft Kyburg. 16 69. und mit den Wappen von Hr Bendicht
Trachsel und Hr Andres Trachsel versehen, Ort und Zeitpunkt der Er-
werbung nicht bekannt.
4 Zur Sammlung, in die darüber hinaus auch Handzeichnungen aus
ehemaligem Besitz von Emmerich Joseph von Dalberg integriert sind,
und zu ihrer Geschichte s. Swarzenski 1927 und Kat. Worms 1992,
darin bes. den Beitrag von Judith Bürgel, »Da wir beide Liebhaberei
an Antiquitäten besaßen«. Die Gemäldesammlung von Cornelius Wil-
helm und Sophie von Heyl, S. 51-71. - Zur Person s. Günther Krieg-
baum, in: NDB, IX, 1972, S. 82k