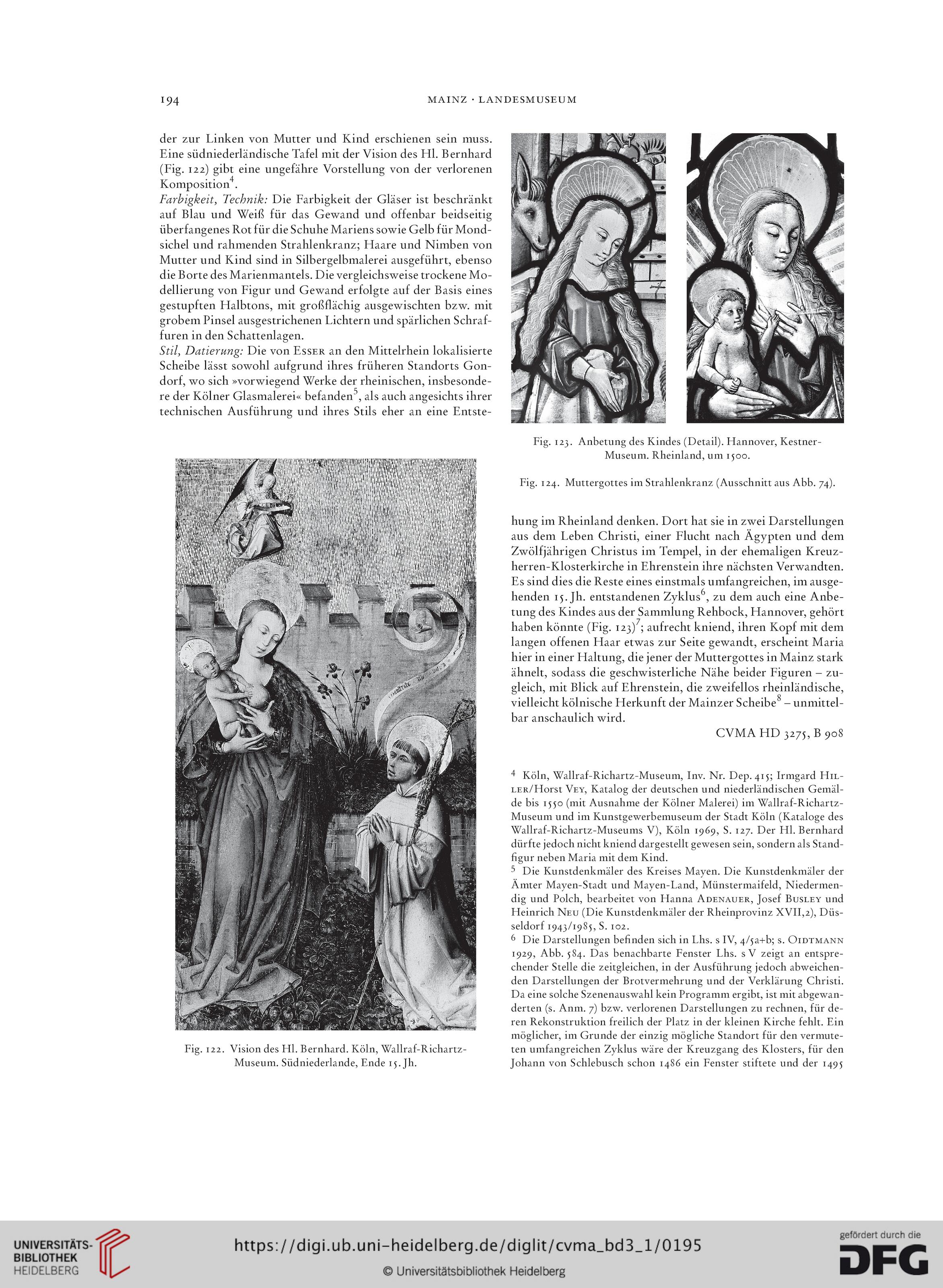i94
MAINZ ■ LANDESMUSEUM
der zur Linken von Mutter und Kind erschienen sein muss.
Eine südniederländische Tafel mit der Vision des Hl. Bernhard
(Fig. 122) gibt eine ungefähre Vorstellung von der verlorenen
Komposition4.
Farbigkeit, Technik: Die Farbigkeit der Gläser ist beschränkt
auf Blau und Weiß für das Gewand und offenbar beidseitig
überfangenes Rot für die Schuhe Mariens sowie Gelb für Mond-
sichel und rahmenden Strahlenkranz; Haare und Nimben von
Mutter und Kind sind in Silbergelbmalerei ausgeführt, ebenso
die Borte des Marienmantels. Die vergleichsweise trockene Mo-
dellierung von Figur und Gewand erfolgte auf der Basis eines
gestupften Halbtons, mit großflächig ausgewischten bzw. mit
grobem Pinsel ausgestrichenen Lichtern und spärlichen Schraf-
furen in den Schattenlagen.
Stil, Datierung: Die von Esser an den Mittelrhein lokalisierte
Scheibe lässt sowohl aufgrund ihres früheren Standorts Gon-
dorf, wo sich »vorwiegend Werke der rheinischen, insbesonde-
re der Kölner Glasmalerei« befanden5, als auch angesichts ihrer
technischen Ausführung und ihres Stils eher an eine Entste-
Fig. 122. Vision des Hl. Bernhard. Köln, Wallraf-Richartz-
Museum. Südniederlande, Ende 15. Jh.
Fig. 123. Anbetung des Kindes (Detail). Hannover, Kestner-
Museum. Rheinland, um 1500.
Fig. 124. Muttergottes im Strahlenkranz (Ausschnitt aus Abb. 74).
hung im Rheinland denken. Dort hat sie in zwei Darstellungen
aus dem Leben Christi, einer Flucht nach Ägypten und dem
Zwölfjährigen Christus im Tempel, in der ehemaligen Kreuz-
herren-Klosterkirche in Ehrenstein ihre nächsten Verwandten.
Es sind dies die Reste eines einstmals umfangreichen, im ausge-
henden 15. Jh. entstandenen Zyklus6, zu dem auch eine Anbe-
tung des Kindes aus der Sammlung Rehbock, Hannover, gehört
haben könnte (Fig. 123)7; aufrecht kniend, ihren Kopf mit dem
langen offenen Haar etwas zur Seite gewandt, erscheint Maria
hier in einer Haltung, die jener der Muttergottes in Mainz stark
ähnelt, sodass die geschwisterliche Nähe beider Figuren - zu-
gleich, mit Blick auf Ehrenstein, die zweifellos rheinländische,
vielleicht kölnische Herkunft der Mainzer Scheibe8 - unmittel-
bar anschaulich wird.
CVMA HD 3275, B 908
4 Köln, Wallraf-Richartz-Museum, Inv. Nr. Dep. 415; Irmgard Hil-
LER/Horst Vey, Katalog der deutschen und niederländischen Gemäl-
de bis 1550 (mit Ausnahme der Kölner Malerei) im Wallraf-Richartz-
Museuni und im Kunstgewerbemuseum der Stadt Köln (Kataloge des
Wallraf-Richartz-Museums V), Köln 1969, S. 127. Der Hl. Bernhard
dürfte jedoch nicht kniend dargestellt gewesen sein, sondern als Stand-
figur neben Maria mit dem Kind.
5 Die Kunstdenkmäler des Kreises Mayen. Die Kunstdenkmäler der
Ämter Mayen-Stadt und Mayen-Land, Münstermaifeld, Niedermen-
dig und Polch, bearbeitet von Hanna Adenauer, Josef Busley und
Heinrich Neu (Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz XVII,2), Düs-
seldorf 1943/1985, S.102.
6 Die Darstellungen befinden sich in Lhs. s IV, 4Aa+b; s. Oidtmann
1929, Abb. 584. Das benachbarte Fenster Lhs. s V zeigt an entspre-
chender Stelle die zeitgleichen, in der Ausführung jedoch abweichen-
den Darstellungen der Brotvermehrung und der Verklärung Christi.
Da eine solche Szenenauswahl kein Programm ergibt, ist mit abgewan-
derten (s. Anm. 7) bzw. verlorenen Darstellungen zu rechnen, für de-
ren Rekonstruktion freilich der Platz in der kleinen Kirche fehlt. Ein
möglicher, im Grunde der einzig mögliche Standort für den vermute-
ten umfangreichen Zyklus wäre der Kreuzgang des Klosters, für den
Johann von Schlebusch schon 1486 ein Fenster stiftete und der 1495
MAINZ ■ LANDESMUSEUM
der zur Linken von Mutter und Kind erschienen sein muss.
Eine südniederländische Tafel mit der Vision des Hl. Bernhard
(Fig. 122) gibt eine ungefähre Vorstellung von der verlorenen
Komposition4.
Farbigkeit, Technik: Die Farbigkeit der Gläser ist beschränkt
auf Blau und Weiß für das Gewand und offenbar beidseitig
überfangenes Rot für die Schuhe Mariens sowie Gelb für Mond-
sichel und rahmenden Strahlenkranz; Haare und Nimben von
Mutter und Kind sind in Silbergelbmalerei ausgeführt, ebenso
die Borte des Marienmantels. Die vergleichsweise trockene Mo-
dellierung von Figur und Gewand erfolgte auf der Basis eines
gestupften Halbtons, mit großflächig ausgewischten bzw. mit
grobem Pinsel ausgestrichenen Lichtern und spärlichen Schraf-
furen in den Schattenlagen.
Stil, Datierung: Die von Esser an den Mittelrhein lokalisierte
Scheibe lässt sowohl aufgrund ihres früheren Standorts Gon-
dorf, wo sich »vorwiegend Werke der rheinischen, insbesonde-
re der Kölner Glasmalerei« befanden5, als auch angesichts ihrer
technischen Ausführung und ihres Stils eher an eine Entste-
Fig. 122. Vision des Hl. Bernhard. Köln, Wallraf-Richartz-
Museum. Südniederlande, Ende 15. Jh.
Fig. 123. Anbetung des Kindes (Detail). Hannover, Kestner-
Museum. Rheinland, um 1500.
Fig. 124. Muttergottes im Strahlenkranz (Ausschnitt aus Abb. 74).
hung im Rheinland denken. Dort hat sie in zwei Darstellungen
aus dem Leben Christi, einer Flucht nach Ägypten und dem
Zwölfjährigen Christus im Tempel, in der ehemaligen Kreuz-
herren-Klosterkirche in Ehrenstein ihre nächsten Verwandten.
Es sind dies die Reste eines einstmals umfangreichen, im ausge-
henden 15. Jh. entstandenen Zyklus6, zu dem auch eine Anbe-
tung des Kindes aus der Sammlung Rehbock, Hannover, gehört
haben könnte (Fig. 123)7; aufrecht kniend, ihren Kopf mit dem
langen offenen Haar etwas zur Seite gewandt, erscheint Maria
hier in einer Haltung, die jener der Muttergottes in Mainz stark
ähnelt, sodass die geschwisterliche Nähe beider Figuren - zu-
gleich, mit Blick auf Ehrenstein, die zweifellos rheinländische,
vielleicht kölnische Herkunft der Mainzer Scheibe8 - unmittel-
bar anschaulich wird.
CVMA HD 3275, B 908
4 Köln, Wallraf-Richartz-Museum, Inv. Nr. Dep. 415; Irmgard Hil-
LER/Horst Vey, Katalog der deutschen und niederländischen Gemäl-
de bis 1550 (mit Ausnahme der Kölner Malerei) im Wallraf-Richartz-
Museuni und im Kunstgewerbemuseum der Stadt Köln (Kataloge des
Wallraf-Richartz-Museums V), Köln 1969, S. 127. Der Hl. Bernhard
dürfte jedoch nicht kniend dargestellt gewesen sein, sondern als Stand-
figur neben Maria mit dem Kind.
5 Die Kunstdenkmäler des Kreises Mayen. Die Kunstdenkmäler der
Ämter Mayen-Stadt und Mayen-Land, Münstermaifeld, Niedermen-
dig und Polch, bearbeitet von Hanna Adenauer, Josef Busley und
Heinrich Neu (Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz XVII,2), Düs-
seldorf 1943/1985, S.102.
6 Die Darstellungen befinden sich in Lhs. s IV, 4Aa+b; s. Oidtmann
1929, Abb. 584. Das benachbarte Fenster Lhs. s V zeigt an entspre-
chender Stelle die zeitgleichen, in der Ausführung jedoch abweichen-
den Darstellungen der Brotvermehrung und der Verklärung Christi.
Da eine solche Szenenauswahl kein Programm ergibt, ist mit abgewan-
derten (s. Anm. 7) bzw. verlorenen Darstellungen zu rechnen, für de-
ren Rekonstruktion freilich der Platz in der kleinen Kirche fehlt. Ein
möglicher, im Grunde der einzig mögliche Standort für den vermute-
ten umfangreichen Zyklus wäre der Kreuzgang des Klosters, für den
Johann von Schlebusch schon 1486 ein Fenster stiftete und der 1495