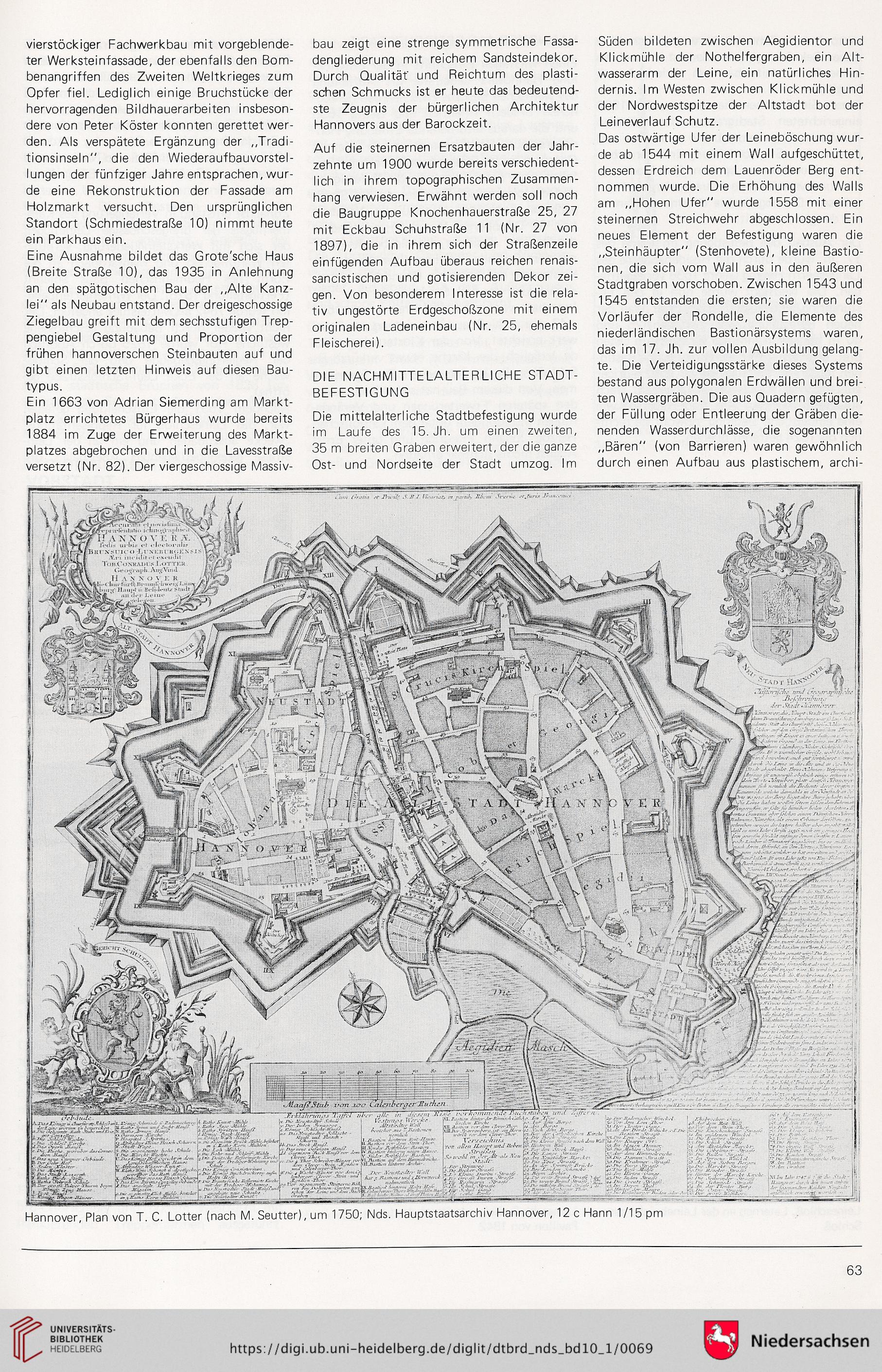vierstöckiger Fachwerkbau mit vorgeblende-
ter Werksteinfassade, der ebenfalls den Bom-
benangriffen des Zweiten Weltkrieges zum
Opfer fiel. Lediglich einige Bruchstücke der
hervorragenden Bildhauerarbeiten insbeson-
dere von Peter Köster konnten gerettet wer-
den. Als verspätete Ergänzung der „Tradi-
tionsinseln", die den Wiederaufbauvorstel-
lungen der fünfziger Jahre entsprachen, wur-
de eine Rekonstruktion der Fassade am
Holzmarkt versucht. Den ursprünglichen
Standort (Schmiedestraße 10) nimmt heute
ein Parkhaus ein.
Eine Ausnahme bildet das Grote'sche Haus
(Breite Straße 10), das 1935 in Anlehnung
an den spätgotischen Bau der „Alte Kanz-
lei" als Neubau entstand. Der dreigeschossige
Ziegelbau greift mit dem sechsstufigen Trep-
pengiebel Gestaltung und Proportion der
frühen hannoverschen Steinbauten auf und
gibt einen letzten Hinweis auf diesen Bau-
typus.
Ein 1663 von Adrian Siemerding am Markt-
platz errichtetes Bürgerhaus wurde bereits
1884 im Zuge der Erweiterung des Markt-
platzes abgebrochen und in die Lavesstraße
versetzt (Nr. 82). Der viergeschossige Massiv-
bau zeigt eine strenge symmetrische Fassa-
dengliederung mit reichem Sandsteindekor.
Durch Qualität’ und Reichtum des plasti-
schen Schmucks ist er heute das bedeutend-
ste Zeugnis der bürgerlichen Architektur
Hannovers aus der Barockzeit.
Auf die steinernen Ersatzbauten der Jahr-
zehnte um 1900 wurde bereits verschiedent-
lich in ihrem topographischen Zusammen-
hang verwiesen. Erwähnt werden soll noch
die Baugruppe Knochenhauerstraße 25, 27
mit Eckbau Schuhstraße 11 (Nr. 27 von
1897), die in ihrem sich der Straßenzeile
einfügenden Aufbau überaus reichen renais-
sancistischen und gotisierenden Dekor zei-
gen. Von besonderem Interesse ist die rela-
tiv ungestörte Erdgeschoßzone mit einem
originalen Ladeneinbau (Nr. 25, ehemals
Fleischerei).
DIE NACHMITTELALTERLICHE STADT-
BEFESTIGUNG
Die mittelalterliche Stadtbefestigung wurde
im Laufe des 15. Jh. um einen zweiten,
35 m breiten Graben erweitert, der die ganze
Ost- und Nordseite der Stadt umzog. Im
Süden bildeten zwischen Aegidientor und
Klickmühle der Nothelfergraben, ein Alt-
wasserarm der Leine, ein natürliches Hin-
dernis. Im Westen zwischen Klickmühle und
der Nordwestspitze der Altstadt bot der
Leineverlauf Schutz.
Das ostwärtige Ufer der Leineböschung wur-
de ab 1544 mit einem Wall aufgeschüttet,
dessen Erdreich dem Lauenröder Berg ent-
nommen wurde. Die Erhöhung des Walls
am „Hohen Ufer" wurde 1558 mit einer
steinernen Streichwehr abgeschlossen. Ein
neues Element der Befestigung waren die
„Steinhäupter" (Stenhovete), kleine Bastio-
nen, die sich vom Wall aus in den äußeren
Stadtgraben vorschoben. Zwischen 1543 und
1545 entstanden die ersten; sie waren die
Vorläufer der Rondelle, die Elemente des
niederländischen Bastionärsystems waren,
das im 17. Jh. zur vollen Ausbildung gelang-
te. Die Verteidigungsstärke dieses Systems
bestand aus polygonalen Erdwällen und brei-
ten Wassergräben. Die aus Quadern gefügten,
der Füllung oder Entleerung der Gräben die-
nenden Wasserdurchlässe, die sogenannten
„Bären" (von Barrieren) waren gewöhnlich
durch einen Aufbau aus plastischem, archi-
Hannover, Plan von T. C. Lotter (nach M. Seutter), um 1750; Nds. Hauptstaatsarchiv Hannover, 12 c Hann 1/15 pm
63
ter Werksteinfassade, der ebenfalls den Bom-
benangriffen des Zweiten Weltkrieges zum
Opfer fiel. Lediglich einige Bruchstücke der
hervorragenden Bildhauerarbeiten insbeson-
dere von Peter Köster konnten gerettet wer-
den. Als verspätete Ergänzung der „Tradi-
tionsinseln", die den Wiederaufbauvorstel-
lungen der fünfziger Jahre entsprachen, wur-
de eine Rekonstruktion der Fassade am
Holzmarkt versucht. Den ursprünglichen
Standort (Schmiedestraße 10) nimmt heute
ein Parkhaus ein.
Eine Ausnahme bildet das Grote'sche Haus
(Breite Straße 10), das 1935 in Anlehnung
an den spätgotischen Bau der „Alte Kanz-
lei" als Neubau entstand. Der dreigeschossige
Ziegelbau greift mit dem sechsstufigen Trep-
pengiebel Gestaltung und Proportion der
frühen hannoverschen Steinbauten auf und
gibt einen letzten Hinweis auf diesen Bau-
typus.
Ein 1663 von Adrian Siemerding am Markt-
platz errichtetes Bürgerhaus wurde bereits
1884 im Zuge der Erweiterung des Markt-
platzes abgebrochen und in die Lavesstraße
versetzt (Nr. 82). Der viergeschossige Massiv-
bau zeigt eine strenge symmetrische Fassa-
dengliederung mit reichem Sandsteindekor.
Durch Qualität’ und Reichtum des plasti-
schen Schmucks ist er heute das bedeutend-
ste Zeugnis der bürgerlichen Architektur
Hannovers aus der Barockzeit.
Auf die steinernen Ersatzbauten der Jahr-
zehnte um 1900 wurde bereits verschiedent-
lich in ihrem topographischen Zusammen-
hang verwiesen. Erwähnt werden soll noch
die Baugruppe Knochenhauerstraße 25, 27
mit Eckbau Schuhstraße 11 (Nr. 27 von
1897), die in ihrem sich der Straßenzeile
einfügenden Aufbau überaus reichen renais-
sancistischen und gotisierenden Dekor zei-
gen. Von besonderem Interesse ist die rela-
tiv ungestörte Erdgeschoßzone mit einem
originalen Ladeneinbau (Nr. 25, ehemals
Fleischerei).
DIE NACHMITTELALTERLICHE STADT-
BEFESTIGUNG
Die mittelalterliche Stadtbefestigung wurde
im Laufe des 15. Jh. um einen zweiten,
35 m breiten Graben erweitert, der die ganze
Ost- und Nordseite der Stadt umzog. Im
Süden bildeten zwischen Aegidientor und
Klickmühle der Nothelfergraben, ein Alt-
wasserarm der Leine, ein natürliches Hin-
dernis. Im Westen zwischen Klickmühle und
der Nordwestspitze der Altstadt bot der
Leineverlauf Schutz.
Das ostwärtige Ufer der Leineböschung wur-
de ab 1544 mit einem Wall aufgeschüttet,
dessen Erdreich dem Lauenröder Berg ent-
nommen wurde. Die Erhöhung des Walls
am „Hohen Ufer" wurde 1558 mit einer
steinernen Streichwehr abgeschlossen. Ein
neues Element der Befestigung waren die
„Steinhäupter" (Stenhovete), kleine Bastio-
nen, die sich vom Wall aus in den äußeren
Stadtgraben vorschoben. Zwischen 1543 und
1545 entstanden die ersten; sie waren die
Vorläufer der Rondelle, die Elemente des
niederländischen Bastionärsystems waren,
das im 17. Jh. zur vollen Ausbildung gelang-
te. Die Verteidigungsstärke dieses Systems
bestand aus polygonalen Erdwällen und brei-
ten Wassergräben. Die aus Quadern gefügten,
der Füllung oder Entleerung der Gräben die-
nenden Wasserdurchlässe, die sogenannten
„Bären" (von Barrieren) waren gewöhnlich
durch einen Aufbau aus plastischem, archi-
Hannover, Plan von T. C. Lotter (nach M. Seutter), um 1750; Nds. Hauptstaatsarchiv Hannover, 12 c Hann 1/15 pm
63