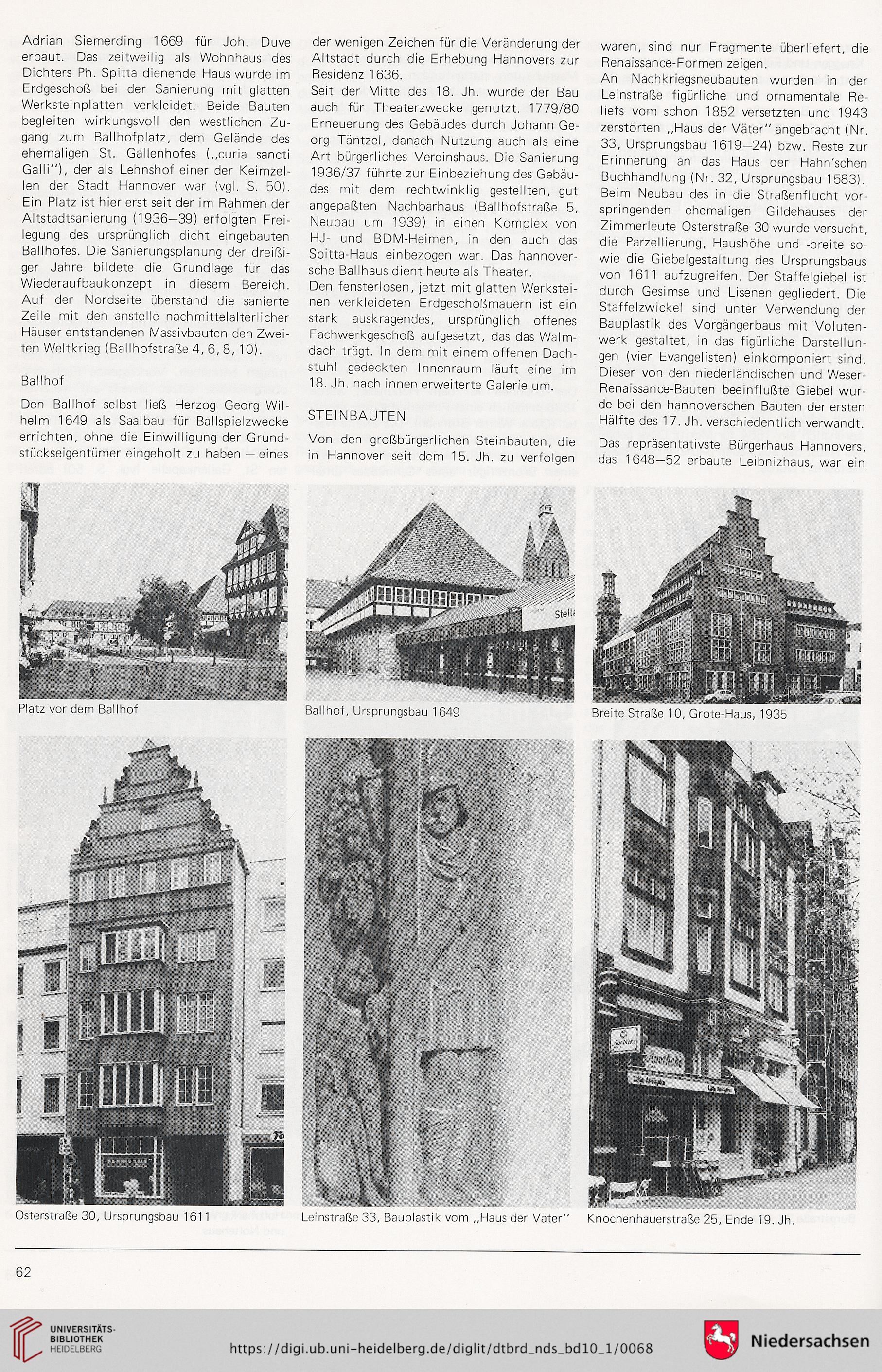Adrian Siemerding 1669 für Joh. Duve
erbaut. Das zeitweilig als Wohnhaus des
Dichters Ph. Spitta dienende Haus wurde im
Erdgeschoß bei der Sanierung mit glatten
Werksteinplatten verkleidet. Beide Bauten
begleiten wirkungsvoll den westlichen Zu-
gang zum Ballhofplatz, dem Gelände des
ehemaligen St. Gallenhofes curia sancti
Galli"), der als Lehnshof einer der Keimzel-
len der Stadt Hannover war (vgl. S. 50).
Ein Platz ist hier erst seit der im Rahmen der
Altstadtsanierung (1936—39) erfolgten Frei-
legung des ursprünglich dicht eingebauten
Ballhofes. Die Sanierungsplanung der dreißi-
ger Jahre bildete die Grundlage für das
Wiederaufbaukonzept in diesem Bereich.
Auf der Nordseite Überstand die sanierte
Zeile mit den anstelle nachmittelalterlicher
Häuser entstandenen Massivbauten den Zwei-
ten Weltkrieg (Ballhofstraße 4, 6, 8, 10).
Ballhof
Den Ballhof selbst ließ Herzog Georg Wil-
helm 1649 als Saalbau für Ballspielzwecke
errichten, ohne die Einwilligung der Grund-
stückseigentümer eingeholt zu haben — eines
Platz vor dem Ballhof
Osterstraße 30, Ursprungsbau 1611
der wenigen Zeichen für die Veränderung der
Altstadt durch die Erhebung Hannovers zur
Residenz 1636.
Seit der Mitte des 18. Jh. wurde der Bau
auch für Theaterzwecke genutzt. 1779/80
Erneuerung des Gebäudes durch Johann Ge-
org Täntzel, danach Nutzung auch als eine
Art bürgerliches Vereinshaus. Die Sanierung
1936/37 führte zur Einbeziehung des Gebäu-
des mit dem rechtwinklig gestellten, gut
angepaßten Nachbarhaus (Ballhofstraße 5,
Neubau um 1939) in einen Komplex von
HJ- und BDM-Heimen, in den auch das
Spitta-Haus einbezogen war. Das hannover-
sche Ballhaus dient heute als Theater.
Den fensterlosen, jetzt mit glatten Werkstei-
nen verkleideten Erdgeschoßmauern ist ein
stark auskragendes, ursprünglich offenes
Fachwerkgeschoß aufgesetzt, das das Walm-
dach trägt. In dem mit einem offenen Dach-
stuhl gedeckten Innenraum läuft eine im
18. Jh. nach innen erweiterte Galerie um.
STEINBAUTEN
Von den großbürgerlichen Steinbauten, die
in Hannover seit dem 15. Jh. zu verfolgen
waren, sind nur Fragmente überliefert, die
Renaissance-Formen zeigen.
An Nachkriegsneubauten wurden in der
Leinstraße figürliche und ornamentale Re-
liefs vom schon 1852 versetzten und 1943
zerstörten „Haus der Väter" angebracht (Nr.
33, Ursprungsbau 1619—24) bzw. Reste zur
Erinnerung an das Haus der Hahn'schen
Buchhandlung (Nr. 32, Ursprungsbau 1583).
Beim Neubau des in die Straßenflucht vor-
springenden ehemaligen Gildehauses der
Zimmerleute Osterstraße 30 wurde versucht,
die Parzellierung, Haushöhe und -breite so-
wie die Giebelgestaltung des Ursprungsbaus
von 1611 aufzugreifen. Der Staffelgiebel ist
durch Gesimse und Lisenen gegliedert. Die
Staffelzwickel sind unter Verwendung der
Bauplastik des Vorgängerbaus mit Voluten-
werk gestaltet, in das figürliche Darstellun-
gen (vier Evangelisten) einkomponiert sind.
Dieser von den niederländischen und Weser-
Renaissance-Bauten beeinflußte Giebel wur-
de bei den hannoverschen Bauten der ersten
Hälfte des 17. Jh. verschiedentlich verwandt.
Das repräsentativste Bürgerhaus Hannovers,
das 1648—52 erbaute Leibnizhaus, war ein
Leinstraße 33, Bauplastik vom „Haus der Väter"
Breite Straße 10, Grote-Haus, 1935
Knochenhauerstraße 25, Ende 19. Jh.
62
erbaut. Das zeitweilig als Wohnhaus des
Dichters Ph. Spitta dienende Haus wurde im
Erdgeschoß bei der Sanierung mit glatten
Werksteinplatten verkleidet. Beide Bauten
begleiten wirkungsvoll den westlichen Zu-
gang zum Ballhofplatz, dem Gelände des
ehemaligen St. Gallenhofes curia sancti
Galli"), der als Lehnshof einer der Keimzel-
len der Stadt Hannover war (vgl. S. 50).
Ein Platz ist hier erst seit der im Rahmen der
Altstadtsanierung (1936—39) erfolgten Frei-
legung des ursprünglich dicht eingebauten
Ballhofes. Die Sanierungsplanung der dreißi-
ger Jahre bildete die Grundlage für das
Wiederaufbaukonzept in diesem Bereich.
Auf der Nordseite Überstand die sanierte
Zeile mit den anstelle nachmittelalterlicher
Häuser entstandenen Massivbauten den Zwei-
ten Weltkrieg (Ballhofstraße 4, 6, 8, 10).
Ballhof
Den Ballhof selbst ließ Herzog Georg Wil-
helm 1649 als Saalbau für Ballspielzwecke
errichten, ohne die Einwilligung der Grund-
stückseigentümer eingeholt zu haben — eines
Platz vor dem Ballhof
Osterstraße 30, Ursprungsbau 1611
der wenigen Zeichen für die Veränderung der
Altstadt durch die Erhebung Hannovers zur
Residenz 1636.
Seit der Mitte des 18. Jh. wurde der Bau
auch für Theaterzwecke genutzt. 1779/80
Erneuerung des Gebäudes durch Johann Ge-
org Täntzel, danach Nutzung auch als eine
Art bürgerliches Vereinshaus. Die Sanierung
1936/37 führte zur Einbeziehung des Gebäu-
des mit dem rechtwinklig gestellten, gut
angepaßten Nachbarhaus (Ballhofstraße 5,
Neubau um 1939) in einen Komplex von
HJ- und BDM-Heimen, in den auch das
Spitta-Haus einbezogen war. Das hannover-
sche Ballhaus dient heute als Theater.
Den fensterlosen, jetzt mit glatten Werkstei-
nen verkleideten Erdgeschoßmauern ist ein
stark auskragendes, ursprünglich offenes
Fachwerkgeschoß aufgesetzt, das das Walm-
dach trägt. In dem mit einem offenen Dach-
stuhl gedeckten Innenraum läuft eine im
18. Jh. nach innen erweiterte Galerie um.
STEINBAUTEN
Von den großbürgerlichen Steinbauten, die
in Hannover seit dem 15. Jh. zu verfolgen
waren, sind nur Fragmente überliefert, die
Renaissance-Formen zeigen.
An Nachkriegsneubauten wurden in der
Leinstraße figürliche und ornamentale Re-
liefs vom schon 1852 versetzten und 1943
zerstörten „Haus der Väter" angebracht (Nr.
33, Ursprungsbau 1619—24) bzw. Reste zur
Erinnerung an das Haus der Hahn'schen
Buchhandlung (Nr. 32, Ursprungsbau 1583).
Beim Neubau des in die Straßenflucht vor-
springenden ehemaligen Gildehauses der
Zimmerleute Osterstraße 30 wurde versucht,
die Parzellierung, Haushöhe und -breite so-
wie die Giebelgestaltung des Ursprungsbaus
von 1611 aufzugreifen. Der Staffelgiebel ist
durch Gesimse und Lisenen gegliedert. Die
Staffelzwickel sind unter Verwendung der
Bauplastik des Vorgängerbaus mit Voluten-
werk gestaltet, in das figürliche Darstellun-
gen (vier Evangelisten) einkomponiert sind.
Dieser von den niederländischen und Weser-
Renaissance-Bauten beeinflußte Giebel wur-
de bei den hannoverschen Bauten der ersten
Hälfte des 17. Jh. verschiedentlich verwandt.
Das repräsentativste Bürgerhaus Hannovers,
das 1648—52 erbaute Leibnizhaus, war ein
Leinstraße 33, Bauplastik vom „Haus der Väter"
Breite Straße 10, Grote-Haus, 1935
Knochenhauerstraße 25, Ende 19. Jh.
62