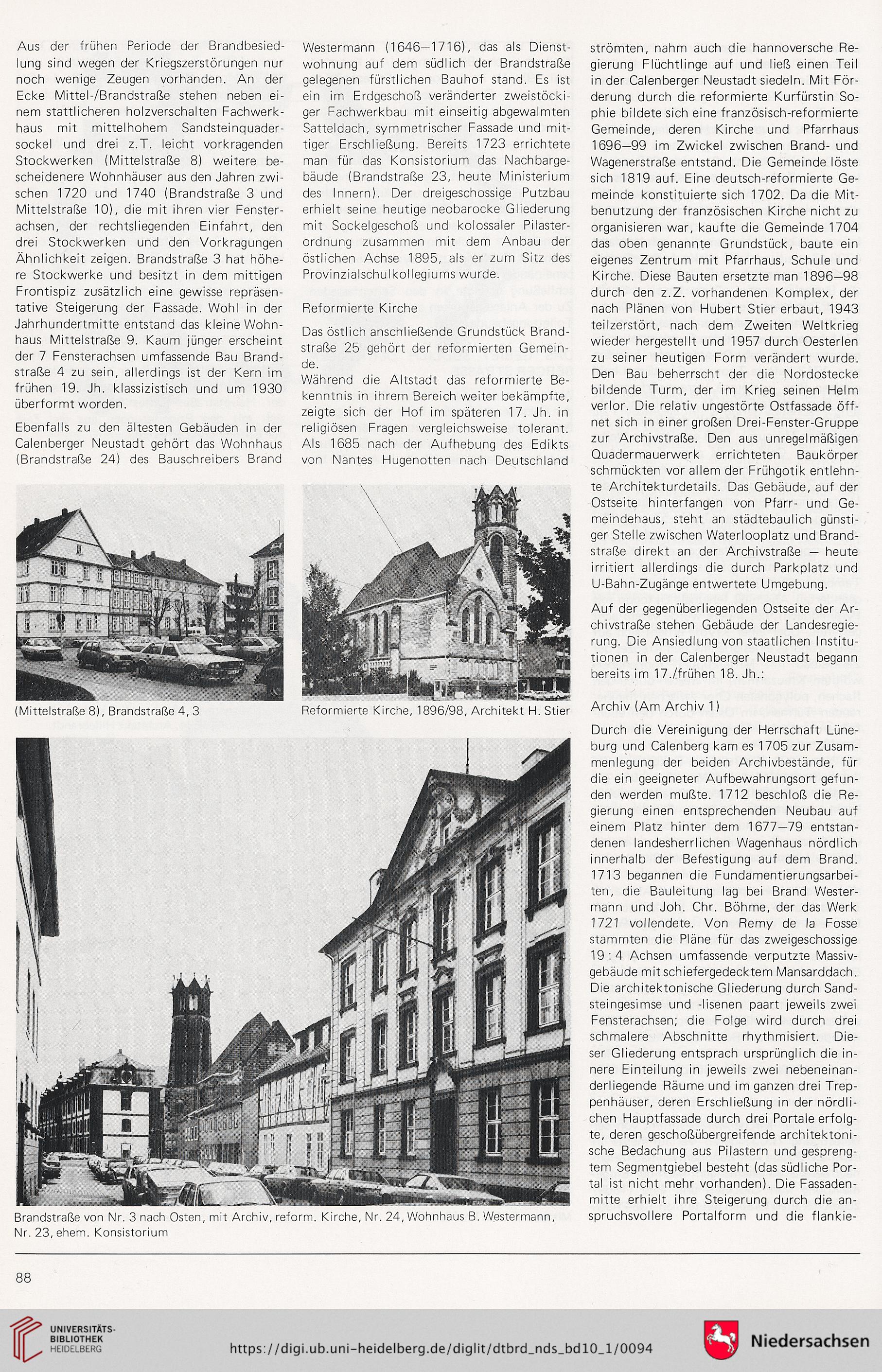Aus der frühen Periode der Brandbesied-
lung sind wegen der Kriegszerstörungen nur
noch wenige Zeugen vorhanden. An der
Ecke Mittel-/Brandstraße stehen neben ei-
nem stattlicheren holzverschalten Fachwerk-
haus mit mittelhohem Sandsteinquader-
sockel und drei z.T. leicht vorkragenden
Stockwerken (Mittelstraße 8) weitere be-
scheidenere Wohnhäuser aus den Jahren zwi-
schen 1720 und 1740 (Brandstraße 3 und
Mittelstraße 10), die mit ihren vier Fenster-
achsen, der rechtsliegenden Einfahrt, den
drei Stockwerken und den Vorkragungen
Ähnlichkeit zeigen. Brandstraße 3 hat höhe-
re Stockwerke und besitzt in dem mittigen
Frontispiz zusätzlich eine gewisse repräsen-
tative Steigerung der Fassade. Wohl in der
Jahrhundertmitte entstand das kleine Wohn-
haus Mittelstraße 9. Kaum jünger erscheint
der 7 Fensterachsen umfassende Bau Brand-
straße 4 zu sein, allerdings ist der Kern im
frühen 19. Jh. klassizistisch und um 1930
überformt worden.
Ebenfalls zu den ältesten Gebäuden in der
Calenberger Neustadt gehört das Wohnhaus
(Brandstraße 24) des Bauschreibers Brand
Westermann (1646—1716), das als Dienst-
wohnung auf dem südlich der Brandstraße
gelegenen fürstlichen Bauhof stand. Es ist
ein im Erdgeschoß veränderter zweistöcki-
ger Fachwerkbau mit einseitig abgewalmten
Satteldach, symmetrischer Fassade und mit-
tiger Erschließung. Bereits 1723 errichtete
man für das Konsistorium das Nachbarge-
bäude (Brandstraße 23, heute Ministerium
des Innern). Der dreigeschossige Putzbau
erhielt seine heutige neobarocke Gliederung
mit Sockelgeschoß und kolossaler Pilaster-
ordnung zusammen mit dem Anbau der
östlichen Achse 1895, als er zum Sitz des
Provinzialschulkollegiums wurde.
Reformierte Kirche
Das östlich anschließende Grundstück Brand-
straße 25 gehört der reformierten Gemein-
de.
Während die Altstadt das reformierte Be-
kenntnis in ihrem Bereich weiter bekämpfte,
zeigte sich der Hof im späteren 17. Jh. in
religiösen Fragen vergleichsweise tolerant.
Als 1685 nach der Aufhebung des Edikts
von Nantes Hugenotten nach Deutschland
Brandstraße von Nr. 3 nach Osten, mit Archiv, reform. Kirche, Nr. 24, Wohnhaus B. Westermann,
Nr. 23, ehern. Konsistorium
strömten, nahm auch die hannoversche Re-
gierung Flüchtlinge auf und ließ einen Teil
in der Calenberger Neustadt siedeln. Mit För-
derung durch die reformierte Kurfürstin So-
phie bildete sich eine französisch-reformierte
Gemeinde, deren Kirche und Pfarrhaus
1696—99 im Zwickel zwischen Brand- und
Wagenerstraße entstand. Die Gemeinde löste
sich 1819 auf. Eine deutsch-reformierte Ge-
meinde konstituierte sich 1702. Da die Mit-
benutzung der französischen Kirche nicht zu
organisieren war, kaufte die Gemeinde 1704
das oben genannte Grundstück, baute ein
eigenes Zentrum mit Pfarrhaus, Schule und
Kirche. Diese Bauten ersetzte man 1896—98
durch den z.Z. vorhandenen Komplex, der
nach Plänen von Hubert Stier erbaut, 1943
teilzerstört, nach dem Zweiten Weltkrieg
wieder hergestellt und 1957 durch Oesterlen
zu seiner heutigen Form verändert wurde.
Den Bau beherrscht der die Nordostecke
bildende Turm, der im Krieg seinen Helm
verlor. Die relativ ungestörte Ostfassade öff-
net sich in einer großen Drei-Fenster-Gruppe
zur Archivstraße. Den aus unregelmäßigen
Quadermauerwerk errichteten Baukörper
schmückten vor allem der Frühgotik entlehn-
te Architekturdetails. Das Gebäude, auf der
Ostseite hinterfangen von Pfarr- und Ge-
meindehaus, steht an städtebaulich günsti-
ger Stelle zwischen Waterlooplatz und Brand-
straße direkt an der Archivstraße — heute
irritiert allerdings die durch Parkplatz und
U-Bahn-Zugänge entwertete Umgebung.
Auf der gegenüberliegenden Ostseite der Ar-
chivstraße stehen Gebäude der Landesregie-
rung. Die Ansiedlung von staatlichen Institu-
tionen in der Calenberger Neustadt begann
bereits im 17./frühen 18. Jh.:
Archiv (Am Archiv 1)
Durch die Vereinigung der Herrschaft Lüne-
burg und Calenberg kam es 1705 zur Zusam-
menlegung der beiden Archivbestände, für
die ein geeigneter Aufbewahrungsort gefun-
den werden mußte. 1712 beschloß die Re-
gierung einen entsprechenden Neubau auf
einem Platz hinter dem 1677—79 entstan-
denen landesherrlichen Wagenhaus nördlich
innerhalb der Befestigung auf dem Brand.
1713 begannen die Fundamentierungsarbei-
ten, die Bauleitung lag bei Brand Wester-
mann und Joh. Chr. Böhme, der das Werk
1721 vollendete. Von Remy de la Fosse
stammten die Pläne für das zweigeschossige
19:4 Achsen umfassende verputzte Massiv-
gebäude mit schiefergedecktem Mansarddach.
Die architektonische Gliederung durch Sand-
steingesimse und -lisenen paart jeweils zwei
Fensterachsen; die Folge wird durch drei
schmalere Abschnitte rhythmisiert. Die-
ser Gliederung entsprach ursprünglich die in-
nere Einteilung in jeweils zwei nebeneinan-
derliegende Räume und im ganzen drei Trep-
penhäuser, deren Erschließung in der nördli-
chen Hauptfassade durch drei Portale erfolg-
te, deren geschoßübergreifende architektoni-
sche Bedachung aus Pilastern und gespreng-
tem Segmentgiebel besteht (das südliche Por-
tal ist nicht mehr vorhanden). Die Fassaden-
mitte erhielt ihre Steigerung durch die an-
spruchsvollere Portalform und die flankie-
88
lung sind wegen der Kriegszerstörungen nur
noch wenige Zeugen vorhanden. An der
Ecke Mittel-/Brandstraße stehen neben ei-
nem stattlicheren holzverschalten Fachwerk-
haus mit mittelhohem Sandsteinquader-
sockel und drei z.T. leicht vorkragenden
Stockwerken (Mittelstraße 8) weitere be-
scheidenere Wohnhäuser aus den Jahren zwi-
schen 1720 und 1740 (Brandstraße 3 und
Mittelstraße 10), die mit ihren vier Fenster-
achsen, der rechtsliegenden Einfahrt, den
drei Stockwerken und den Vorkragungen
Ähnlichkeit zeigen. Brandstraße 3 hat höhe-
re Stockwerke und besitzt in dem mittigen
Frontispiz zusätzlich eine gewisse repräsen-
tative Steigerung der Fassade. Wohl in der
Jahrhundertmitte entstand das kleine Wohn-
haus Mittelstraße 9. Kaum jünger erscheint
der 7 Fensterachsen umfassende Bau Brand-
straße 4 zu sein, allerdings ist der Kern im
frühen 19. Jh. klassizistisch und um 1930
überformt worden.
Ebenfalls zu den ältesten Gebäuden in der
Calenberger Neustadt gehört das Wohnhaus
(Brandstraße 24) des Bauschreibers Brand
Westermann (1646—1716), das als Dienst-
wohnung auf dem südlich der Brandstraße
gelegenen fürstlichen Bauhof stand. Es ist
ein im Erdgeschoß veränderter zweistöcki-
ger Fachwerkbau mit einseitig abgewalmten
Satteldach, symmetrischer Fassade und mit-
tiger Erschließung. Bereits 1723 errichtete
man für das Konsistorium das Nachbarge-
bäude (Brandstraße 23, heute Ministerium
des Innern). Der dreigeschossige Putzbau
erhielt seine heutige neobarocke Gliederung
mit Sockelgeschoß und kolossaler Pilaster-
ordnung zusammen mit dem Anbau der
östlichen Achse 1895, als er zum Sitz des
Provinzialschulkollegiums wurde.
Reformierte Kirche
Das östlich anschließende Grundstück Brand-
straße 25 gehört der reformierten Gemein-
de.
Während die Altstadt das reformierte Be-
kenntnis in ihrem Bereich weiter bekämpfte,
zeigte sich der Hof im späteren 17. Jh. in
religiösen Fragen vergleichsweise tolerant.
Als 1685 nach der Aufhebung des Edikts
von Nantes Hugenotten nach Deutschland
Brandstraße von Nr. 3 nach Osten, mit Archiv, reform. Kirche, Nr. 24, Wohnhaus B. Westermann,
Nr. 23, ehern. Konsistorium
strömten, nahm auch die hannoversche Re-
gierung Flüchtlinge auf und ließ einen Teil
in der Calenberger Neustadt siedeln. Mit För-
derung durch die reformierte Kurfürstin So-
phie bildete sich eine französisch-reformierte
Gemeinde, deren Kirche und Pfarrhaus
1696—99 im Zwickel zwischen Brand- und
Wagenerstraße entstand. Die Gemeinde löste
sich 1819 auf. Eine deutsch-reformierte Ge-
meinde konstituierte sich 1702. Da die Mit-
benutzung der französischen Kirche nicht zu
organisieren war, kaufte die Gemeinde 1704
das oben genannte Grundstück, baute ein
eigenes Zentrum mit Pfarrhaus, Schule und
Kirche. Diese Bauten ersetzte man 1896—98
durch den z.Z. vorhandenen Komplex, der
nach Plänen von Hubert Stier erbaut, 1943
teilzerstört, nach dem Zweiten Weltkrieg
wieder hergestellt und 1957 durch Oesterlen
zu seiner heutigen Form verändert wurde.
Den Bau beherrscht der die Nordostecke
bildende Turm, der im Krieg seinen Helm
verlor. Die relativ ungestörte Ostfassade öff-
net sich in einer großen Drei-Fenster-Gruppe
zur Archivstraße. Den aus unregelmäßigen
Quadermauerwerk errichteten Baukörper
schmückten vor allem der Frühgotik entlehn-
te Architekturdetails. Das Gebäude, auf der
Ostseite hinterfangen von Pfarr- und Ge-
meindehaus, steht an städtebaulich günsti-
ger Stelle zwischen Waterlooplatz und Brand-
straße direkt an der Archivstraße — heute
irritiert allerdings die durch Parkplatz und
U-Bahn-Zugänge entwertete Umgebung.
Auf der gegenüberliegenden Ostseite der Ar-
chivstraße stehen Gebäude der Landesregie-
rung. Die Ansiedlung von staatlichen Institu-
tionen in der Calenberger Neustadt begann
bereits im 17./frühen 18. Jh.:
Archiv (Am Archiv 1)
Durch die Vereinigung der Herrschaft Lüne-
burg und Calenberg kam es 1705 zur Zusam-
menlegung der beiden Archivbestände, für
die ein geeigneter Aufbewahrungsort gefun-
den werden mußte. 1712 beschloß die Re-
gierung einen entsprechenden Neubau auf
einem Platz hinter dem 1677—79 entstan-
denen landesherrlichen Wagenhaus nördlich
innerhalb der Befestigung auf dem Brand.
1713 begannen die Fundamentierungsarbei-
ten, die Bauleitung lag bei Brand Wester-
mann und Joh. Chr. Böhme, der das Werk
1721 vollendete. Von Remy de la Fosse
stammten die Pläne für das zweigeschossige
19:4 Achsen umfassende verputzte Massiv-
gebäude mit schiefergedecktem Mansarddach.
Die architektonische Gliederung durch Sand-
steingesimse und -lisenen paart jeweils zwei
Fensterachsen; die Folge wird durch drei
schmalere Abschnitte rhythmisiert. Die-
ser Gliederung entsprach ursprünglich die in-
nere Einteilung in jeweils zwei nebeneinan-
derliegende Räume und im ganzen drei Trep-
penhäuser, deren Erschließung in der nördli-
chen Hauptfassade durch drei Portale erfolg-
te, deren geschoßübergreifende architektoni-
sche Bedachung aus Pilastern und gespreng-
tem Segmentgiebel besteht (das südliche Por-
tal ist nicht mehr vorhanden). Die Fassaden-
mitte erhielt ihre Steigerung durch die an-
spruchsvollere Portalform und die flankie-
88