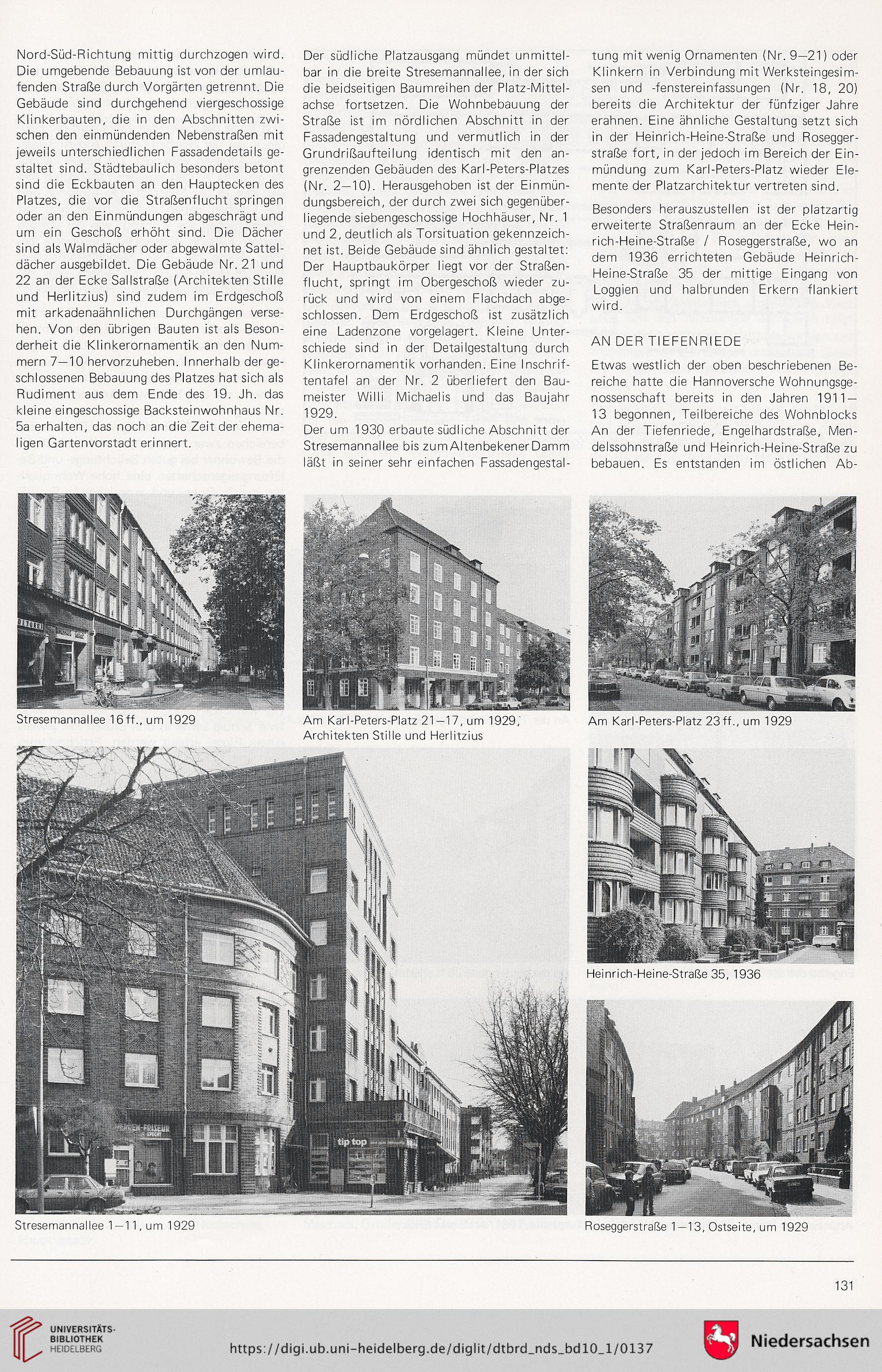Nord-Süd-Richtung mittig durchzogen wird.
Die umgebende Bebauung ist von der umlau-
fenden Straße durch Vorgärten getrennt. Die
Gebäude sind durchgehend viergeschossige
Klinkerbauten, die in den Abschnitten zwi-
schen den einmündenden Nebenstraßen mit
jeweils unterschiedlichen Fassadendetails ge-
staltet sind. Städtebaulich besonders betont
sind die Eckbauten an den Hauptecken des
Platzes, die vor die Straßenflucht springen
oder an den Einmündungen abgeschrägt und
um ein Geschoß erhöht sind. Die Dächer
sind als Walmdächer oder abgewalmte Sattel-
dächer ausgebildet. Die Gebäude Nr. 21 und
22 an der Ecke Sallstraße (Architekten Stille
und Herlitzius) sind zudem im Erdgeschoß
mit arkadenaähnlichen Durchgängen verse-
hen. Von den übrigen Bauten ist als Beson-
derheit die Klinkerornamentik an den Num-
mern 7—10 hervorzuheben. Innerhalb der ge-
schlossenen Bebauung des Platzes hat sich als
Rudiment aus dem Ende des 19. Jh. das
kleine eingeschossige Backsteinwohnhaus Nr.
5a erhalten, das noch an die Zeit der ehema-
ligen Gartenvorstadt erinnert.
Der südliche Platzausgang mündet unmittel-
bar in die breite Stresemannallee, in der sich
die beidseitigen Baumreihen der Platz-Mittel-
achse fortsetzen. Die Wohnbebauung der
Straße ist im nördlichen Abschnitt in der
Fassadengestaltung und vermutlich in der
Grundrißaufteilung identisch mit den an-
grenzenden Gebäuden des Karl-Peters-Platzes
(Nr. 2—10). Herausgehoben ist der Einmün-
dungsbereich, der durch zwei sich gegenüber-
liegende siebengeschossige Hochhäuser, Nr. 1
und 2, deutlich als Torsituation gekennzeich-
net ist. Beide Gebäude sind ähnlich gestaltet:
Der Hauptbaukörper liegt vor der Straßen-
flucht, springt im Obergeschoß wieder zu-
rück und wird von einem Flachdach abge-
schlossen. Dem Erdgeschoß ist zusätzlich
eine Ladenzone vorgelagert. Kleine Unter-
schiede sind in der Detailgestaltung durch
Klinkerornamentik vorhanden. Eine Inschrif-
tentafel an der Nr. 2 überliefert den Bau-
meister Willi Michaelis und das Baujahr
1929.
Der um 1930 erbaute südliche Abschnitt der
Stresemannallee bis zumAltenbekenerDamm
läßt in seiner sehr einfachen Fassadengestal-
Stresemannallee 16ff., um 1929
tiptop H
Stresemannallee 1—11, um 1929
tung mit wenig Ornamenten (Nr. 9—21) oder
Klinkern in Verbindung mit Werksteingesim-
sen und -fenstereinfassungen (Nr. 18, 20)
bereits die Architektur der fünfziger Jahre
erahnen. Eine ähnliche Gestaltung setzt sich
in der Heinrich-Heine-Straße und Rosegger-
straße fort, in der jedoch im Bereich der Ein-
mündung zum Karl-Peters-Platz wieder Ele-
mente der Platzarchitektur vertreten sind.
Besonders herauszustellen ist der platzartig
erweiterte Straßenraum an der Ecke Hein-
rich-Heine-Straße / Roseggerstraße, wo an
dem 1936 errichteten Gebäude Heinrich-
Heine-Straße 35 der mittige Eingang von
Loggien und halbrunden Erkern flankiert
wird.
AN DER TIEFENRIEDE
Etwas westlich der oben beschriebenen Be-
reiche hatte die Hannoversche Wohnungsge-
nossenschaft bereits in den Jahren 1911 —
13 begonnen, Teilbereiche des Wohnblocks
An der Tiefenriede, Engelhardstraße, Men-
delssohnstraße und Heinrich-Heine-Straße zu
bebauen. Es entstanden im östlichen Ab-
Heinrich-Heine-Straße 35, 1936
Roseggerstraße 1-13, Ostseite, um 1929
131
Die umgebende Bebauung ist von der umlau-
fenden Straße durch Vorgärten getrennt. Die
Gebäude sind durchgehend viergeschossige
Klinkerbauten, die in den Abschnitten zwi-
schen den einmündenden Nebenstraßen mit
jeweils unterschiedlichen Fassadendetails ge-
staltet sind. Städtebaulich besonders betont
sind die Eckbauten an den Hauptecken des
Platzes, die vor die Straßenflucht springen
oder an den Einmündungen abgeschrägt und
um ein Geschoß erhöht sind. Die Dächer
sind als Walmdächer oder abgewalmte Sattel-
dächer ausgebildet. Die Gebäude Nr. 21 und
22 an der Ecke Sallstraße (Architekten Stille
und Herlitzius) sind zudem im Erdgeschoß
mit arkadenaähnlichen Durchgängen verse-
hen. Von den übrigen Bauten ist als Beson-
derheit die Klinkerornamentik an den Num-
mern 7—10 hervorzuheben. Innerhalb der ge-
schlossenen Bebauung des Platzes hat sich als
Rudiment aus dem Ende des 19. Jh. das
kleine eingeschossige Backsteinwohnhaus Nr.
5a erhalten, das noch an die Zeit der ehema-
ligen Gartenvorstadt erinnert.
Der südliche Platzausgang mündet unmittel-
bar in die breite Stresemannallee, in der sich
die beidseitigen Baumreihen der Platz-Mittel-
achse fortsetzen. Die Wohnbebauung der
Straße ist im nördlichen Abschnitt in der
Fassadengestaltung und vermutlich in der
Grundrißaufteilung identisch mit den an-
grenzenden Gebäuden des Karl-Peters-Platzes
(Nr. 2—10). Herausgehoben ist der Einmün-
dungsbereich, der durch zwei sich gegenüber-
liegende siebengeschossige Hochhäuser, Nr. 1
und 2, deutlich als Torsituation gekennzeich-
net ist. Beide Gebäude sind ähnlich gestaltet:
Der Hauptbaukörper liegt vor der Straßen-
flucht, springt im Obergeschoß wieder zu-
rück und wird von einem Flachdach abge-
schlossen. Dem Erdgeschoß ist zusätzlich
eine Ladenzone vorgelagert. Kleine Unter-
schiede sind in der Detailgestaltung durch
Klinkerornamentik vorhanden. Eine Inschrif-
tentafel an der Nr. 2 überliefert den Bau-
meister Willi Michaelis und das Baujahr
1929.
Der um 1930 erbaute südliche Abschnitt der
Stresemannallee bis zumAltenbekenerDamm
läßt in seiner sehr einfachen Fassadengestal-
Stresemannallee 16ff., um 1929
tiptop H
Stresemannallee 1—11, um 1929
tung mit wenig Ornamenten (Nr. 9—21) oder
Klinkern in Verbindung mit Werksteingesim-
sen und -fenstereinfassungen (Nr. 18, 20)
bereits die Architektur der fünfziger Jahre
erahnen. Eine ähnliche Gestaltung setzt sich
in der Heinrich-Heine-Straße und Rosegger-
straße fort, in der jedoch im Bereich der Ein-
mündung zum Karl-Peters-Platz wieder Ele-
mente der Platzarchitektur vertreten sind.
Besonders herauszustellen ist der platzartig
erweiterte Straßenraum an der Ecke Hein-
rich-Heine-Straße / Roseggerstraße, wo an
dem 1936 errichteten Gebäude Heinrich-
Heine-Straße 35 der mittige Eingang von
Loggien und halbrunden Erkern flankiert
wird.
AN DER TIEFENRIEDE
Etwas westlich der oben beschriebenen Be-
reiche hatte die Hannoversche Wohnungsge-
nossenschaft bereits in den Jahren 1911 —
13 begonnen, Teilbereiche des Wohnblocks
An der Tiefenriede, Engelhardstraße, Men-
delssohnstraße und Heinrich-Heine-Straße zu
bebauen. Es entstanden im östlichen Ab-
Heinrich-Heine-Straße 35, 1936
Roseggerstraße 1-13, Ostseite, um 1929
131