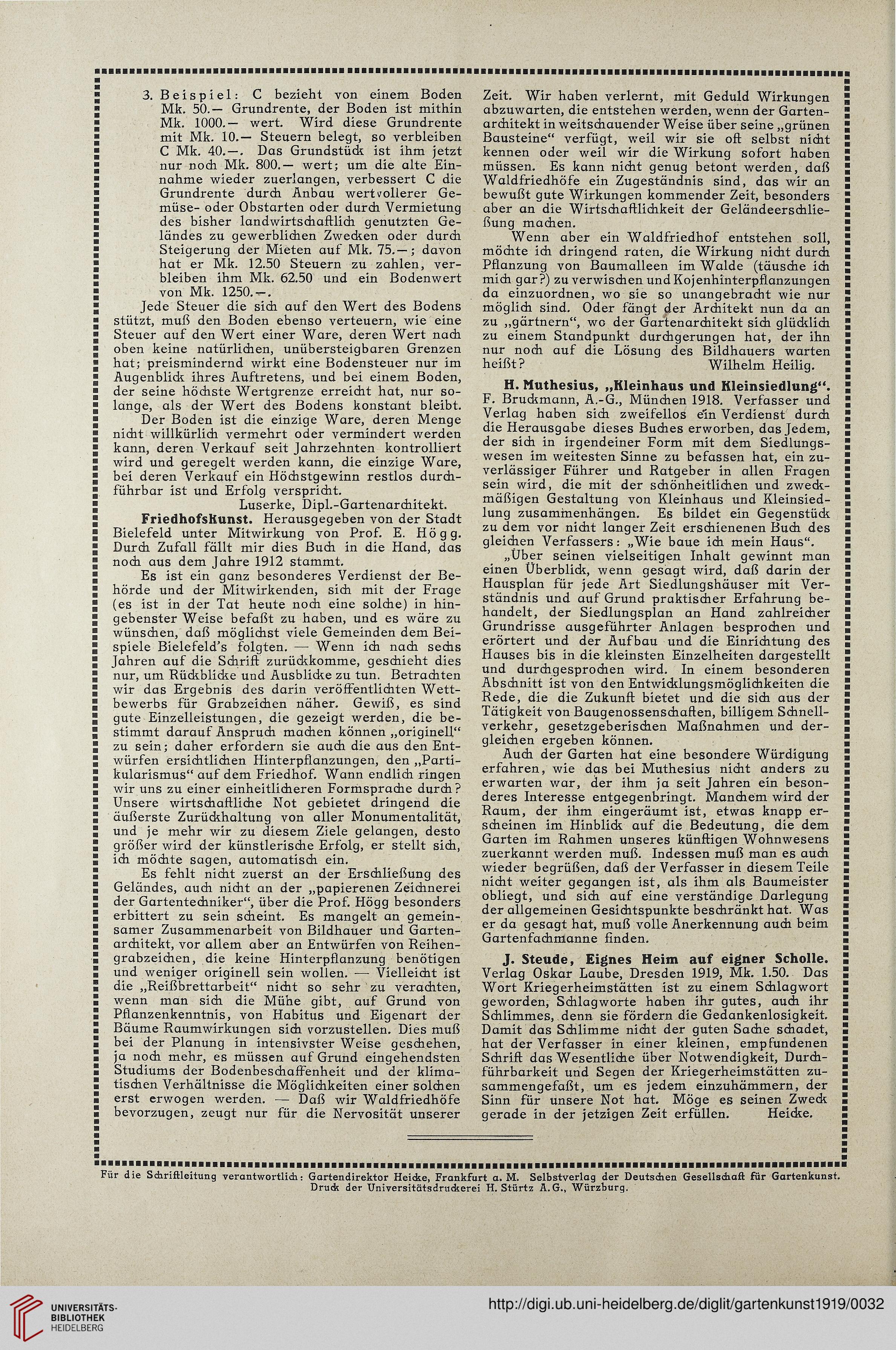3. Beispiel: C bezieht von einem Boden
Mk. 50.— Grundrente, der Boden ist mithin
Mk. 1000.— wert. Wird diese Grundrente
mit Mk. 10.— Steuern belegt, so verbleiben
C Mk. 40. — . Das Grundstüdi ist ihm jetzt
nur noch Mk. 800.— wert; um die alte Ein-
nahme wieder zuerlangen, verbessert C die
Grundrente durch Anbau wertvollerer Ge-
müse- oder Obstarten oder durch Vermietung
des bisher landwirtschaftlich genutzten Ge-
ländes zu gewerblichen Zwedten oder durch
Steigerung der Mieten auf Mk. 75.— ; davon
hat er Mk. 12.50 Steuern zu zahlen, ver-
bleiben ihm Mk. 62.50 und ein Bodenwert
von Mk. 1250. •*-.
Jede Steuer die sich auf den Wert des Bodens
stützt, muß den Boden ebenso verteuern, wie eine
Steuer auf den Wert einer Ware, deren Wert nach
oben keine natürlichen, unübersteigbaren Grenzen
hat; preismindernd wirkt eine Bodensteuer nur im
Augenblick ihres Auftretens, und bei einem Boden,
der seine höchste Wertgrenze erreicht hat, nur so-
lange, als der Wert des Bodens konstant bleibt.
Der Boden ist die einzige Ware, deren Menge
nicht willkürlich vermehrt oder vermindert werden
kann, deren Verkauf seit Jahrzehnten kontrolliert
wird und geregelt werden kann, die einzige Ware,
bei deren Verkauf ein Höchstgewinn restlos durch-
führbar ist und Erfolg verspricht.
Luserke, Dipl.-Gartenarchitekt.
FriedhofsKunst. Herausgegeben von der Stadt
Bielefeld unter Mitwirkung von Prof. E. Högg.
Durch Zufall fällt mir dies Buch in die Hand, das
noch aus dem Jahre 1912 stammt.
Es ist ein ganz besonderes Verdienst der Be-
hörde und der Mitwirkenden, sich mit der Frage
(es ist in der Tat heute noch eine solche) in hin-
gebenster Weise befaßt zu haben, und es wäre zu
wünschen, daß möglichst viele Gemeinden dem Bei-
spiele Bielefeld’s folgten. — Wenn ich nach sechs
Jahren auf die Schrift zurückkomme, geschieht dies
nur, um Rückblicke und Ausblidte zu tun. Betrachten
wir das Ergebnis des darin veröffentlichten Wett-
bewerbs für Grabzeichen näher. Gewiß, es sind
gute Einzelleistungen, die gezeigt werden, die be-
stimmt darauf Anspruch machen können „originell“
zu sein; daher erfordern sie auch die aus den Ent-
würfen ersichtlichen Hinterpflanzungen, den „Parti-
kularismus“ auf dem Friedhof. Wann endlich ringen
wir uns zu einer einheitlicheren Formsprache durch?
Unsere wirtschaftliche Not gebietet dringend die
äußerste Zurückhaltung von aller Monumentalität,
und je mehr wir zu diesem Ziele gelangen, desto
größer wird der künstlerische Erfolg, er stellt sich,
ich möchte sagen, automatisch ein.
Es fehlt nicht zuerst an der Erschließung des
Geländes, auch nicht an der „papierenen Zeichnerei
der Gartentechniker“, über die Prof. Högg besonders
erbittert zu sein scheint. Es mangelt an gemein-
samer Zusammenarbeit von Bildhauer und Garten-
architekt, vor allem aber an Entwürfen von Reihen-
grabzeichen, die keine Hinterpflanzung benötigen
und weniger originell sein wollen. — Vielleicht ist
die „Reißbrettarbeit“ nicht so sehr zu verachten,
wenn man sich die Mühe gibt, auf Grund von
Pflanzenkenntnis, von Habitus und Eigenart der
Bäume Raumwirkungen sich vorzustellen. Dies muß
bei der Planung in intensivster Weise geschehen,
ja noch mehr, es müssen auf Grund eingehendsten
Studiums der Bodenbeschaffenheit und der klima-
tischen Verhältnisse die Möglichkeiten einer solchen
erst erwogen werden. — Daß wir Waldfriedhöfe
bevorzugen, zeugt nur für die Nervosität unserer
Zeit. Wir haben verlernt, mit Geduld Wirkungen
abzuwarten, die entstehen werden, wenn der Garten-
architekt in weitschauender Weise über seine „grünen
Bausteine“ verfügt, weil wir sie oft selbst nicht
kennen oder weil wir die Wirkung sofort haben
müssen. Es kann nicht genug betont werden, daß
Waldfriedhöfe ein Zugeständnis sind, das wir an
bewußt gute Wirkungen kommender Zeit, besonders
aber an die Wirtschaftlichkeit der Geländeerschlie-
ßung machen.
Wenn aber ein Waldfriedhof entstehen soll,
möchte ich dringend raten, die Wirkung nicht durch
Pflanzung von Baumalleen im Walde (täusche ich
mich gar?) zu verwischen und Kojenhinterpflanzungen
da einzuordnen, wo sie so unangebracht wie nur
möglich sind. Oder fängt der Architekt nun da an
zu „gärtnern“, wo der Gartenarchitekt sich glücklich
zu einem Standpunkt durchgerungen hat, der ihn
nur noch auf die Lösung des Bildhauers warten
heißt? Wilhelm Heilig.
H. Muthesius, „Kleinhaus und Kleinsiedlung“.
F. Brudtmann, A.-G., München 1918. Verfasser und
Verlag haben sich zweifellos ein Verdienst durch
die Herausgabe dieses Buches erworben, das Jedem,
der sich in irgendeiner Form mit dem Siedlungs-
wesen im weitesten Sinne zu befassen hat, ein zu-
verlässiger Führer und Ratgeber in allen Fragen
sein wird, die mit der schönheitlichen und zweck-
mäßigen Gestaltung von Kleinhaus und Kleinsied-
lung Zusammenhängen. Es bildet ein Gegenstück
zu dem vor nicht langer Zeit erschienenen Buch des
gleichen Verfassers: „Wie baue ich mein Haus“.
„Über seinen vielseitigen Inhalt gewinnt man
einen Überblick, wenn gesagt wird, daß darin der
Hausplan für jede Art Siedlungshäuser mit Ver-
ständnis und auf Grund praktischer Erfahrung be-
handelt, der Siedlungsplan an Hand zahlreicher
Grundrisse ausgeführter Anlagen besprochen und
erörtert und der Aufbau und die Einrichtung des
Hauses bis in die kleinsten Einzelheiten dargestellt
und durchgesprochen wird. In einem besonderen
Abschnitt ist von den Entwicklungsmöglichkeiten die
Rede, die die Zukunft bietet und die sich aus der
Tätigkeit von Baugenossenschaften, billigem Schnell-
verkehr, gesetzgeberischen Maßnahmen und der-
gleichen ergeben können.
Auch der Garten hat eine besondere Würdigung
erfahren, wie das bei Muthesius nicht anders zu
erwarten war, der ihm ja seit Jahren ein beson-
deres Interesse entgegenbringt. Manchem wird der
Raum, der ihm eingeräumt ist, etwas knapp er-
scheinen im Hinblick auf die Bedeutung, die dem
Garten im Rahmen unseres künftigen Wohnwesens
zuerkannt werden muß. Indessen muß man es auch
wieder begrüßen, daß der Verfasser in diesem Teile
nicht weiter gegangen ist, als ihm als Baumeister
obliegt, und sich auf eine verständige Darlegung
der allgemeinen Gesichtspunkte beschränkt hat. Was
er da gesagt hat, muß volle Anerkennung auch beim
Gartenfachmanne finden.
J. Steude, Eignes Heim auf eigner Scholle.
Verlag Oskar Laube, Dresden 1919, Mk. 1.50. Das
Wort Kriegerheimstätten ist zu einem Schlagwort
geworden, Schlagworte haben ihr gutes, auch ihr
Schlimmes, denn sie fördern die Gedankenlosigkeit.
Damit das Schlimme nicht der guten Sache schadet,
hat der Verfasser in einer kleinen, empfundenen
Schrift das Wesentliche über Notwendigkeit, Durch-
führbarkeit und Segen der Kriegerheimstätten zu-
sammengefaßt, um es jedem einzuhämmern, der
Sinn für unsere Not hat. Möge es seinen Zweck
gerade in der jetzigen Zeit erfüllen. Heicke.
Für die Schriftleitung verantwortlich: Gartendirektor Heicke, Frankfurt a. M. Selbstverlag der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst.
Druck der Universitätsdruckerei H. Stürtz A.G., Würzburg.
Mk. 50.— Grundrente, der Boden ist mithin
Mk. 1000.— wert. Wird diese Grundrente
mit Mk. 10.— Steuern belegt, so verbleiben
C Mk. 40. — . Das Grundstüdi ist ihm jetzt
nur noch Mk. 800.— wert; um die alte Ein-
nahme wieder zuerlangen, verbessert C die
Grundrente durch Anbau wertvollerer Ge-
müse- oder Obstarten oder durch Vermietung
des bisher landwirtschaftlich genutzten Ge-
ländes zu gewerblichen Zwedten oder durch
Steigerung der Mieten auf Mk. 75.— ; davon
hat er Mk. 12.50 Steuern zu zahlen, ver-
bleiben ihm Mk. 62.50 und ein Bodenwert
von Mk. 1250. •*-.
Jede Steuer die sich auf den Wert des Bodens
stützt, muß den Boden ebenso verteuern, wie eine
Steuer auf den Wert einer Ware, deren Wert nach
oben keine natürlichen, unübersteigbaren Grenzen
hat; preismindernd wirkt eine Bodensteuer nur im
Augenblick ihres Auftretens, und bei einem Boden,
der seine höchste Wertgrenze erreicht hat, nur so-
lange, als der Wert des Bodens konstant bleibt.
Der Boden ist die einzige Ware, deren Menge
nicht willkürlich vermehrt oder vermindert werden
kann, deren Verkauf seit Jahrzehnten kontrolliert
wird und geregelt werden kann, die einzige Ware,
bei deren Verkauf ein Höchstgewinn restlos durch-
führbar ist und Erfolg verspricht.
Luserke, Dipl.-Gartenarchitekt.
FriedhofsKunst. Herausgegeben von der Stadt
Bielefeld unter Mitwirkung von Prof. E. Högg.
Durch Zufall fällt mir dies Buch in die Hand, das
noch aus dem Jahre 1912 stammt.
Es ist ein ganz besonderes Verdienst der Be-
hörde und der Mitwirkenden, sich mit der Frage
(es ist in der Tat heute noch eine solche) in hin-
gebenster Weise befaßt zu haben, und es wäre zu
wünschen, daß möglichst viele Gemeinden dem Bei-
spiele Bielefeld’s folgten. — Wenn ich nach sechs
Jahren auf die Schrift zurückkomme, geschieht dies
nur, um Rückblicke und Ausblidte zu tun. Betrachten
wir das Ergebnis des darin veröffentlichten Wett-
bewerbs für Grabzeichen näher. Gewiß, es sind
gute Einzelleistungen, die gezeigt werden, die be-
stimmt darauf Anspruch machen können „originell“
zu sein; daher erfordern sie auch die aus den Ent-
würfen ersichtlichen Hinterpflanzungen, den „Parti-
kularismus“ auf dem Friedhof. Wann endlich ringen
wir uns zu einer einheitlicheren Formsprache durch?
Unsere wirtschaftliche Not gebietet dringend die
äußerste Zurückhaltung von aller Monumentalität,
und je mehr wir zu diesem Ziele gelangen, desto
größer wird der künstlerische Erfolg, er stellt sich,
ich möchte sagen, automatisch ein.
Es fehlt nicht zuerst an der Erschließung des
Geländes, auch nicht an der „papierenen Zeichnerei
der Gartentechniker“, über die Prof. Högg besonders
erbittert zu sein scheint. Es mangelt an gemein-
samer Zusammenarbeit von Bildhauer und Garten-
architekt, vor allem aber an Entwürfen von Reihen-
grabzeichen, die keine Hinterpflanzung benötigen
und weniger originell sein wollen. — Vielleicht ist
die „Reißbrettarbeit“ nicht so sehr zu verachten,
wenn man sich die Mühe gibt, auf Grund von
Pflanzenkenntnis, von Habitus und Eigenart der
Bäume Raumwirkungen sich vorzustellen. Dies muß
bei der Planung in intensivster Weise geschehen,
ja noch mehr, es müssen auf Grund eingehendsten
Studiums der Bodenbeschaffenheit und der klima-
tischen Verhältnisse die Möglichkeiten einer solchen
erst erwogen werden. — Daß wir Waldfriedhöfe
bevorzugen, zeugt nur für die Nervosität unserer
Zeit. Wir haben verlernt, mit Geduld Wirkungen
abzuwarten, die entstehen werden, wenn der Garten-
architekt in weitschauender Weise über seine „grünen
Bausteine“ verfügt, weil wir sie oft selbst nicht
kennen oder weil wir die Wirkung sofort haben
müssen. Es kann nicht genug betont werden, daß
Waldfriedhöfe ein Zugeständnis sind, das wir an
bewußt gute Wirkungen kommender Zeit, besonders
aber an die Wirtschaftlichkeit der Geländeerschlie-
ßung machen.
Wenn aber ein Waldfriedhof entstehen soll,
möchte ich dringend raten, die Wirkung nicht durch
Pflanzung von Baumalleen im Walde (täusche ich
mich gar?) zu verwischen und Kojenhinterpflanzungen
da einzuordnen, wo sie so unangebracht wie nur
möglich sind. Oder fängt der Architekt nun da an
zu „gärtnern“, wo der Gartenarchitekt sich glücklich
zu einem Standpunkt durchgerungen hat, der ihn
nur noch auf die Lösung des Bildhauers warten
heißt? Wilhelm Heilig.
H. Muthesius, „Kleinhaus und Kleinsiedlung“.
F. Brudtmann, A.-G., München 1918. Verfasser und
Verlag haben sich zweifellos ein Verdienst durch
die Herausgabe dieses Buches erworben, das Jedem,
der sich in irgendeiner Form mit dem Siedlungs-
wesen im weitesten Sinne zu befassen hat, ein zu-
verlässiger Führer und Ratgeber in allen Fragen
sein wird, die mit der schönheitlichen und zweck-
mäßigen Gestaltung von Kleinhaus und Kleinsied-
lung Zusammenhängen. Es bildet ein Gegenstück
zu dem vor nicht langer Zeit erschienenen Buch des
gleichen Verfassers: „Wie baue ich mein Haus“.
„Über seinen vielseitigen Inhalt gewinnt man
einen Überblick, wenn gesagt wird, daß darin der
Hausplan für jede Art Siedlungshäuser mit Ver-
ständnis und auf Grund praktischer Erfahrung be-
handelt, der Siedlungsplan an Hand zahlreicher
Grundrisse ausgeführter Anlagen besprochen und
erörtert und der Aufbau und die Einrichtung des
Hauses bis in die kleinsten Einzelheiten dargestellt
und durchgesprochen wird. In einem besonderen
Abschnitt ist von den Entwicklungsmöglichkeiten die
Rede, die die Zukunft bietet und die sich aus der
Tätigkeit von Baugenossenschaften, billigem Schnell-
verkehr, gesetzgeberischen Maßnahmen und der-
gleichen ergeben können.
Auch der Garten hat eine besondere Würdigung
erfahren, wie das bei Muthesius nicht anders zu
erwarten war, der ihm ja seit Jahren ein beson-
deres Interesse entgegenbringt. Manchem wird der
Raum, der ihm eingeräumt ist, etwas knapp er-
scheinen im Hinblick auf die Bedeutung, die dem
Garten im Rahmen unseres künftigen Wohnwesens
zuerkannt werden muß. Indessen muß man es auch
wieder begrüßen, daß der Verfasser in diesem Teile
nicht weiter gegangen ist, als ihm als Baumeister
obliegt, und sich auf eine verständige Darlegung
der allgemeinen Gesichtspunkte beschränkt hat. Was
er da gesagt hat, muß volle Anerkennung auch beim
Gartenfachmanne finden.
J. Steude, Eignes Heim auf eigner Scholle.
Verlag Oskar Laube, Dresden 1919, Mk. 1.50. Das
Wort Kriegerheimstätten ist zu einem Schlagwort
geworden, Schlagworte haben ihr gutes, auch ihr
Schlimmes, denn sie fördern die Gedankenlosigkeit.
Damit das Schlimme nicht der guten Sache schadet,
hat der Verfasser in einer kleinen, empfundenen
Schrift das Wesentliche über Notwendigkeit, Durch-
führbarkeit und Segen der Kriegerheimstätten zu-
sammengefaßt, um es jedem einzuhämmern, der
Sinn für unsere Not hat. Möge es seinen Zweck
gerade in der jetzigen Zeit erfüllen. Heicke.
Für die Schriftleitung verantwortlich: Gartendirektor Heicke, Frankfurt a. M. Selbstverlag der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst.
Druck der Universitätsdruckerei H. Stürtz A.G., Würzburg.