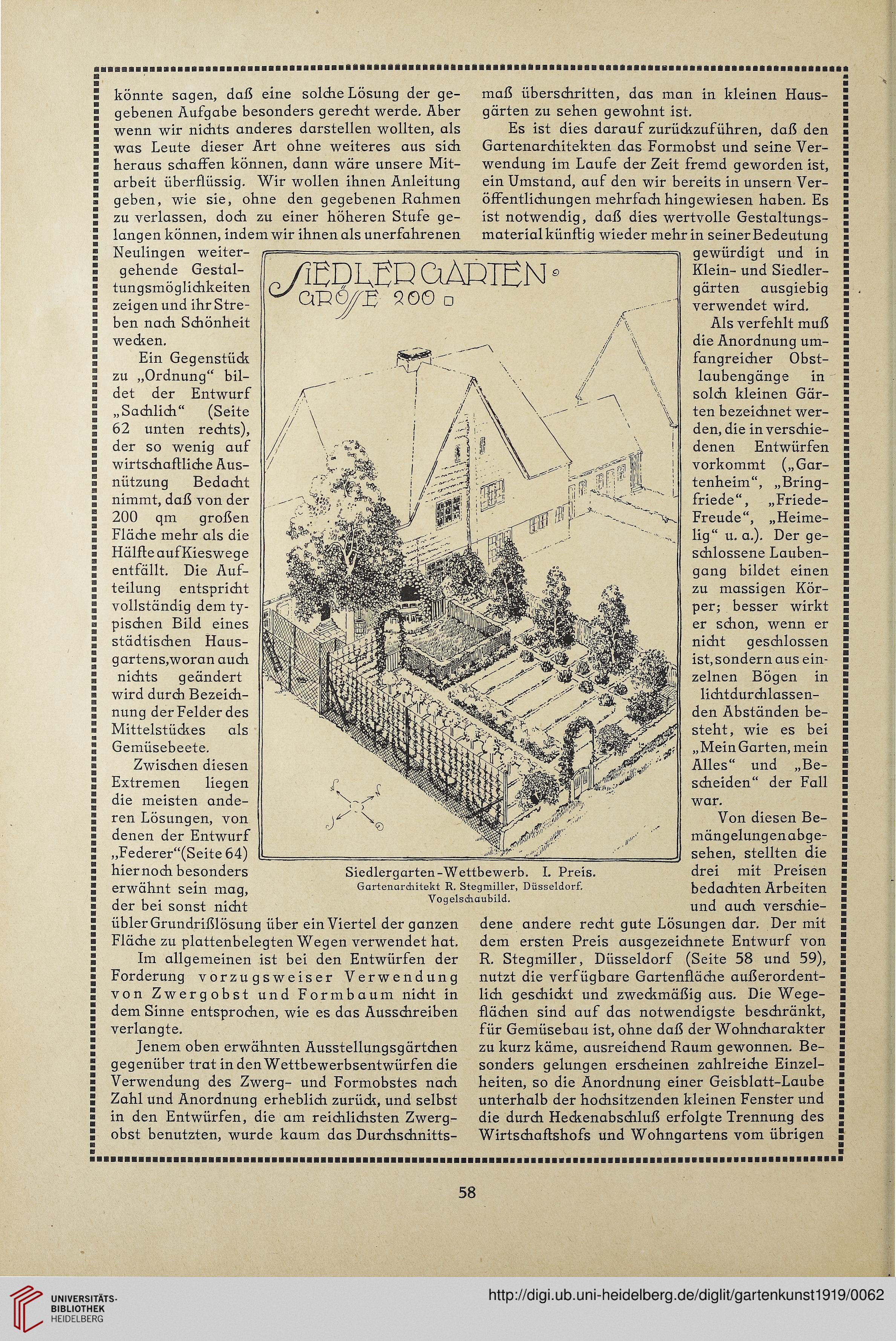könnte sagen, daß eine solche Lösung der ge-
gebenen Aufgabe besonders gerecht werde. Aber
wenn wir nichts anderes darstellen wollten, als
was Leute dieser Art ohne weiteres aus sich
heraus schaffen können, dann wäre unsere Mit-
arbeit überflüssig. Wir wollen ihnen Anleitung
geben, wie sie, ohne den gegebenen Rahmen
zu verlassen, doch zu einer höheren Stufe ge-
langen können, indem wir ihnen als unerfahrenen
Neulingen weiter-
gehende Gestal-
tungsmöglichkeiten
zeigen und ihr Stre-
ben nach Schönheit
wecken.
Ein Gegenstück
zu „Ordnung“ bil-
det der Entwurf
„Sachlich“ (Seite
62 unten rechts),
der so wenig auf
wirtschaftliche Aus-
nützung Bedacht
nimmt, daß von der
200 qm großen
Fläche mehr als die
Hälfte aufKieswege
entfällt. Die Auf-
teilung entspricht
vollständig dem ty-
pischen Bild eines
städtischen Haus-
gartens, woran auch
nichts geändert
wird durch Bezeich-
nung derFelderdes
Mittelstückes als
Gemüsebeete.
Zwischen diesen
Extremen liegen
die meisten ande-
ren Lösungen, von
denen der Entwurf
„Eederer“(Seite 64)
hiernoch besonders
erwähnt sein mag,
der bei sonst nicht
übler Grundrißlösung über ein Viertel der ganzen
Fläche zu plattenbelegten Wegen verwendet hat.
Im allgemeinen ist bei den Entwürfen der
Forderung vorzugsweiser Verwendung
von Zwergobst und Formbaum nicht in
dem Sinne entsprochen, wie es das Ausschreiben
verlangte.
Jenem oben erwähnten Ausstellungsgärtchen
gegenüber trat in den Wettbewerbsentwürfen die
Verwendung des Zwerg- und Formobstes nach
Zahl und Anordnung erheblich zurück, und selbst
in den Entwürfen, die am reichlichsten Zwerg-
obst benutzten, wurde kaum das Durchschnitts-
maß überschritten, das man in kleinen Haus-
gärten zu sehen gewohnt ist.
Es ist dies darauf zurückzuführen, daß den
Gartenarchitekten das Formobst und seine Ver-
wendung im Laufe der Zeit fremd geworden ist,
ein Umstand, auf den wir bereits in unsern Ver-
öffentlichungen mehrfach hingewiesen haben. Es
ist notwendig, daß dies wertvolle Gestaltungs-
material künftig wieder mehr in seiner Bedeutung
gewürdigt und in
Klein- und Siedler-
gärten ausgiebig
verwendet wird.
Als verfehlt muß
die Anordnung um-
fangreicher Obst-
laubengänge in
solch kleinen Gär-
ten bezeichnet wer-
den, die in verschie-
denen Entwürfen
vorkommt („Gar-
tenheim“, „Bring-
friede“, „Friede-
Freude“, „Heime-
lig“ u. a.). Der ge-
schlossene Lauben-
gang bildet einen
zu massigen Kör-
per; besser wirkt
er schon, wenn er
nicht geschlossen
ist, sondern aus ein-
zelnen Bögen in
lichtdurchlassen-
den Abständen be-
steht, wie es bei
„Mein Garten, mein
Alles“ und „Be-
scheiden“ der Fall
war.
Von diesen Be-
mängelung en abg e-
sehen, stellten die
drei mit Preisen
bedachten Arbeiten
und auch verschie-
dene andere recht gute Lösungen dar. Der mit
dem ersten Preis ausgezeichnete Entwurf von
R. Stegmiller, Düsseldorf (Seite 58 und 59),
nutzt die verfügbare Gartenfläche außerordent-
lich geschickt und zweckmäßig aus. Die Wege-
flächen sind auf das notwendigste beschränkt,
für Gemüsebau ist, ohne daß der Wohncharakter
zu kurz käme, ausreichend Raum gewonnen. Be-
sonders gelungen erscheinen zahlreiche Einzel-
heiten, so die Anordnung einer Geisblatt-Laube
unterhalb der hochsitzenden kleinen Fenster und
die durch Heckenabschluß erfolgte Trennung des
Wirtschaftshofs und Wohngartens vom übrigen
nfiEDl£n QÄRIENs
vio/zB 2©0 □
,#■
.
Siedlergarten-Wettbewerb. I. Preis.
Gartenarchitekt R. Stegmiller, Düsseldorf.
Vogelschaubild.
58
gebenen Aufgabe besonders gerecht werde. Aber
wenn wir nichts anderes darstellen wollten, als
was Leute dieser Art ohne weiteres aus sich
heraus schaffen können, dann wäre unsere Mit-
arbeit überflüssig. Wir wollen ihnen Anleitung
geben, wie sie, ohne den gegebenen Rahmen
zu verlassen, doch zu einer höheren Stufe ge-
langen können, indem wir ihnen als unerfahrenen
Neulingen weiter-
gehende Gestal-
tungsmöglichkeiten
zeigen und ihr Stre-
ben nach Schönheit
wecken.
Ein Gegenstück
zu „Ordnung“ bil-
det der Entwurf
„Sachlich“ (Seite
62 unten rechts),
der so wenig auf
wirtschaftliche Aus-
nützung Bedacht
nimmt, daß von der
200 qm großen
Fläche mehr als die
Hälfte aufKieswege
entfällt. Die Auf-
teilung entspricht
vollständig dem ty-
pischen Bild eines
städtischen Haus-
gartens, woran auch
nichts geändert
wird durch Bezeich-
nung derFelderdes
Mittelstückes als
Gemüsebeete.
Zwischen diesen
Extremen liegen
die meisten ande-
ren Lösungen, von
denen der Entwurf
„Eederer“(Seite 64)
hiernoch besonders
erwähnt sein mag,
der bei sonst nicht
übler Grundrißlösung über ein Viertel der ganzen
Fläche zu plattenbelegten Wegen verwendet hat.
Im allgemeinen ist bei den Entwürfen der
Forderung vorzugsweiser Verwendung
von Zwergobst und Formbaum nicht in
dem Sinne entsprochen, wie es das Ausschreiben
verlangte.
Jenem oben erwähnten Ausstellungsgärtchen
gegenüber trat in den Wettbewerbsentwürfen die
Verwendung des Zwerg- und Formobstes nach
Zahl und Anordnung erheblich zurück, und selbst
in den Entwürfen, die am reichlichsten Zwerg-
obst benutzten, wurde kaum das Durchschnitts-
maß überschritten, das man in kleinen Haus-
gärten zu sehen gewohnt ist.
Es ist dies darauf zurückzuführen, daß den
Gartenarchitekten das Formobst und seine Ver-
wendung im Laufe der Zeit fremd geworden ist,
ein Umstand, auf den wir bereits in unsern Ver-
öffentlichungen mehrfach hingewiesen haben. Es
ist notwendig, daß dies wertvolle Gestaltungs-
material künftig wieder mehr in seiner Bedeutung
gewürdigt und in
Klein- und Siedler-
gärten ausgiebig
verwendet wird.
Als verfehlt muß
die Anordnung um-
fangreicher Obst-
laubengänge in
solch kleinen Gär-
ten bezeichnet wer-
den, die in verschie-
denen Entwürfen
vorkommt („Gar-
tenheim“, „Bring-
friede“, „Friede-
Freude“, „Heime-
lig“ u. a.). Der ge-
schlossene Lauben-
gang bildet einen
zu massigen Kör-
per; besser wirkt
er schon, wenn er
nicht geschlossen
ist, sondern aus ein-
zelnen Bögen in
lichtdurchlassen-
den Abständen be-
steht, wie es bei
„Mein Garten, mein
Alles“ und „Be-
scheiden“ der Fall
war.
Von diesen Be-
mängelung en abg e-
sehen, stellten die
drei mit Preisen
bedachten Arbeiten
und auch verschie-
dene andere recht gute Lösungen dar. Der mit
dem ersten Preis ausgezeichnete Entwurf von
R. Stegmiller, Düsseldorf (Seite 58 und 59),
nutzt die verfügbare Gartenfläche außerordent-
lich geschickt und zweckmäßig aus. Die Wege-
flächen sind auf das notwendigste beschränkt,
für Gemüsebau ist, ohne daß der Wohncharakter
zu kurz käme, ausreichend Raum gewonnen. Be-
sonders gelungen erscheinen zahlreiche Einzel-
heiten, so die Anordnung einer Geisblatt-Laube
unterhalb der hochsitzenden kleinen Fenster und
die durch Heckenabschluß erfolgte Trennung des
Wirtschaftshofs und Wohngartens vom übrigen
nfiEDl£n QÄRIENs
vio/zB 2©0 □
,#■
.
Siedlergarten-Wettbewerb. I. Preis.
Gartenarchitekt R. Stegmiller, Düsseldorf.
Vogelschaubild.
58