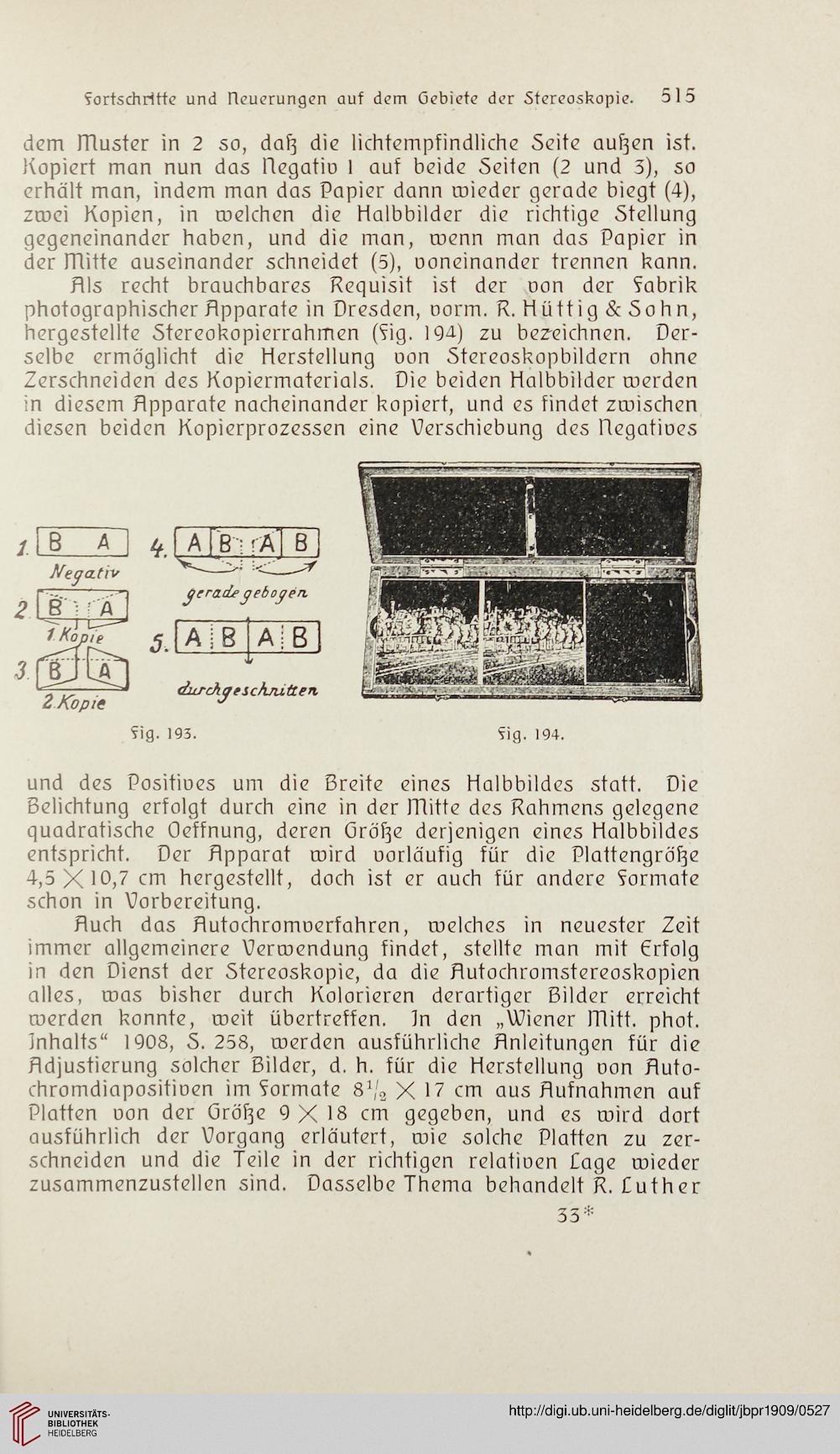Fortschritte und fleuerungen auf dem Gebiete der Stereoskopie. 5 1 5
dem Huster in 2 so, dafj die lichtempfindliche Seite aufjen ist.
Kopiert man nun das negativ» 1 auf beide Seiten (2 und 3), so
erhält man, indem man das Papier dann (nieder gerade biegt (4),
zwei Kopien, in welchen die Halbbilder die richtige Stellung
gegeneinander haben, und die man, wenn man das Papier in
der JTlitte auseinander schneidet (5), uoneinander trennen kann.
Als recht brauchbares Requisit ist der oon der Fabrik
photographischer Apparate in Dresden, norm. R. Hüttig&Sohn,
hergestellte Stereokopierrahmen (?ig. 194) zu bezeichnen. Der-
selbe ermöglicht die Herstellung oon Stereoskopbildern ohne
Zerschneiden des Kopiermaterials. Die beiden Halbbilder werden
in diesem Apparate nacheinander kopiert, und es findet zwischen
diesen beiden Kopierprozessen eine Verschiebung des Flegatioes
Negativ
2 ES
Z Kopie
2 Kopie
1 A |B-- rÄ] B ]
gerade geboten
A iß
Ai B |
durchyeichju.tt.en.
Fig. 193.
Fig. 194.
und des Positioes um die Breite eines Halbbildes statt. Die
Belichtung erfolgt durch eine in der mitte des Rahmens gelegene
quadratische Oeffnung, deren Gröfje derjenigen eines Halbbildes
entspricht. Der Apparat wird oorläufig für die Plattengräfje
4,5X10,7 cm hergestellt, doch ist er auch für andere Formate
schon in Vorbereitung.
Auch das Autochromoerfahren, welches in neuester Zeit
immer allgemeinere Verwendung findet, stellte man mit Erfolg
in den Dienst der Stereoskopie, da die Autochromstereoskopien
alles, was bisher durch Kolorieren derartiger Bilder erreicht
werden konnte, weit übertreffen. Jn den „Wiener mitt. phot.
Inhalts“ 1908, 5. 258, werden ausführliche Anleitungen für die
Adjustierung solcher Bilder, d. h. für die Herstellung oon Aufo-
chromdiapositioen im Formate X 17 cm aus Aufnahmen auf
Platten oon der Gröfje 9X18 cm gegeben, und es wird dort
ausführlich der Vorgang erläutert, wie solche Platten zu zer-
schneiden und die Teile in der richtigen relatioen £age wieder
zusammenzustellen sind. Dasselbe Thema behandelt R. Cuther
33*
dem Huster in 2 so, dafj die lichtempfindliche Seite aufjen ist.
Kopiert man nun das negativ» 1 auf beide Seiten (2 und 3), so
erhält man, indem man das Papier dann (nieder gerade biegt (4),
zwei Kopien, in welchen die Halbbilder die richtige Stellung
gegeneinander haben, und die man, wenn man das Papier in
der JTlitte auseinander schneidet (5), uoneinander trennen kann.
Als recht brauchbares Requisit ist der oon der Fabrik
photographischer Apparate in Dresden, norm. R. Hüttig&Sohn,
hergestellte Stereokopierrahmen (?ig. 194) zu bezeichnen. Der-
selbe ermöglicht die Herstellung oon Stereoskopbildern ohne
Zerschneiden des Kopiermaterials. Die beiden Halbbilder werden
in diesem Apparate nacheinander kopiert, und es findet zwischen
diesen beiden Kopierprozessen eine Verschiebung des Flegatioes
Negativ
2 ES
Z Kopie
2 Kopie
1 A |B-- rÄ] B ]
gerade geboten
A iß
Ai B |
durchyeichju.tt.en.
Fig. 193.
Fig. 194.
und des Positioes um die Breite eines Halbbildes statt. Die
Belichtung erfolgt durch eine in der mitte des Rahmens gelegene
quadratische Oeffnung, deren Gröfje derjenigen eines Halbbildes
entspricht. Der Apparat wird oorläufig für die Plattengräfje
4,5X10,7 cm hergestellt, doch ist er auch für andere Formate
schon in Vorbereitung.
Auch das Autochromoerfahren, welches in neuester Zeit
immer allgemeinere Verwendung findet, stellte man mit Erfolg
in den Dienst der Stereoskopie, da die Autochromstereoskopien
alles, was bisher durch Kolorieren derartiger Bilder erreicht
werden konnte, weit übertreffen. Jn den „Wiener mitt. phot.
Inhalts“ 1908, 5. 258, werden ausführliche Anleitungen für die
Adjustierung solcher Bilder, d. h. für die Herstellung oon Aufo-
chromdiapositioen im Formate X 17 cm aus Aufnahmen auf
Platten oon der Gröfje 9X18 cm gegeben, und es wird dort
ausführlich der Vorgang erläutert, wie solche Platten zu zer-
schneiden und die Teile in der richtigen relatioen £age wieder
zusammenzustellen sind. Dasselbe Thema behandelt R. Cuther
33*