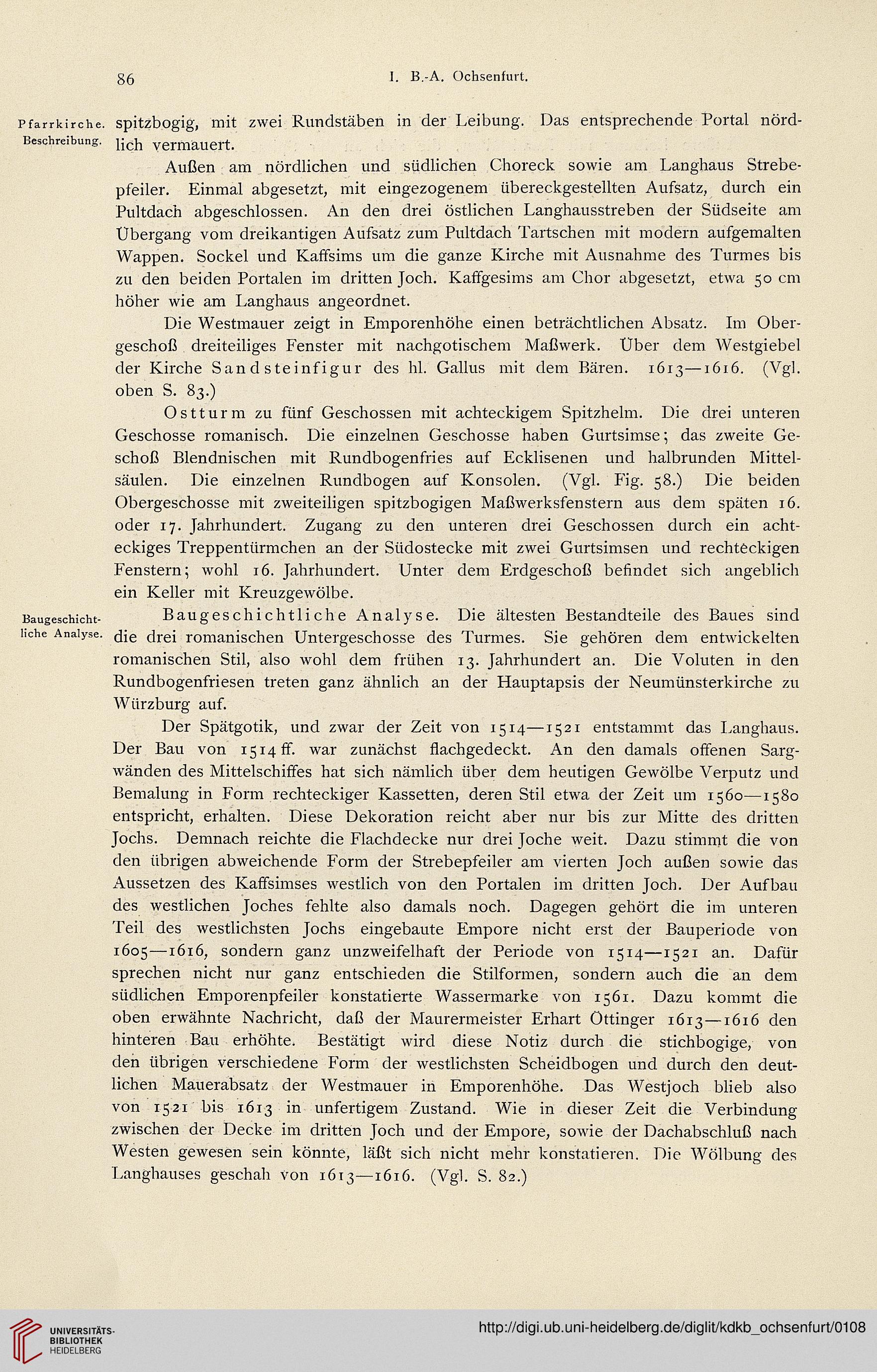86
]. B.-A. Ochsenfurt.
Pfarrkirche, spitzbogig, mit zwei Rundstäben in der Leibung. Das entsprechende Portal nörd-
Heschretbung. vermauert.
Außen am nördlichen und südlichen Choreck sowie am Langhaus Strebe-
pfeiler. Einmal abgesetzt, mit eingezogenem übereckgestellten Aufsatz, durch ein
Pultdach abgeschlossen. An den drei östlichen Langhausstreben der Südseite am
Übergang vom dreikantigen Aufsatz zum Pultdach Tartschen mit modern aufgemalten
Wappen. Sockel und Kaffsims um die ganze Kirche mit Ausnahme des Turmes bis
zu den beiden Portalen im dritten Joch. Kaffgesims am Chor abgesetzt, etwa 50 cm
höher wie am Langhaus angeordnet.
Die Westmauer zeigt in Emporenhöhe einen beträchtlichen Absatz. Im Ober-
geschoß dreiteiliges Fenster mit nachgotischem Maßwerk. Uber dem Westgiebel
der Kirche Sandsteinfigur des hl. Gallus mit dem Hären. 1613—]6i6. (Vgl.
oben S. 83.)
Ostturm zu fünf Geschossen mit achteckigem Spitzhelm. Die drei unteren
Geschosse romanisch. Die einzelnen Geschosse haben Gurtsimse; das zweite Ge-
schoß Blendnischen mit Rundbogenfries auf Ecklisenen und halbrunden Mittel-
säulen. Die einzelnen Rundbogen auf Konsolen. (Vgl. Fig. 58.) Die beiden
Obergeschosse mit zweiteiligen spitzbogigen Maßwerksfenstern aus dem späten 16.
oder 17. Jahrhundert. Zugang zu den unteren drei Geschossen durch ein acht-
eckiges Treppentürmchen an der Südostecke mit zwei Gurtsimsen und rechteckigen
Fenstern; wohl 16. Jahrhundert. Unter dem Erdgeschoß befindet sich angeblich
ein Keller mit Kreuzgewölbe.
Baugeschicht- Baugeschichtliche Analyse. Die ältesten Bestandteile des Baues sind
hche Analyse, die drei romanischen Untergeschosse des Turmes. Sie gehören dem entwickelten
romanischen Stil, also wohl dem frühen 13. Jahrhundert an. Die Voluten in den
Rundbogenfriesen treten ganz ähnlich an der Hauptapsis der Neumünsterkirche zu
Würzburg auf.
Der Spätgotik, und zwar der Zeit von 1514—1321 entstammt das Langhaus.
Der Bau von 1314 ff. war zunächst flachgedeckt. An den damals offenen Sarg-
wälnden des Mittelschiffes hat sich nämlich über dem heutigen Gewölbe Verputz und
Bemalung in Form rechteckiger Kassetten, deren Stil etwa der Zeit um 1360—1580
entspricht, erhalten. Diese Dekoration reicht aber nur bis zur Mitte des dritten
Jochs. Demnach reichte die Flachdecke nur drei Joche weit. Dazu stimmt die von
den übrigen abweichende Form der Strebepfeiler am vierten Joch außen sowie das
Aussetzen des Kaffsimses westlich von den Portalen im dritten Joch. Der Aufbau
des westlichen Joches fehlte also damals noch. Dagegen gehört die im unteren
Teil des westlichsten Jochs eingebaute Empore nicht erst der Bauperiode von
1603—1616, sondern ganz unzweifelhaft der Periode von 1314—1321 an. Dafür
sprechen nicht nur ganz entschieden die Stilformen, sondern auch die an dem
südlichen Emporenpfeiler konstatierte Wassermarke von 1361. Dazu kommt die
oben erwähnte Nachricht, daß der Maurermeister Erhärt Ottinger 1613 —1616 den
hinteren Bau erhöhte. Bestätigt wird diese Notiz durch die stichbogige, von
den übrigen verschiedene Form der westlichsten Scheidbogen und durch den deut-
lichen Mauerabsatz der Westmauer in Emporenhöhe. Das Westjoch blieb also
von 1321 bis 1613 in unfertigem Zustand. Wie in dieser Zeit die Verbindung
zwischen der Decke im dritten Joch und der Empore, sowie der Dachabschluß nach
Westen gewesen sein könnte, läßt sich nicht mehr konstatieren. Die Wölbung des
Langhauses geschah von 1613—1616. (Vgl. S. 82.)
]. B.-A. Ochsenfurt.
Pfarrkirche, spitzbogig, mit zwei Rundstäben in der Leibung. Das entsprechende Portal nörd-
Heschretbung. vermauert.
Außen am nördlichen und südlichen Choreck sowie am Langhaus Strebe-
pfeiler. Einmal abgesetzt, mit eingezogenem übereckgestellten Aufsatz, durch ein
Pultdach abgeschlossen. An den drei östlichen Langhausstreben der Südseite am
Übergang vom dreikantigen Aufsatz zum Pultdach Tartschen mit modern aufgemalten
Wappen. Sockel und Kaffsims um die ganze Kirche mit Ausnahme des Turmes bis
zu den beiden Portalen im dritten Joch. Kaffgesims am Chor abgesetzt, etwa 50 cm
höher wie am Langhaus angeordnet.
Die Westmauer zeigt in Emporenhöhe einen beträchtlichen Absatz. Im Ober-
geschoß dreiteiliges Fenster mit nachgotischem Maßwerk. Uber dem Westgiebel
der Kirche Sandsteinfigur des hl. Gallus mit dem Hären. 1613—]6i6. (Vgl.
oben S. 83.)
Ostturm zu fünf Geschossen mit achteckigem Spitzhelm. Die drei unteren
Geschosse romanisch. Die einzelnen Geschosse haben Gurtsimse; das zweite Ge-
schoß Blendnischen mit Rundbogenfries auf Ecklisenen und halbrunden Mittel-
säulen. Die einzelnen Rundbogen auf Konsolen. (Vgl. Fig. 58.) Die beiden
Obergeschosse mit zweiteiligen spitzbogigen Maßwerksfenstern aus dem späten 16.
oder 17. Jahrhundert. Zugang zu den unteren drei Geschossen durch ein acht-
eckiges Treppentürmchen an der Südostecke mit zwei Gurtsimsen und rechteckigen
Fenstern; wohl 16. Jahrhundert. Unter dem Erdgeschoß befindet sich angeblich
ein Keller mit Kreuzgewölbe.
Baugeschicht- Baugeschichtliche Analyse. Die ältesten Bestandteile des Baues sind
hche Analyse, die drei romanischen Untergeschosse des Turmes. Sie gehören dem entwickelten
romanischen Stil, also wohl dem frühen 13. Jahrhundert an. Die Voluten in den
Rundbogenfriesen treten ganz ähnlich an der Hauptapsis der Neumünsterkirche zu
Würzburg auf.
Der Spätgotik, und zwar der Zeit von 1514—1321 entstammt das Langhaus.
Der Bau von 1314 ff. war zunächst flachgedeckt. An den damals offenen Sarg-
wälnden des Mittelschiffes hat sich nämlich über dem heutigen Gewölbe Verputz und
Bemalung in Form rechteckiger Kassetten, deren Stil etwa der Zeit um 1360—1580
entspricht, erhalten. Diese Dekoration reicht aber nur bis zur Mitte des dritten
Jochs. Demnach reichte die Flachdecke nur drei Joche weit. Dazu stimmt die von
den übrigen abweichende Form der Strebepfeiler am vierten Joch außen sowie das
Aussetzen des Kaffsimses westlich von den Portalen im dritten Joch. Der Aufbau
des westlichen Joches fehlte also damals noch. Dagegen gehört die im unteren
Teil des westlichsten Jochs eingebaute Empore nicht erst der Bauperiode von
1603—1616, sondern ganz unzweifelhaft der Periode von 1314—1321 an. Dafür
sprechen nicht nur ganz entschieden die Stilformen, sondern auch die an dem
südlichen Emporenpfeiler konstatierte Wassermarke von 1361. Dazu kommt die
oben erwähnte Nachricht, daß der Maurermeister Erhärt Ottinger 1613 —1616 den
hinteren Bau erhöhte. Bestätigt wird diese Notiz durch die stichbogige, von
den übrigen verschiedene Form der westlichsten Scheidbogen und durch den deut-
lichen Mauerabsatz der Westmauer in Emporenhöhe. Das Westjoch blieb also
von 1321 bis 1613 in unfertigem Zustand. Wie in dieser Zeit die Verbindung
zwischen der Decke im dritten Joch und der Empore, sowie der Dachabschluß nach
Westen gewesen sein könnte, läßt sich nicht mehr konstatieren. Die Wölbung des
Langhauses geschah von 1613—1616. (Vgl. S. 82.)