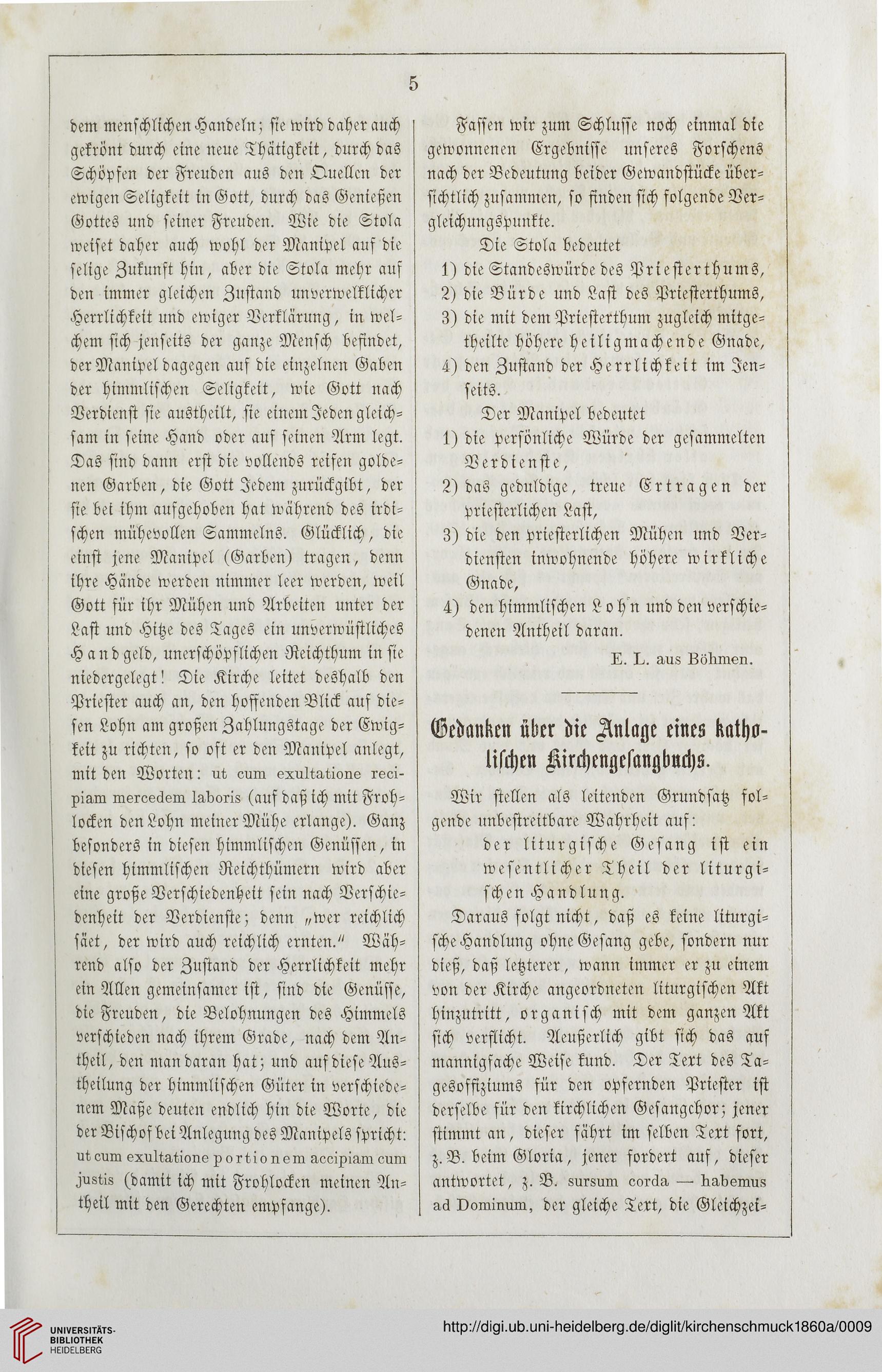dem menschlichen Handeln; sie wird daher auch
gekront durch eine neue Thätigkeit, durch das
Schöpfen der Freuden aus den Quellen der
ewigen Seligkeit in Gott, durch das Genießen
Gottes und seiner Freuden. Wie die Stola
weiset daher auch wohl der Manipel aus die
selige Zukunft hin, aber die Stola mehr auf
den immer gleichen Zustand unverwelklicher
Herrlichkeit und ewiger Verklärung, in wel-
chem sich jenseits der ganze Mensch befindet,
derManipel dagegen auf die einzelnen Gaben
der himmlischen Seligkeit, wie Gott nach
Verdienst sie austheilt, sie einem Jeden gleich-
sam in seine Hand oder auf seinen Arm legt.
Das stnd dann erst die vollends reisen golde-
nen Garben, die Gott Jedem zurückgibt, der
sie bei ihm aufgehoben hat während des irdi-
schen mühevollen Sammelns. Glücklich, die
einst jene Manipel (Garben) tragen, denn
ihre Hände werden nimmer leer werden, weil
Gott für ihr Mühen und Arbeiten unter der
Last und Hitze des Tages ein unverwüstliches
H and geld, unerschöpslichen Reichthum in ste
niedergelegt! Die Kirche leitet deshalb den
Priester auch an, den hoffenden Blick auf die-
sen Lohn am grofien Zahlungstage der Ewig-
keit zu richten, so oft er den Manipel anlegt,
mit den Worten: nt euin exnltÄtionL reoi-
xinin llisrooäem 1nbori8 (auf dafi ich mit Froh-
locken den Lohn meiner Mühe erlange). Ganz
besonders in diesen himmlischen Genüssen, in
diesen himmlischen Reichthümern wird aber
eine große Verschiedenheit sein nach Verschie-
denheit der Verdienste; denn ,/wer reichlich
säet, der wird auch reichlich ernten." Wäh-
rend also der Zustand der Herrlichkeit mehr
ein Allen gemeinsamer ist, stnd die Genüsse,
die Freuden, die Belohnungen des Himmels
verschieden nach ihrem Grade, nach dem An-
theil, den mandaran hat; und aufdieseAus-
theilung der himmlischen Güter in verschiede-
nem Mafie deuten endlich hin die Worte, die
der Bischof bei Anlegung des Manipels spricht:
llt ollill 6Xll1tLtioll6 ^)ort.ioll6m aooi^iam ollm
jll8ti8 (damit ich mit Frohlocken meinen An-
theil mit den Gerechten empfange).
Fassen wir zum Schluffe noch einmal die
gewonnenen Ergebnisse unseres Forschens
nach der Bedeutung beider Gewandftücke über-
stchtlich zusammen, so stnden stch solgende Ver-
gleichungspunkte.
Die Stola bedeutet
1) die Standeswürde des Priesterthums,
2) die Bürde und Last des Prkesterthums,
3) die mit dem Priesterthum zugleich mitge-
theilte höhere heiligmachende Gnade,
4) den Zustand der Herrlichkeit im Jen-
seits.
Der Manipel bedeutet
1) die persönliche Würde der gesammelten
Verdienste,
2) das geduldige, treue Ertragen der
priesterlichen Last,
3) die den priesterlichen Mühen und Ver-
diensten inwohnende höhere wirkliche
Gnade,
4) den himmlischen L o h n und den verschie-
denen Antheil daran.
L. Q Ull8 Lollmell.
Gedlmken üker die Inlage eine5 katho-
lischen Kirchengesangtmcho.
Wir ftellen als leitenden Grundsatz sol-
gende unbestreitbare Wahrheit auf:
der liturgische Gesang ist ein
wesentlicher Theil der liturgi-
schen Handlung.
Daraus folgt nicht, dafi es keine liturgi-
sche Handlung ohne Gesang gebe, sondern nur
diefi, dafi letzterer, wann immer er zu einem
von der Kirche angeordneten liturgischen Akt
hinzutritt, organisch mit dem ganzen Akt
stch verflicht. Aeufierlich gibt stch das auf
mannigfache Weise kund. Der Tert des Ta-
gesosfiziums für den opfernden Priester ist
derselbe für den kirchlichen Gesangchor; jener
stimmt an, dieser fährt im selben Tert sort,
z. B. beim Gloria, jener fordert auf, dieser
antwortet, z. B. 8m-8llin oorän — 1iab6Mll8
^ aä vomillllm, der gleiche Tert, die Gleichzei-
gekront durch eine neue Thätigkeit, durch das
Schöpfen der Freuden aus den Quellen der
ewigen Seligkeit in Gott, durch das Genießen
Gottes und seiner Freuden. Wie die Stola
weiset daher auch wohl der Manipel aus die
selige Zukunft hin, aber die Stola mehr auf
den immer gleichen Zustand unverwelklicher
Herrlichkeit und ewiger Verklärung, in wel-
chem sich jenseits der ganze Mensch befindet,
derManipel dagegen auf die einzelnen Gaben
der himmlischen Seligkeit, wie Gott nach
Verdienst sie austheilt, sie einem Jeden gleich-
sam in seine Hand oder auf seinen Arm legt.
Das stnd dann erst die vollends reisen golde-
nen Garben, die Gott Jedem zurückgibt, der
sie bei ihm aufgehoben hat während des irdi-
schen mühevollen Sammelns. Glücklich, die
einst jene Manipel (Garben) tragen, denn
ihre Hände werden nimmer leer werden, weil
Gott für ihr Mühen und Arbeiten unter der
Last und Hitze des Tages ein unverwüstliches
H and geld, unerschöpslichen Reichthum in ste
niedergelegt! Die Kirche leitet deshalb den
Priester auch an, den hoffenden Blick auf die-
sen Lohn am grofien Zahlungstage der Ewig-
keit zu richten, so oft er den Manipel anlegt,
mit den Worten: nt euin exnltÄtionL reoi-
xinin llisrooäem 1nbori8 (auf dafi ich mit Froh-
locken den Lohn meiner Mühe erlange). Ganz
besonders in diesen himmlischen Genüssen, in
diesen himmlischen Reichthümern wird aber
eine große Verschiedenheit sein nach Verschie-
denheit der Verdienste; denn ,/wer reichlich
säet, der wird auch reichlich ernten." Wäh-
rend also der Zustand der Herrlichkeit mehr
ein Allen gemeinsamer ist, stnd die Genüsse,
die Freuden, die Belohnungen des Himmels
verschieden nach ihrem Grade, nach dem An-
theil, den mandaran hat; und aufdieseAus-
theilung der himmlischen Güter in verschiede-
nem Mafie deuten endlich hin die Worte, die
der Bischof bei Anlegung des Manipels spricht:
llt ollill 6Xll1tLtioll6 ^)ort.ioll6m aooi^iam ollm
jll8ti8 (damit ich mit Frohlocken meinen An-
theil mit den Gerechten empfange).
Fassen wir zum Schluffe noch einmal die
gewonnenen Ergebnisse unseres Forschens
nach der Bedeutung beider Gewandftücke über-
stchtlich zusammen, so stnden stch solgende Ver-
gleichungspunkte.
Die Stola bedeutet
1) die Standeswürde des Priesterthums,
2) die Bürde und Last des Prkesterthums,
3) die mit dem Priesterthum zugleich mitge-
theilte höhere heiligmachende Gnade,
4) den Zustand der Herrlichkeit im Jen-
seits.
Der Manipel bedeutet
1) die persönliche Würde der gesammelten
Verdienste,
2) das geduldige, treue Ertragen der
priesterlichen Last,
3) die den priesterlichen Mühen und Ver-
diensten inwohnende höhere wirkliche
Gnade,
4) den himmlischen L o h n und den verschie-
denen Antheil daran.
L. Q Ull8 Lollmell.
Gedlmken üker die Inlage eine5 katho-
lischen Kirchengesangtmcho.
Wir ftellen als leitenden Grundsatz sol-
gende unbestreitbare Wahrheit auf:
der liturgische Gesang ist ein
wesentlicher Theil der liturgi-
schen Handlung.
Daraus folgt nicht, dafi es keine liturgi-
sche Handlung ohne Gesang gebe, sondern nur
diefi, dafi letzterer, wann immer er zu einem
von der Kirche angeordneten liturgischen Akt
hinzutritt, organisch mit dem ganzen Akt
stch verflicht. Aeufierlich gibt stch das auf
mannigfache Weise kund. Der Tert des Ta-
gesosfiziums für den opfernden Priester ist
derselbe für den kirchlichen Gesangchor; jener
stimmt an, dieser fährt im selben Tert sort,
z. B. beim Gloria, jener fordert auf, dieser
antwortet, z. B. 8m-8llin oorän — 1iab6Mll8
^ aä vomillllm, der gleiche Tert, die Gleichzei-