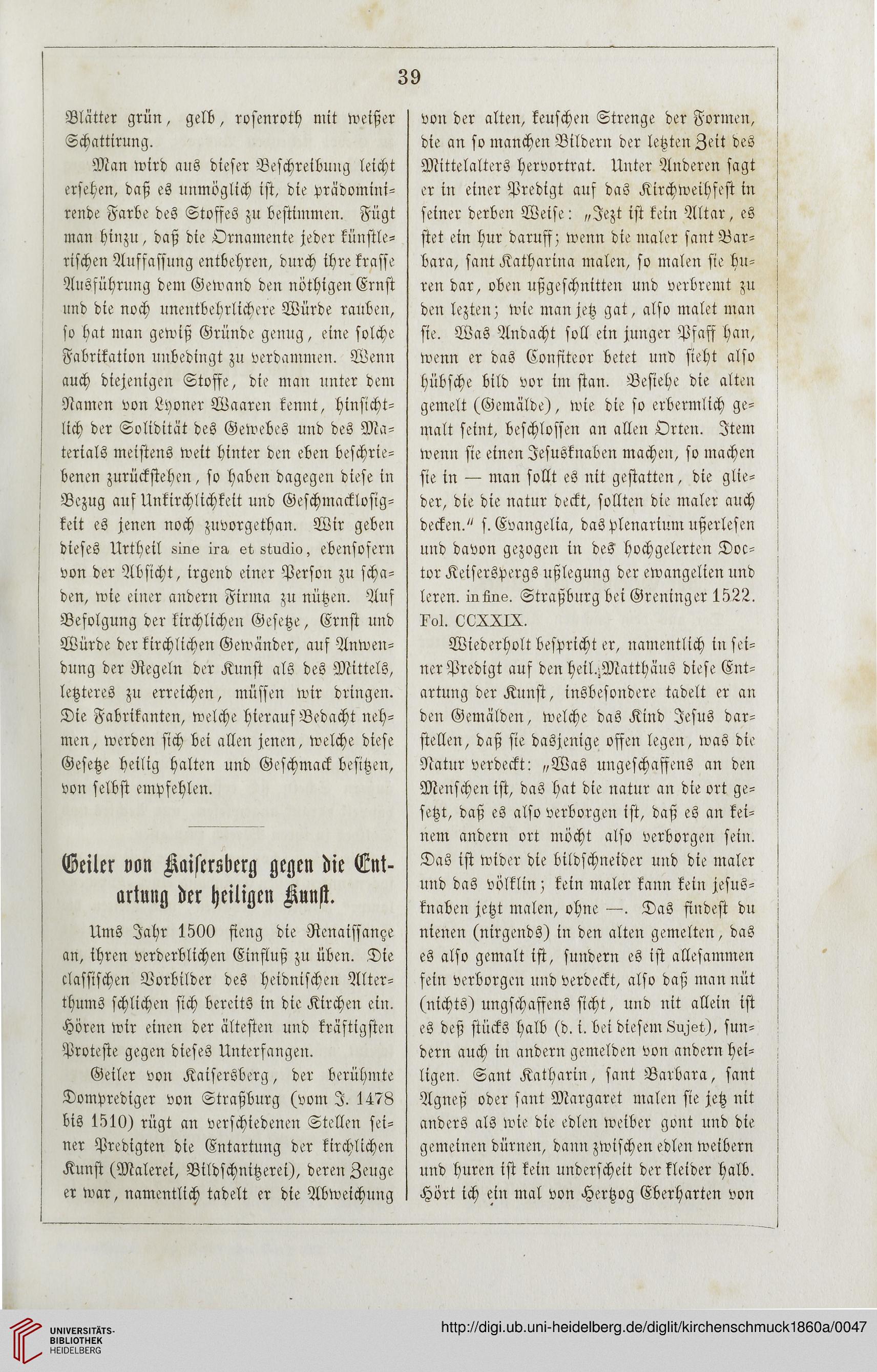39
Blätter grün, gelb, rosenroth mit weißer
Schattirung.
Man wird aus dieser Beschreibung leicht
ersehen, daß es unmöglich ist, die prädomini-
rende Farbe des Stoffes zu bestimmen. Fügt
man hinzu, daß die Ornamente jeder künstle-
rischen Auffaffung entbehren, durch ihre kraffe
Ausführung dem Gewand den nöthigen Ernst
und die noch unentbehrlichere Würde rauben,
so hat man gewiß Gründe genug, eine solche
Fabrikation unbedingt zu verdammen. Wenn
auch dtejenigen Stoffe, die man nnter dem
Namen von Lyoner Waaren kennt, hinsicht-
lich der Solidität des Gewebes und des Ma-
terials meistens weit hinter den eben beschrie-
i benen zurückstehen, so haben dagegen diese in
! Bezug auf Unkirchlichkeit und Geschmacklosig-
! keit es jenen noch zuvorgethan. Wir geben
dieses Urtheil siiis ii-u st stuäic», ebensofern
von der Absicht, irgend einer Person zu scha-
den, wie einer andern Firma zu nützen. Auf
Befolgung der kirchlichen Gesetze, Ernst und
Würde der kirchlichen Gewänder, auf Anwen-
dung der Regeln der Kunst als des Mittels,
letzteres zu erreichen, müssen wir dringen.
Die Fabrikanten, welche hierauf Bedacht neh-
men, werden sich bei allen jenen, welche diese
Gesetze heilig halten und Geschmack besitzen,
von selbst empfehlen.
Geüer von Kaisersberg gegen -ie Enl-
artung der heiligen Kunj).
Ums Jahr 1500 fieng die Renaissantze
an, ihren verderblichen Einflufi zu üben. Die
classischen Vorbilder des heidnischen Alter-
thums schlichen sich bereits in die Kirchen ein.
Hören wir einen der ältesten und kräftigsten
Proteste gegen dieses Unterfangen.
Geiler von Kaisersberg, der berühmte
Domprediger von Strafiburg (vom I. 1478
bis 1510) rügt an verschiedenen Stellen sei-
ner Predigten die Entartung der kirchlichen
Kunst (Malerei, Bildschnitzerei), deren Zeuge
er war, namentlich tadelt er die Abweichung
von der alten, keuschen Strenge der Formen,
die an so manchen Bildern der letzten Zeit des
Mittelalters hervortrat. Unter Anderen sagt
er in einer Predigt auf das Kirchweihfest in
seiner derben Weise: „Jezt ist kein Altar, es
stet ein hur daruff; wenn die maler sant Bar-
bara, sant Katharina malen, so malen sie hu-
ren dar, oben ußgeschnitten und verbremt zu
den lezten; wie man jetz gat, also malet man
sie. Was Andacht soll ein junger Pfaff han,
wenn er das Confiteor betet und sieht also
hübsche bild vor im stan. Besiehe die alten
gemelt (Gemälde), wie die so erbermlich ge-
malt seint, beschlossen an allen Orten. Jtem
wenn sie einen Jesusknaben machen, so machen
fie in — man sollt es nit gestatten, die glie-
der, die die natur deckt, sollten die maler auch
decken." s. Evangelia, das plenarium ufierlesen
und davon gezogen in des hochgelerten Doc-
tor Keiserspergs ußlegung der ewangelien und
leren. inLns. Strafiburg bei Greninger 1522.
Uol. OOLLIL.
Wiederholt bespricht er, namentlich in sei-
ner Predigt auf den heil.Matthäus diese Ent-
artung der Kunst, insbesondere tadelt er an
den Gemälden, welche das Kind Jesus dar-
stellen, daß sie dasjenige offen legen, was die
Natur verdeckt: „Was ungeschaffens an den
Menschen ist, das hat die natur an die ort ge-
setzt, dafi es also verborgen ist, dafi es an kei-
nem andern ort möcht also verborgen sein.
Das ist wider dte bildschneider und die maler
und das völklin; kein maler kann kein jesus-
knaben jetzt malen, ohne —. Das findest du
nienen (nirgends) in den alten gemelten, das
es also gemalt ift, sundern es ist allesammen
fein verborgen und verdeckt, also dafi man nüt
(nichts) ungschaffens ficht, und nit allein ist
es defi stücks halb (d. i. bei diesem Lujet). sun-
dern auch in andern gemelden von andern het-
ligen. Sant Katharin, sant Barbara, sant
Agneß oder sant Margaret malen fie jetz nit
anders als wie die edlen weiber gont und die
gemeinen dürnen, dann zwischen edlen weibern
und huren ist kein underscheit der kleider halb.
Hört ich ein mal von Hertzog Eberharten von
Blätter grün, gelb, rosenroth mit weißer
Schattirung.
Man wird aus dieser Beschreibung leicht
ersehen, daß es unmöglich ist, die prädomini-
rende Farbe des Stoffes zu bestimmen. Fügt
man hinzu, daß die Ornamente jeder künstle-
rischen Auffaffung entbehren, durch ihre kraffe
Ausführung dem Gewand den nöthigen Ernst
und die noch unentbehrlichere Würde rauben,
so hat man gewiß Gründe genug, eine solche
Fabrikation unbedingt zu verdammen. Wenn
auch dtejenigen Stoffe, die man nnter dem
Namen von Lyoner Waaren kennt, hinsicht-
lich der Solidität des Gewebes und des Ma-
terials meistens weit hinter den eben beschrie-
i benen zurückstehen, so haben dagegen diese in
! Bezug auf Unkirchlichkeit und Geschmacklosig-
! keit es jenen noch zuvorgethan. Wir geben
dieses Urtheil siiis ii-u st stuäic», ebensofern
von der Absicht, irgend einer Person zu scha-
den, wie einer andern Firma zu nützen. Auf
Befolgung der kirchlichen Gesetze, Ernst und
Würde der kirchlichen Gewänder, auf Anwen-
dung der Regeln der Kunst als des Mittels,
letzteres zu erreichen, müssen wir dringen.
Die Fabrikanten, welche hierauf Bedacht neh-
men, werden sich bei allen jenen, welche diese
Gesetze heilig halten und Geschmack besitzen,
von selbst empfehlen.
Geüer von Kaisersberg gegen -ie Enl-
artung der heiligen Kunj).
Ums Jahr 1500 fieng die Renaissantze
an, ihren verderblichen Einflufi zu üben. Die
classischen Vorbilder des heidnischen Alter-
thums schlichen sich bereits in die Kirchen ein.
Hören wir einen der ältesten und kräftigsten
Proteste gegen dieses Unterfangen.
Geiler von Kaisersberg, der berühmte
Domprediger von Strafiburg (vom I. 1478
bis 1510) rügt an verschiedenen Stellen sei-
ner Predigten die Entartung der kirchlichen
Kunst (Malerei, Bildschnitzerei), deren Zeuge
er war, namentlich tadelt er die Abweichung
von der alten, keuschen Strenge der Formen,
die an so manchen Bildern der letzten Zeit des
Mittelalters hervortrat. Unter Anderen sagt
er in einer Predigt auf das Kirchweihfest in
seiner derben Weise: „Jezt ist kein Altar, es
stet ein hur daruff; wenn die maler sant Bar-
bara, sant Katharina malen, so malen sie hu-
ren dar, oben ußgeschnitten und verbremt zu
den lezten; wie man jetz gat, also malet man
sie. Was Andacht soll ein junger Pfaff han,
wenn er das Confiteor betet und sieht also
hübsche bild vor im stan. Besiehe die alten
gemelt (Gemälde), wie die so erbermlich ge-
malt seint, beschlossen an allen Orten. Jtem
wenn sie einen Jesusknaben machen, so machen
fie in — man sollt es nit gestatten, die glie-
der, die die natur deckt, sollten die maler auch
decken." s. Evangelia, das plenarium ufierlesen
und davon gezogen in des hochgelerten Doc-
tor Keiserspergs ußlegung der ewangelien und
leren. inLns. Strafiburg bei Greninger 1522.
Uol. OOLLIL.
Wiederholt bespricht er, namentlich in sei-
ner Predigt auf den heil.Matthäus diese Ent-
artung der Kunst, insbesondere tadelt er an
den Gemälden, welche das Kind Jesus dar-
stellen, daß sie dasjenige offen legen, was die
Natur verdeckt: „Was ungeschaffens an den
Menschen ist, das hat die natur an die ort ge-
setzt, dafi es also verborgen ist, dafi es an kei-
nem andern ort möcht also verborgen sein.
Das ist wider dte bildschneider und die maler
und das völklin; kein maler kann kein jesus-
knaben jetzt malen, ohne —. Das findest du
nienen (nirgends) in den alten gemelten, das
es also gemalt ift, sundern es ist allesammen
fein verborgen und verdeckt, also dafi man nüt
(nichts) ungschaffens ficht, und nit allein ist
es defi stücks halb (d. i. bei diesem Lujet). sun-
dern auch in andern gemelden von andern het-
ligen. Sant Katharin, sant Barbara, sant
Agneß oder sant Margaret malen fie jetz nit
anders als wie die edlen weiber gont und die
gemeinen dürnen, dann zwischen edlen weibern
und huren ist kein underscheit der kleider halb.
Hört ich ein mal von Hertzog Eberharten von