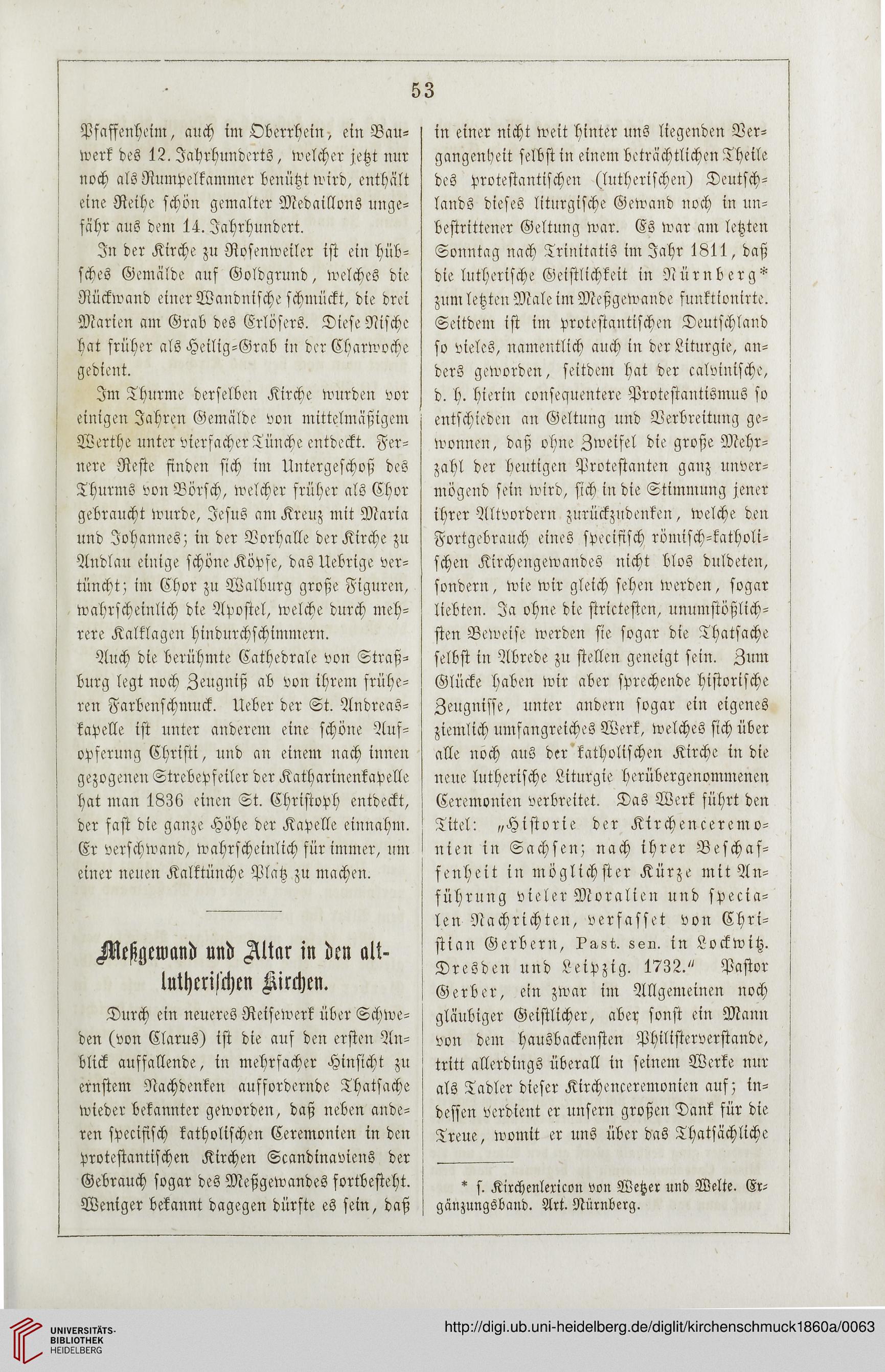53
Pfaffenhmn, auch im Oberrhein, ein Bau-
werk des 12. Jahrhunderts, welcher fetzt nur
noch als Rumpelkammer benützt wird, enthält
eine Reihe schön gemalter Medaillons unge-
fähr aus deni 14. Jahrhundert.
Jn der Kirche zu Rosenweiler ist ein hüb-
sches Gemälde aus Goldgrund, welches die
Rückwand einerWandnische schmückt, die drei
Marien am Grab des Erlösers. Diese Nische
hat früher als Heilig-Grab in der Charwoche
gedient.
Jm Thurme derselben Kirche wurden vor
einigen Jahren Gemälde von nüttelmäßigem
! Werthe unter vierfacherTünche entdeckt. Fer-
j nere Reste findeu fich im Untergeschoß des
Thurms von Börsch, welcher früher als Chor
gebraucht wurde, Jesus am Kreuz nüt Maria
und Johannes; in der Vorhalle der Kirche zu
Audlau einige schöne Köpse, das Uebrige ver-
tüncht; im Chor zu Walburg große Figuren,
wahrscheinlich die Apostel, welche durch meh-
^ rere Kalklagen hindurchschimmern.
Auch die berühmte Cathedrale von Straß-
burg legt noch Zeugniß ab von ihrem srühe-
ren Farbenschmuck. Ueber der St. Andreas-
kapelle ist unter anderem eine schöne Aus-
opserung Christi, und au einem nach innen
I gezogenen Strebepfeiler der Katharinenkapelle
hat man 1836 einen St. Christoph entdeckt,
der fast die ganze Höhe der Kapelle einnahm.
Er verschwand, wahrscheinlich für immer, um
einer neuen Kalktünche Platz zu machen.
Meßgeuiand und Illar in den all-
luiherischen Kirchen.
Durch ein neueres Reisewerk über Schwe-
den (von Clarus) ist die auf den ersten An-
blick aussallende, in mehrfacher Hinsicht zu
ernstem Nachdenken auffordernde Thatsache
wieder bekannter gewordeu, daß neben ande-
ren specifisch katholischen Ceremonien in den
protestantischen Kirchen Scandinaviens der
Gebrauch sogar des Meßgewandes fortbesteht.
Weniger bekannt dagegen dürfte es sein, daß
in einer nicht weit hinter uns liegenden Ver-
gangenheit selbst in einem beträchtlichen Theile
des proteftantischen (lutherischen) Deutsch-
lands dieses liturgische Gewand noch in un-
bestrittener Geltung war. Es war am letzten
Sonntag nach Trinitatis im Jahr 1811, daß
die lutherische Geistlichkeit in Nürnberg*
zum letzten Male im Meßgewande funktionirte.
Seitdem ist im protestantischen Deutschland
so vieles, uamentlich auch in der Liturgie, an-
ders geworden, seitdem hat der calvinische,
d. h. hierin conseguentere Protestantismus so
entschieden an Geltung und Verbreitung ge-
wonnen, daß ohne Zweifel die große Mehr-
zahl der heutigen Protestanten ganz unver-
mögend sein wird, ftch in die Stimmung jener
ihrer Altvordern zurückzndenken, welche den
Fortgebrauch eines specifisch rönüsch-katholi-
schen Kirchengewandes nicht blos duldeten,
sondern, wie wir gleich sehen werden, sogar
liebten. Ja ohne die strictesten, unumstößlich-
sten Beweise werden fte sogar die Thatsache
selbst in Abrede zu stellen geneigt sein. Zum
Glücke haben wir aber sprechende historische
Zeugnisse, unter andern sogar ein eigenes
ziemlich umfangreiches Werk, welches sich über
alle noch aus der katholischen Kirche in die
neue lutherische Liturgie herübergenommenen
Ceremonien verbreitet. Das Werk sührt den
Titel: „Historie der Kirchenceremo-
nien in Sachsen; nach ihrer Beschas-
senheit in möglichster Kürze mit An-
führung vieler Moralien und specia-
len Nachrichten, verfasset von Chri-
stian Gerbern, ssn. in Lockwitz.
Dresden und Leipzig. 1732." Pastor
Gerber, ein zwar im Allgemeinen noch
gläubiger Geistlicher, abex sonst ein Mann
von dem hausbackensten Philisterverstande,
tritt allerdings überall in seinem Werke nur
als Tadler dieser Kirchenceremonien auf; in-
dessen verdient er unsern großen Dank für die
Treue, womit er uns über das Thatsächliche
* s. Kirchenlericon von Wetzer und Welte. Er-
gänzungsband. Art. Nürnberg.
Pfaffenhmn, auch im Oberrhein, ein Bau-
werk des 12. Jahrhunderts, welcher fetzt nur
noch als Rumpelkammer benützt wird, enthält
eine Reihe schön gemalter Medaillons unge-
fähr aus deni 14. Jahrhundert.
Jn der Kirche zu Rosenweiler ist ein hüb-
sches Gemälde aus Goldgrund, welches die
Rückwand einerWandnische schmückt, die drei
Marien am Grab des Erlösers. Diese Nische
hat früher als Heilig-Grab in der Charwoche
gedient.
Jm Thurme derselben Kirche wurden vor
einigen Jahren Gemälde von nüttelmäßigem
! Werthe unter vierfacherTünche entdeckt. Fer-
j nere Reste findeu fich im Untergeschoß des
Thurms von Börsch, welcher früher als Chor
gebraucht wurde, Jesus am Kreuz nüt Maria
und Johannes; in der Vorhalle der Kirche zu
Audlau einige schöne Köpse, das Uebrige ver-
tüncht; im Chor zu Walburg große Figuren,
wahrscheinlich die Apostel, welche durch meh-
^ rere Kalklagen hindurchschimmern.
Auch die berühmte Cathedrale von Straß-
burg legt noch Zeugniß ab von ihrem srühe-
ren Farbenschmuck. Ueber der St. Andreas-
kapelle ist unter anderem eine schöne Aus-
opserung Christi, und au einem nach innen
I gezogenen Strebepfeiler der Katharinenkapelle
hat man 1836 einen St. Christoph entdeckt,
der fast die ganze Höhe der Kapelle einnahm.
Er verschwand, wahrscheinlich für immer, um
einer neuen Kalktünche Platz zu machen.
Meßgeuiand und Illar in den all-
luiherischen Kirchen.
Durch ein neueres Reisewerk über Schwe-
den (von Clarus) ist die auf den ersten An-
blick aussallende, in mehrfacher Hinsicht zu
ernstem Nachdenken auffordernde Thatsache
wieder bekannter gewordeu, daß neben ande-
ren specifisch katholischen Ceremonien in den
protestantischen Kirchen Scandinaviens der
Gebrauch sogar des Meßgewandes fortbesteht.
Weniger bekannt dagegen dürfte es sein, daß
in einer nicht weit hinter uns liegenden Ver-
gangenheit selbst in einem beträchtlichen Theile
des proteftantischen (lutherischen) Deutsch-
lands dieses liturgische Gewand noch in un-
bestrittener Geltung war. Es war am letzten
Sonntag nach Trinitatis im Jahr 1811, daß
die lutherische Geistlichkeit in Nürnberg*
zum letzten Male im Meßgewande funktionirte.
Seitdem ist im protestantischen Deutschland
so vieles, uamentlich auch in der Liturgie, an-
ders geworden, seitdem hat der calvinische,
d. h. hierin conseguentere Protestantismus so
entschieden an Geltung und Verbreitung ge-
wonnen, daß ohne Zweifel die große Mehr-
zahl der heutigen Protestanten ganz unver-
mögend sein wird, ftch in die Stimmung jener
ihrer Altvordern zurückzndenken, welche den
Fortgebrauch eines specifisch rönüsch-katholi-
schen Kirchengewandes nicht blos duldeten,
sondern, wie wir gleich sehen werden, sogar
liebten. Ja ohne die strictesten, unumstößlich-
sten Beweise werden fte sogar die Thatsache
selbst in Abrede zu stellen geneigt sein. Zum
Glücke haben wir aber sprechende historische
Zeugnisse, unter andern sogar ein eigenes
ziemlich umfangreiches Werk, welches sich über
alle noch aus der katholischen Kirche in die
neue lutherische Liturgie herübergenommenen
Ceremonien verbreitet. Das Werk sührt den
Titel: „Historie der Kirchenceremo-
nien in Sachsen; nach ihrer Beschas-
senheit in möglichster Kürze mit An-
führung vieler Moralien und specia-
len Nachrichten, verfasset von Chri-
stian Gerbern, ssn. in Lockwitz.
Dresden und Leipzig. 1732." Pastor
Gerber, ein zwar im Allgemeinen noch
gläubiger Geistlicher, abex sonst ein Mann
von dem hausbackensten Philisterverstande,
tritt allerdings überall in seinem Werke nur
als Tadler dieser Kirchenceremonien auf; in-
dessen verdient er unsern großen Dank für die
Treue, womit er uns über das Thatsächliche
* s. Kirchenlericon von Wetzer und Welte. Er-
gänzungsband. Art. Nürnberg.