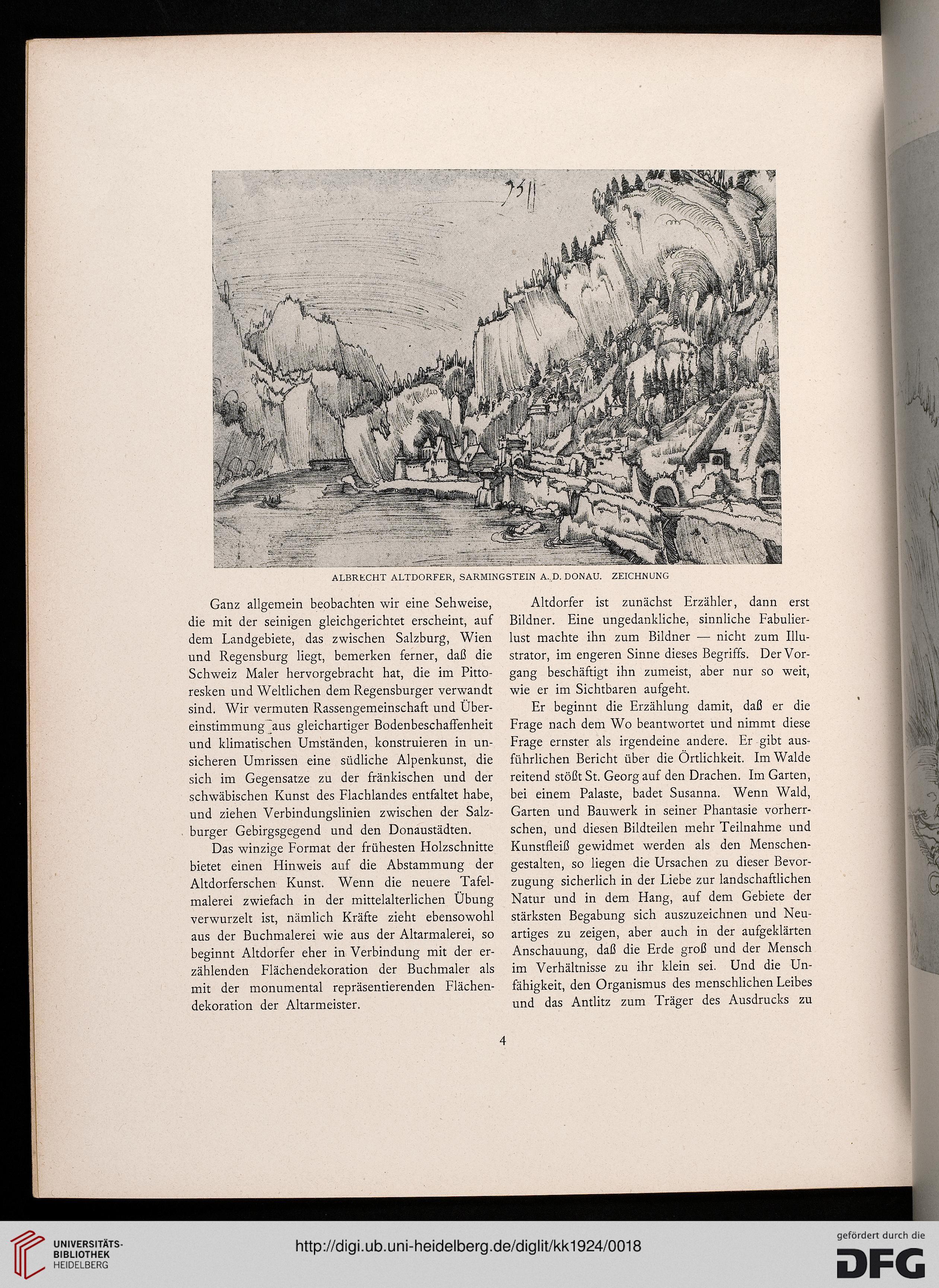ALBRECHT ALTDORFER, SARMINGSTEIN A. D. DONAU. ZEICHNUNG
Ganz allgemein beobachten wir eine Sehweise,
die mit der seinigen gleichgerichtet erscheint, auf
dem Landgebiete, das zwischen Salzburg, Wien
und Regensburg liegt, bemerken ferner, daß die
Schweiz Maler hervorgebracht hat, die im Pitto-
resken und Weltlichen dem Regensburger verwandt
sind. Wir vermuten Rassengemeinschaft und Über-
einstimmung aus gleichartiger Bodenbeschaffenheit
und klimatischen Umständen, konstruieren in un-
sicheren Umrissen eine südliche Alpenkunst, die
sich im Gegensatze zu der fränkischen und der
schwäbischen Kunst des Flachlandes entfaltet habe,
und ziehen Verbindungslinien zwischen der Salz-
burger Gebirgsgegend und den Donaustädten.
Das winzige Format der frühesten Holzschnitte
bietet einen Hinweis auf die Abstammung der
Altdorferschen Kunst. Wenn die neuere Tafel-
malerei zwiefach in der mittelalterlichen Übung
verwurzelt ist, nämlich Kräfte zieht ebensowohl
aus der Buchmalerei wie aus der Altarmalerei, so
beginnt Altdorfer eher in Verbindung mit der er-
zählenden Flächendekoration der Buchmaler als
mit der monumental repräsentierenden Flächen-
dekoration der Altarmeister.
Altdorfer ist zunächst Erzähler, dann erst
Bildner. Eine ungedankliche, sinnliche Fabulier-
lust machte ihn zum Bildner — nicht zum Illu-
strator, im engeren Sinne dieses Begriffs. Der Vor-
gang beschäftigt ihn zumeist, aber nur so weit,
wie er im Sichtbaren aufgeht.
Er beginnt die Erzählung damit, daß er die
Frage nach dem Wo beantwortet und nimmt diese
Frage ernster als irgendeine andere. Er gibt aus-
führlichen Bericht über die Ortlichkeit. Im Walde
reitend stößt St. Georg auf den Drachen. Im Garten,
bei einem Palaste, badet Susanna. Wenn Wald,
Garten und Bauwerk in seiner Phantasie vorherr-
schen, und diesen Bildteilen mehr Teilnahme und
Kunstfleiß gewidmet werden als den Menschen-
gestalten, so liegen die Ursachen zu dieser Bevor-
zugung sicherlich in der Liebe zur landschaftlichen
Natur und in dem Hang, auf dem Gebiete der
stärksten Begabung sich auszuzeichnen und Neu-
artiges zu zeigen, aber auch in der aufgeklärten
Anschauung, daß die Erde groß und der Mensch
im Verhältnisse zu ihr klein sei. Und die Un-
fähigkeit, den Organismus des menschlichen Leibes
und das Antlitz zum Träger des Ausdrucks zu
4
Ganz allgemein beobachten wir eine Sehweise,
die mit der seinigen gleichgerichtet erscheint, auf
dem Landgebiete, das zwischen Salzburg, Wien
und Regensburg liegt, bemerken ferner, daß die
Schweiz Maler hervorgebracht hat, die im Pitto-
resken und Weltlichen dem Regensburger verwandt
sind. Wir vermuten Rassengemeinschaft und Über-
einstimmung aus gleichartiger Bodenbeschaffenheit
und klimatischen Umständen, konstruieren in un-
sicheren Umrissen eine südliche Alpenkunst, die
sich im Gegensatze zu der fränkischen und der
schwäbischen Kunst des Flachlandes entfaltet habe,
und ziehen Verbindungslinien zwischen der Salz-
burger Gebirgsgegend und den Donaustädten.
Das winzige Format der frühesten Holzschnitte
bietet einen Hinweis auf die Abstammung der
Altdorferschen Kunst. Wenn die neuere Tafel-
malerei zwiefach in der mittelalterlichen Übung
verwurzelt ist, nämlich Kräfte zieht ebensowohl
aus der Buchmalerei wie aus der Altarmalerei, so
beginnt Altdorfer eher in Verbindung mit der er-
zählenden Flächendekoration der Buchmaler als
mit der monumental repräsentierenden Flächen-
dekoration der Altarmeister.
Altdorfer ist zunächst Erzähler, dann erst
Bildner. Eine ungedankliche, sinnliche Fabulier-
lust machte ihn zum Bildner — nicht zum Illu-
strator, im engeren Sinne dieses Begriffs. Der Vor-
gang beschäftigt ihn zumeist, aber nur so weit,
wie er im Sichtbaren aufgeht.
Er beginnt die Erzählung damit, daß er die
Frage nach dem Wo beantwortet und nimmt diese
Frage ernster als irgendeine andere. Er gibt aus-
führlichen Bericht über die Ortlichkeit. Im Walde
reitend stößt St. Georg auf den Drachen. Im Garten,
bei einem Palaste, badet Susanna. Wenn Wald,
Garten und Bauwerk in seiner Phantasie vorherr-
schen, und diesen Bildteilen mehr Teilnahme und
Kunstfleiß gewidmet werden als den Menschen-
gestalten, so liegen die Ursachen zu dieser Bevor-
zugung sicherlich in der Liebe zur landschaftlichen
Natur und in dem Hang, auf dem Gebiete der
stärksten Begabung sich auszuzeichnen und Neu-
artiges zu zeigen, aber auch in der aufgeklärten
Anschauung, daß die Erde groß und der Mensch
im Verhältnisse zu ihr klein sei. Und die Un-
fähigkeit, den Organismus des menschlichen Leibes
und das Antlitz zum Träger des Ausdrucks zu
4