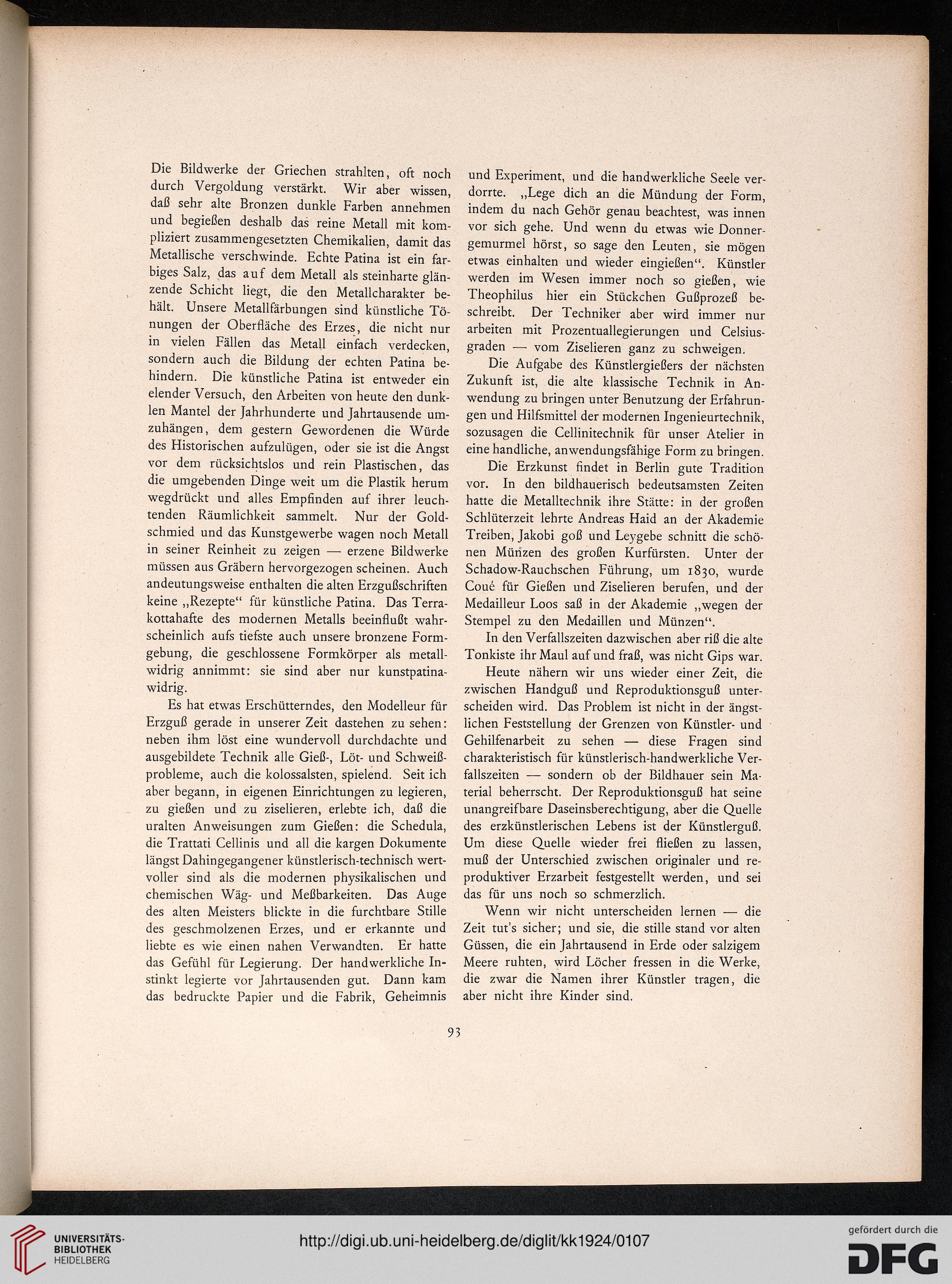Die Bildwerke der Griechen strahlten, oft noch
durch Vergoldung verstärkt. Wir aber wissen,
daß sehr alte Bronzen dunkle Farben annehmen
und begießen deshalb das reine Metall mit kom-
pliziert zusammengesetzten Chemikalien, damit das
Metallische verschwinde. Echte Patina ist ein far-
biges Salz, das auf dem Metall als steinharte glän-
zende Schicht liegt, die den Metallcharakter be-
hält. Unsere Metallfärbungen sind künstliche Tö-
nungen der Oberfläche des Erzes, die nicht nur
in vielen Fällen das Metall einfach verdecken,
sondern auch die Bildung der echten Patina be-
hindern. Die künstliche Patina ist entweder ein
elender Versuch, den Arbeiten von heute den dunk-
len Mantel der Jahrhunderte und Jahrtausende um-
zuhängen, dem gestern Gewordenen die Würde
des Historischen aufzulügen, oder sie ist die Angst
vor dem rücksichtslos und rein Plastischen, das
die umgebenden Dinge weit um die Plastik herum
wegdrückt und alles Empfinden auf ihrer leuch-
tenden Räumlichkeit sammelt. Nur der Gold-
schmied und das Kunstgewerbe wagen noch Metall
in seiner Reinheit zu zeigen — erzene Bildwerke
müssen aus Gräbern hervorgezogen scheinen. Auch
andeutungsweise enthalten die alten Erzgußschriften
keine „Rezepte" für künstliche Patina. Das Terra-
kottahafte des modernen Metalls beeinflußt wahr-
scheinlich aufs tiefste auch unsere bronzene Form-
gebung, die geschlossene Formkörper als metall-
widrig annimmt: sie sind aber nur kunstpatina-
widrig.
Es hat etwas Erschütterndes, den Modelleur für
Erzguß gerade in unserer Zeit dastehen zu sehen:
neben ihm löst eine wundervoll durchdachte und
ausgebildete Technik alle Gieß-, Löt- und Schweiß-
probleme, auch die kolossalsten, spielend. Seit ich
aber begann, in eigenen Einrichtungen zu legieren,
zu gießen und zu ziselieren, erlebte ich, daß die
uralten Anweisungen zum Gießen: die Schedula,
die Trattati Cellinis und all die kargen Dokumente
längst Dahingegangener künstlerisch-technisch wert-
voller sind als die modernen physikalischen und
chemischen Wäg- und Meßbarkeiten. Das Auge
des alten Meisters blickte in die furchtbare Stille
des geschmolzenen Erzes, und er erkannte und
liebte es wie einen nahen Verwandten. Er hatte
das Gefühl für Legierung. Der handwerkliche In-
stinkt legierte vor Jahrtausenden gut. Dann kam
das bedruckte Papier und die Fabrik, Geheimnis
und Experiment, und die handwerkliche Seele ver-
dorrte. „Lege dich an die Mündung der Form,
indem du nach Gehör genau beachtest, was innen
vor sich gehe. Und wenn du etwas wie Donner-
gemurmel hörst, so sage den Leuten, sie mögen
etwas einhalten und wieder eingießen". Künstler
werden im Wesen immer noch so gießen, wie
Theophilus hier ein Stückchen Gußprozeß be-
schreibt. Der Techniker aber wird immer nur
arbeiten mit Prozentuallegierungen und Celsius-
graden — vom Ziselieren ganz zu schweigen.
Die Aufgabe des Künstlergießers der nächsten
Zukunft ist, die alte klassische Technik in An-
wendung zu bringen unter Benutzung der Erfahrun-
gen und Hilfsmittel der modernen Ingenieurtechnik,
sozusagen die Cellinitechnik für unser Atelier in
eine handliche, anwendungsfähige Form zu bringen.
Die Erzkunst findet in Berlin gute Tradition
vor. In den bildhauerisch bedeutsamsten Zeiten
hatte die Metalltechnik ihre Stätte: in der großen
Schlüterzeit lehrte Andreas Haid an der Akademie
Treiben, Jakobi goß und Leygebe schnitt die schö-
nen Münzen des großen Kurfürsten. Unter der
Schadow-Rauchschen Führung, um 1830, wurde
Coue für Gießen und Ziselieren berufen, und der
Medailleur Loos saß in der Akademie „wegen der
Stempel zu den Medaillen und Münzen".
In den Verfallszeiten dazwischen aber riß die alte
Tonkiste ihr Maul auf und fraß, was nicht Gips war.
Heute nähern wir uns wieder einer Zeit, die
zwischen Handguß und Reproduktionsguß unter-
scheiden wird. Das Problem ist nicht in der ängst-
lichen Feststellung der Grenzen von Künstler- und
Gehilfenarbeit zu sehen — diese Fragen sind
charakteristisch für künstlerisch-handwerkliche Ver-
fallszeiten -— sondern ob der Bildhauer sein Ma-
terial beherrscht. Der Reproduktionsguß hat seine
unangreifbare Daseinsberechtigung, aber die Quelle
des erzkünstlerischen Lebens ist der Künstlerguß.
Um diese Quelle wieder frei fließen zu lassen,
muß der Unterschied zwischen originaler und re-
produktiver Erzarbeit festgestellt werden, und sei
das für uns noch so schmerzlich.
Wenn wir nicht unterscheiden lernen — die
Zeit tut's sicher; und sie, die stille stand vor alten
Güssen, die ein Jahrtausend in Erde oder salzigem
Meere ruhten, wird Löcher fressen in die Werke,
die zwar die Namen ihrer Künstler tragen, die
aber nicht ihre Kinder sind.
93
durch Vergoldung verstärkt. Wir aber wissen,
daß sehr alte Bronzen dunkle Farben annehmen
und begießen deshalb das reine Metall mit kom-
pliziert zusammengesetzten Chemikalien, damit das
Metallische verschwinde. Echte Patina ist ein far-
biges Salz, das auf dem Metall als steinharte glän-
zende Schicht liegt, die den Metallcharakter be-
hält. Unsere Metallfärbungen sind künstliche Tö-
nungen der Oberfläche des Erzes, die nicht nur
in vielen Fällen das Metall einfach verdecken,
sondern auch die Bildung der echten Patina be-
hindern. Die künstliche Patina ist entweder ein
elender Versuch, den Arbeiten von heute den dunk-
len Mantel der Jahrhunderte und Jahrtausende um-
zuhängen, dem gestern Gewordenen die Würde
des Historischen aufzulügen, oder sie ist die Angst
vor dem rücksichtslos und rein Plastischen, das
die umgebenden Dinge weit um die Plastik herum
wegdrückt und alles Empfinden auf ihrer leuch-
tenden Räumlichkeit sammelt. Nur der Gold-
schmied und das Kunstgewerbe wagen noch Metall
in seiner Reinheit zu zeigen — erzene Bildwerke
müssen aus Gräbern hervorgezogen scheinen. Auch
andeutungsweise enthalten die alten Erzgußschriften
keine „Rezepte" für künstliche Patina. Das Terra-
kottahafte des modernen Metalls beeinflußt wahr-
scheinlich aufs tiefste auch unsere bronzene Form-
gebung, die geschlossene Formkörper als metall-
widrig annimmt: sie sind aber nur kunstpatina-
widrig.
Es hat etwas Erschütterndes, den Modelleur für
Erzguß gerade in unserer Zeit dastehen zu sehen:
neben ihm löst eine wundervoll durchdachte und
ausgebildete Technik alle Gieß-, Löt- und Schweiß-
probleme, auch die kolossalsten, spielend. Seit ich
aber begann, in eigenen Einrichtungen zu legieren,
zu gießen und zu ziselieren, erlebte ich, daß die
uralten Anweisungen zum Gießen: die Schedula,
die Trattati Cellinis und all die kargen Dokumente
längst Dahingegangener künstlerisch-technisch wert-
voller sind als die modernen physikalischen und
chemischen Wäg- und Meßbarkeiten. Das Auge
des alten Meisters blickte in die furchtbare Stille
des geschmolzenen Erzes, und er erkannte und
liebte es wie einen nahen Verwandten. Er hatte
das Gefühl für Legierung. Der handwerkliche In-
stinkt legierte vor Jahrtausenden gut. Dann kam
das bedruckte Papier und die Fabrik, Geheimnis
und Experiment, und die handwerkliche Seele ver-
dorrte. „Lege dich an die Mündung der Form,
indem du nach Gehör genau beachtest, was innen
vor sich gehe. Und wenn du etwas wie Donner-
gemurmel hörst, so sage den Leuten, sie mögen
etwas einhalten und wieder eingießen". Künstler
werden im Wesen immer noch so gießen, wie
Theophilus hier ein Stückchen Gußprozeß be-
schreibt. Der Techniker aber wird immer nur
arbeiten mit Prozentuallegierungen und Celsius-
graden — vom Ziselieren ganz zu schweigen.
Die Aufgabe des Künstlergießers der nächsten
Zukunft ist, die alte klassische Technik in An-
wendung zu bringen unter Benutzung der Erfahrun-
gen und Hilfsmittel der modernen Ingenieurtechnik,
sozusagen die Cellinitechnik für unser Atelier in
eine handliche, anwendungsfähige Form zu bringen.
Die Erzkunst findet in Berlin gute Tradition
vor. In den bildhauerisch bedeutsamsten Zeiten
hatte die Metalltechnik ihre Stätte: in der großen
Schlüterzeit lehrte Andreas Haid an der Akademie
Treiben, Jakobi goß und Leygebe schnitt die schö-
nen Münzen des großen Kurfürsten. Unter der
Schadow-Rauchschen Führung, um 1830, wurde
Coue für Gießen und Ziselieren berufen, und der
Medailleur Loos saß in der Akademie „wegen der
Stempel zu den Medaillen und Münzen".
In den Verfallszeiten dazwischen aber riß die alte
Tonkiste ihr Maul auf und fraß, was nicht Gips war.
Heute nähern wir uns wieder einer Zeit, die
zwischen Handguß und Reproduktionsguß unter-
scheiden wird. Das Problem ist nicht in der ängst-
lichen Feststellung der Grenzen von Künstler- und
Gehilfenarbeit zu sehen — diese Fragen sind
charakteristisch für künstlerisch-handwerkliche Ver-
fallszeiten -— sondern ob der Bildhauer sein Ma-
terial beherrscht. Der Reproduktionsguß hat seine
unangreifbare Daseinsberechtigung, aber die Quelle
des erzkünstlerischen Lebens ist der Künstlerguß.
Um diese Quelle wieder frei fließen zu lassen,
muß der Unterschied zwischen originaler und re-
produktiver Erzarbeit festgestellt werden, und sei
das für uns noch so schmerzlich.
Wenn wir nicht unterscheiden lernen — die
Zeit tut's sicher; und sie, die stille stand vor alten
Güssen, die ein Jahrtausend in Erde oder salzigem
Meere ruhten, wird Löcher fressen in die Werke,
die zwar die Namen ihrer Künstler tragen, die
aber nicht ihre Kinder sind.
93