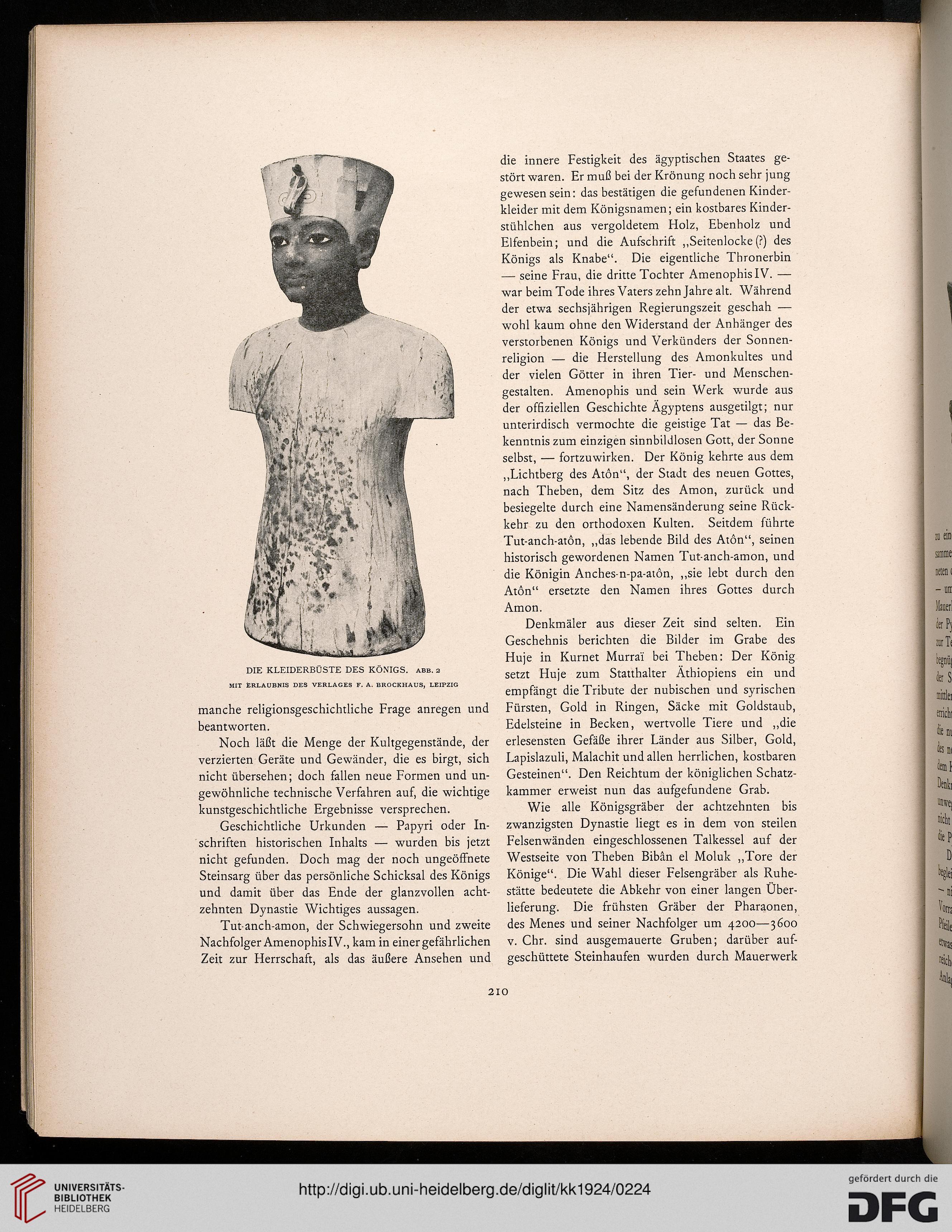DIE KLEIDERBÜSTE DES KÖNIGS, abb. 2
mit erlaubnis des verlages f. a. brockhaus, leipzig
manche religionsgeschichtliche Frage anregen und
beantworten.
Noch läßt die Menge der Kultgegenstände, der
verzierten Geräte und Gewänder, die es birgt, sich
nicht übersehen; doch fallen neue Formen und un-
gewöhnliche technische Verfahren auf, die wichtige
kunstgeschichtliche Ergebnisse versprechen.
Geschichtliche Urkunden — Papyri oder In-
schriften historischen Inhalts — wurden bis jetzt
nicht gefunden. Doch mag der noch ungeöffnete
Steinsarg über das persönliche Schicksal des Königs
und damit über das Ende der glanzvollen acht-
zehnten Dynastie Wichtiges aussagen.
Tut-anch-amon, der Schwiegersohn und zweite
Nachfolger Amenophis IV., kam in einer gefährlichen
Zeit zur Herrschaft, als das äußere Ansehen und
die innere Festigkeit des ägyptischen Staates ge-
stört waren. Er muß bei der Krönung noch sehr jung
gewesen sein: das bestätigen die gefundenen Kinder-
kleider mit dem Königsnamen; ein kostbares Kinder-
stühlchen aus vergoldetem Holz, Ebenholz und
Elfenbein; und die Aufschrift „Seitenlocke(?) des
Königs als Knabe". Die eigentliche Thronerbin
— seine Frau, die dritte Tochter Amenophis IV. —
war beim Tode ihres Vaters zehn Jahre alt. Während
der etwa sechsjährigen Regierungszeit geschah —
wohl kaum ohne den Widerstand der Anhänger des
verstorbenen Königs und Verkünders der Sonnen-
religion — die Herstellung des Amonkultes und
der vielen Götter in ihren Tier- und Menschen-
gestalten. Amenophis und sein Werk wurde aus
der offiziellen Geschichte Ägyptens ausgetilgt; nur
unterirdisch vermochte die geistige Tat — das Be-
kenntnis zum einzigen sinnbildlosen Gott, der Sonne
selbst, — fortzuwirken. Der König kehrte aus dem
„Lichtberg des Atön", der Stadt des neuen Gottes,
nach Theben, dem Sitz des Amon, zurück und
besiegelte durch eine Namensänderung seine Rück-
kehr zu den orthodoxen Kulten. Seitdem führte
Tut-anch-atön, „das lebende Bild des Atön", seinen
historisch gewordenen Namen Tut-anch-amon, und
die Königin Anches-n-pa-aiön, „sie lebt durch den
Atön" ersetzte den Namen ihres Gottes durch
Amon.
Denkmäler aus dieser Zeit sind selten. Ein
Geschehnis berichten die Bilder im Grabe des
Huje in Kurnet Murrai bei Theben: Der König
setzt Huje zum Statthalter Äthiopiens ein und
empfängt die Tribute der nubischen und syrischen
Fürsten, Gold in Ringen, Säcke mit Goldstaub,
Edelsteine in Becken, wertvolle Tiere und „die
erlesensten Gefäße ihrer Länder aus Silber, Gold,
Lapislazuli, Malachit und allen herrlichen, kostbaren
Gesteinen". Den Reichtum der königlichen Schatz-
kammer erweist nun das aufgefundene Grab.
Wie alle Königsgräber der achtzehnten bis
zwanzigsten Dynastie liegt es in dem von steilen
Felsenwänden eingeschlossenen Talkessel auf der
Westseite von Theben Bibän el Moluk „Tore der
Könige". Die Wahl dieser Felsengräber als Ruhe-
stätte bedeutete die Abkehr von einer langen Über-
lieferung. Die frühsten Gräber der Pharaonen,
des Menes und seiner Nachfolger um 4200—3600
v. Chr. sind ausgemauerte Gruben; darüber auf-
geschüttete Steinhaufen wurden durch Mauerwerk
210
mit erlaubnis des verlages f. a. brockhaus, leipzig
manche religionsgeschichtliche Frage anregen und
beantworten.
Noch läßt die Menge der Kultgegenstände, der
verzierten Geräte und Gewänder, die es birgt, sich
nicht übersehen; doch fallen neue Formen und un-
gewöhnliche technische Verfahren auf, die wichtige
kunstgeschichtliche Ergebnisse versprechen.
Geschichtliche Urkunden — Papyri oder In-
schriften historischen Inhalts — wurden bis jetzt
nicht gefunden. Doch mag der noch ungeöffnete
Steinsarg über das persönliche Schicksal des Königs
und damit über das Ende der glanzvollen acht-
zehnten Dynastie Wichtiges aussagen.
Tut-anch-amon, der Schwiegersohn und zweite
Nachfolger Amenophis IV., kam in einer gefährlichen
Zeit zur Herrschaft, als das äußere Ansehen und
die innere Festigkeit des ägyptischen Staates ge-
stört waren. Er muß bei der Krönung noch sehr jung
gewesen sein: das bestätigen die gefundenen Kinder-
kleider mit dem Königsnamen; ein kostbares Kinder-
stühlchen aus vergoldetem Holz, Ebenholz und
Elfenbein; und die Aufschrift „Seitenlocke(?) des
Königs als Knabe". Die eigentliche Thronerbin
— seine Frau, die dritte Tochter Amenophis IV. —
war beim Tode ihres Vaters zehn Jahre alt. Während
der etwa sechsjährigen Regierungszeit geschah —
wohl kaum ohne den Widerstand der Anhänger des
verstorbenen Königs und Verkünders der Sonnen-
religion — die Herstellung des Amonkultes und
der vielen Götter in ihren Tier- und Menschen-
gestalten. Amenophis und sein Werk wurde aus
der offiziellen Geschichte Ägyptens ausgetilgt; nur
unterirdisch vermochte die geistige Tat — das Be-
kenntnis zum einzigen sinnbildlosen Gott, der Sonne
selbst, — fortzuwirken. Der König kehrte aus dem
„Lichtberg des Atön", der Stadt des neuen Gottes,
nach Theben, dem Sitz des Amon, zurück und
besiegelte durch eine Namensänderung seine Rück-
kehr zu den orthodoxen Kulten. Seitdem führte
Tut-anch-atön, „das lebende Bild des Atön", seinen
historisch gewordenen Namen Tut-anch-amon, und
die Königin Anches-n-pa-aiön, „sie lebt durch den
Atön" ersetzte den Namen ihres Gottes durch
Amon.
Denkmäler aus dieser Zeit sind selten. Ein
Geschehnis berichten die Bilder im Grabe des
Huje in Kurnet Murrai bei Theben: Der König
setzt Huje zum Statthalter Äthiopiens ein und
empfängt die Tribute der nubischen und syrischen
Fürsten, Gold in Ringen, Säcke mit Goldstaub,
Edelsteine in Becken, wertvolle Tiere und „die
erlesensten Gefäße ihrer Länder aus Silber, Gold,
Lapislazuli, Malachit und allen herrlichen, kostbaren
Gesteinen". Den Reichtum der königlichen Schatz-
kammer erweist nun das aufgefundene Grab.
Wie alle Königsgräber der achtzehnten bis
zwanzigsten Dynastie liegt es in dem von steilen
Felsenwänden eingeschlossenen Talkessel auf der
Westseite von Theben Bibän el Moluk „Tore der
Könige". Die Wahl dieser Felsengräber als Ruhe-
stätte bedeutete die Abkehr von einer langen Über-
lieferung. Die frühsten Gräber der Pharaonen,
des Menes und seiner Nachfolger um 4200—3600
v. Chr. sind ausgemauerte Gruben; darüber auf-
geschüttete Steinhaufen wurden durch Mauerwerk
210