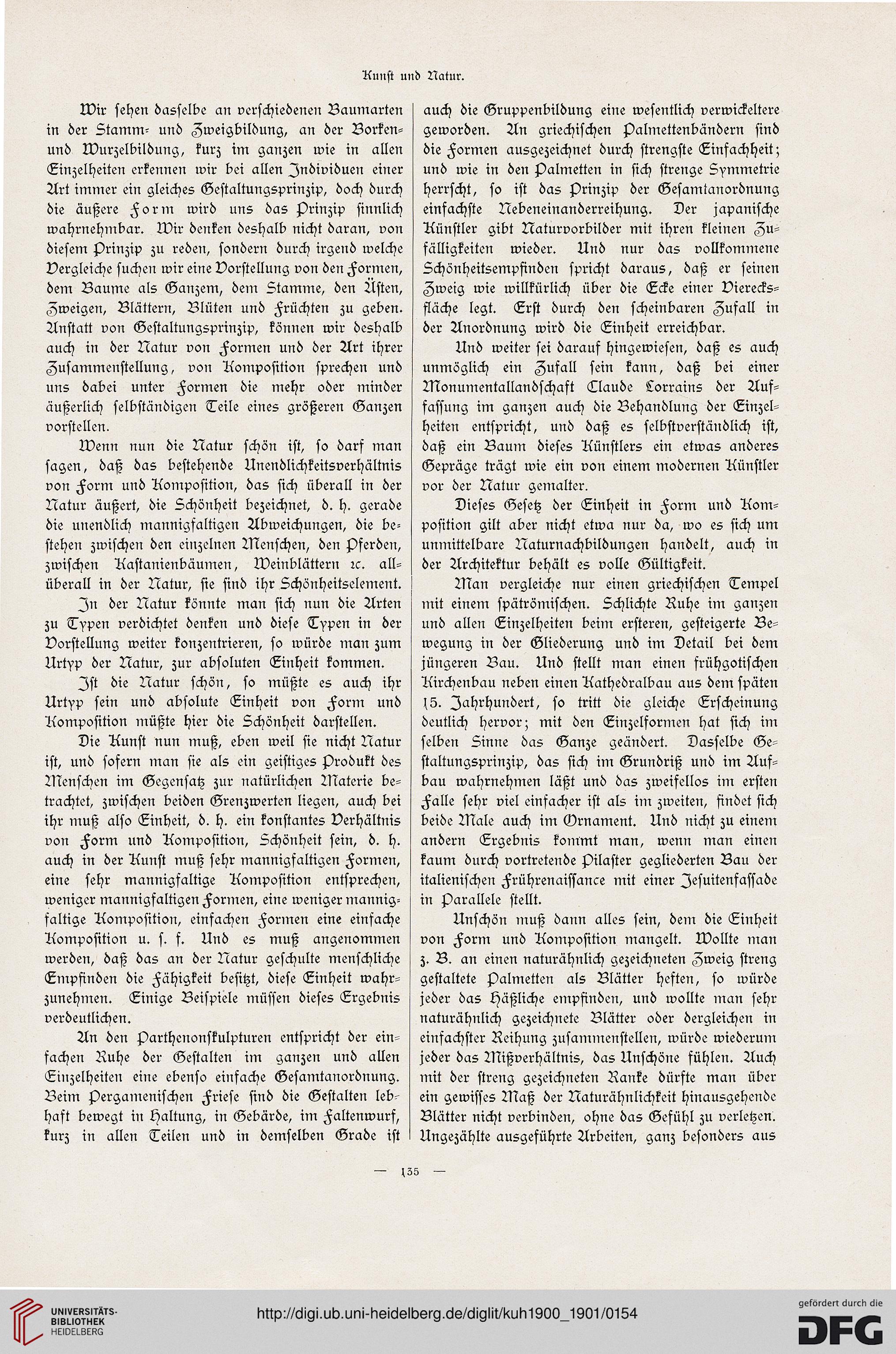Kunst und Natur.
Wir sehen dasselbe an verschiedenen Baumarten
in der Stamm- und Zweigbildung, an der Borken-
und Wurzelbildung, kurz im ganzen wie in allen
Einzelheiten erkennen wir bei allen Individuen einer
Art immer ein gleiches Gestaltungsprinzip, doch durch
die äußere ^ o r m wird uns das Prinzip sinnlich
wahrnehinbar. Wir denken deshalb nicht daran, von
diesenr Prinzip zu reden, sondern durch irgend welche
Vergleiche suchen wir eine Vorstellung von den Formen,
dem Baume als Ganzen:, den: Stamme, den Olsten,
Zweigen, Blättern, Blüten und Früchten zu geben.
Anstatt voi: Gestaltungsprinzip, können wir deshalb
auch in der Natur von Formen und der Art ihrer
Zusammenstellung, von Aomposition sprechen und
uns dabei unter Forinen die mehr oder minder
äußerlich selbständigen Teile eines größeren Ganzen
vorstellen.
Wenn nun die Natur schön ist, so darf man
sagen, daß das bestehende Unendlichkeitsverhältnis
von Form und Aomposition, das sich überall in der
Natur äußert, die Schönheit bezeichnet, d. h. gerade
die unendlich mannigfaltigen Abweichungen, die be-
stehen zwischen den einzelnen Menschen, den Pferden,
zwischen Aastanienbäumen, Weinblättern rc. all-
überall in der Natur, sie sind ihr Schönheitselement.
In der Natur könnte man sich nun die Arten
zu Typen verdichtet denken und diese Typen in der
Vorstellung weiter konzentrieren, so würde man zum
Urtyp der Natur, zur absoluten Einheit kommen.
Ist die Natur schön, so müßte es auch ihr
Urtyp sein und absolute Einheit von Form und
Aomposition müßte hier die Schönheit darstellen.
Die Aunst nun muß, eben weil sie nicht Natur
ist, und sofern man sie als ein geistiges Produkt des
Menschen im Gegensatz zur natürlichen Materie be-
trachtet, zwischen beiden Grenzwerten liegen, auch bei
ihr muß also Einheit, d. h. ein konstantes Verhältnis
von Form und Aomposition, Schönheit sein, d. h.
auch in der Aunst muß sehr mannigfaltigen Forinen,
eine sehr mannigfaltige Aomposition entsprechen,
weniger mannigfaltigen Formen, eine weniger mannig-
faltige Aomposition, einfachen Formen eine einfache
Aomposition u. s. f. Und es muß angenommen
werden, daß das an der Natur geschulte menschliche
Empfinden die Fähigkeit besitzt, diese Einheit wahr-
zunehmen. Einige Beispiele müssen dieses Ergebnis
verdeutlichen.
An den Parthenonskulpturen entspricht der ein-
fachen Ruhe der Gestalten im ganzen und allen
Einzelheiten eine ebenso einfache Gesamtanordnung.
Beim Pergamenischen Friese sind die Gestalten leb
Haft bewegt in paltung, in Gebärde, im Faltenwurf,
kurz in allen Teilen und in demselben Grade ist
auch die Gruppenbildung eine wesentlich verwickeltere
geworden. An griechischen Palmettenbändern sind
die Formen ausgezeichnet durch strengste Einfachheit;
und wie in den palinetten in sich strenge Symmetrie
herrscht, so ist das Prinzip der Gesamtanordnung
einfachste Nebeneinanderreihung. Der japanische
Aünstler gibt Naturvorbilder mit ihren kleinen Zu-
fälligkeiten wieder. Und nur das vollkommene
Schönheitsempfindcn spricht daraus, daß er seinen
Zweig wie willkürlich über die Ecke einer Vierecks-
fläche legt. Erst durch den scheinbaren Zufall in
der Anordnung wird die Einheit erreichbar.
Und weiter sei darauf hingewiesen, daß es auch
unmöglich ein Zufall sein kann, daß bei einer
Monumentallandschaft Tlaude Lorrains der Auf-
fassung im ganzen auch die Behandlung der Einzel-
heiten entspricht, und daß es selbstverständlich ist,
daß ein Baun: dieses Aünstlers ein etwas anderes
Gepräge trägt wie ein von einen: modernen Aünstler
vor der Natur gemalter.
Dieses Gesetz der Einheit in Form: und Aom-
position gilt aber nicht etwa nur da, wo es sich un:
unmittelbare Naturnachbildungen handelt, auch in
der Architektur behält es volle Gültigkeit.
Man vergleiche nur einen griechischen Teinpel
mit einen: spätrömischen. Schlichte Ruhe in: ganzen
und allen Einzelheiten bei::: ersteren, gesteigerte Be-
wegung in der Gliederung und im Detail bei dem
jüngeren Bau. Und stellt :::an einen frühgotischen
Airchenbau neben einen Aathedralbau aus dem späten
s5. Jahrhundert, so tritt die gleiche Erscheinung
deutlich hervor; mit den Einzelfor:::en hat sich in:
selben Sinne das Ganze geändert. Dasselbe Ge-
staltungsprinzip, das sich in: Grundriß und in: Auf-
bau wahrnehmen läßt und das zweifellos in: ersten
Falle sehr viel einfacher ist als in: zweiten, findet sich
beide Male auch im Grna:::ent. Und nicht zu einem
andern Ergebnis kon:mt man, wenn n:an einen
kaum durch vortretende Pilaster gegliederten Bau der
italienischen Frührenaissance mit einer Iesuitenfassade
in Parallele stellt.
Unschön :nuß dann alles sein, den: die Einheit
von Forn: und Aon:position mangelt. Wollte :nan
z. B. an einen naturähnlich gezeichneten Zweig streng
gestaltete Palmetten als Blätter heften, so würde
jeder das päßliche empfinden, und wollte man sehr
naturähnlich gezeichnete Blätter oder dergleichen in
einfachster Reihung zusammenstellen, würde wiederum
jeder das Mißverhältnis, das Unschöne fühlen. Auch
mit der streng gezeichneten Ranke dürfte man über
ein gewisses Maß der Naturähnlichkeit hinausgehende
Blätter nicht verbinden, ohne das Gefühl zu verletzen.
Ungezählte ausgeführte Arbeiten, ganz besonders aus
Wir sehen dasselbe an verschiedenen Baumarten
in der Stamm- und Zweigbildung, an der Borken-
und Wurzelbildung, kurz im ganzen wie in allen
Einzelheiten erkennen wir bei allen Individuen einer
Art immer ein gleiches Gestaltungsprinzip, doch durch
die äußere ^ o r m wird uns das Prinzip sinnlich
wahrnehinbar. Wir denken deshalb nicht daran, von
diesenr Prinzip zu reden, sondern durch irgend welche
Vergleiche suchen wir eine Vorstellung von den Formen,
dem Baume als Ganzen:, den: Stamme, den Olsten,
Zweigen, Blättern, Blüten und Früchten zu geben.
Anstatt voi: Gestaltungsprinzip, können wir deshalb
auch in der Natur von Formen und der Art ihrer
Zusammenstellung, von Aomposition sprechen und
uns dabei unter Forinen die mehr oder minder
äußerlich selbständigen Teile eines größeren Ganzen
vorstellen.
Wenn nun die Natur schön ist, so darf man
sagen, daß das bestehende Unendlichkeitsverhältnis
von Form und Aomposition, das sich überall in der
Natur äußert, die Schönheit bezeichnet, d. h. gerade
die unendlich mannigfaltigen Abweichungen, die be-
stehen zwischen den einzelnen Menschen, den Pferden,
zwischen Aastanienbäumen, Weinblättern rc. all-
überall in der Natur, sie sind ihr Schönheitselement.
In der Natur könnte man sich nun die Arten
zu Typen verdichtet denken und diese Typen in der
Vorstellung weiter konzentrieren, so würde man zum
Urtyp der Natur, zur absoluten Einheit kommen.
Ist die Natur schön, so müßte es auch ihr
Urtyp sein und absolute Einheit von Form und
Aomposition müßte hier die Schönheit darstellen.
Die Aunst nun muß, eben weil sie nicht Natur
ist, und sofern man sie als ein geistiges Produkt des
Menschen im Gegensatz zur natürlichen Materie be-
trachtet, zwischen beiden Grenzwerten liegen, auch bei
ihr muß also Einheit, d. h. ein konstantes Verhältnis
von Form und Aomposition, Schönheit sein, d. h.
auch in der Aunst muß sehr mannigfaltigen Forinen,
eine sehr mannigfaltige Aomposition entsprechen,
weniger mannigfaltigen Formen, eine weniger mannig-
faltige Aomposition, einfachen Formen eine einfache
Aomposition u. s. f. Und es muß angenommen
werden, daß das an der Natur geschulte menschliche
Empfinden die Fähigkeit besitzt, diese Einheit wahr-
zunehmen. Einige Beispiele müssen dieses Ergebnis
verdeutlichen.
An den Parthenonskulpturen entspricht der ein-
fachen Ruhe der Gestalten im ganzen und allen
Einzelheiten eine ebenso einfache Gesamtanordnung.
Beim Pergamenischen Friese sind die Gestalten leb
Haft bewegt in paltung, in Gebärde, im Faltenwurf,
kurz in allen Teilen und in demselben Grade ist
auch die Gruppenbildung eine wesentlich verwickeltere
geworden. An griechischen Palmettenbändern sind
die Formen ausgezeichnet durch strengste Einfachheit;
und wie in den palinetten in sich strenge Symmetrie
herrscht, so ist das Prinzip der Gesamtanordnung
einfachste Nebeneinanderreihung. Der japanische
Aünstler gibt Naturvorbilder mit ihren kleinen Zu-
fälligkeiten wieder. Und nur das vollkommene
Schönheitsempfindcn spricht daraus, daß er seinen
Zweig wie willkürlich über die Ecke einer Vierecks-
fläche legt. Erst durch den scheinbaren Zufall in
der Anordnung wird die Einheit erreichbar.
Und weiter sei darauf hingewiesen, daß es auch
unmöglich ein Zufall sein kann, daß bei einer
Monumentallandschaft Tlaude Lorrains der Auf-
fassung im ganzen auch die Behandlung der Einzel-
heiten entspricht, und daß es selbstverständlich ist,
daß ein Baun: dieses Aünstlers ein etwas anderes
Gepräge trägt wie ein von einen: modernen Aünstler
vor der Natur gemalter.
Dieses Gesetz der Einheit in Form: und Aom-
position gilt aber nicht etwa nur da, wo es sich un:
unmittelbare Naturnachbildungen handelt, auch in
der Architektur behält es volle Gültigkeit.
Man vergleiche nur einen griechischen Teinpel
mit einen: spätrömischen. Schlichte Ruhe in: ganzen
und allen Einzelheiten bei::: ersteren, gesteigerte Be-
wegung in der Gliederung und im Detail bei dem
jüngeren Bau. Und stellt :::an einen frühgotischen
Airchenbau neben einen Aathedralbau aus dem späten
s5. Jahrhundert, so tritt die gleiche Erscheinung
deutlich hervor; mit den Einzelfor:::en hat sich in:
selben Sinne das Ganze geändert. Dasselbe Ge-
staltungsprinzip, das sich in: Grundriß und in: Auf-
bau wahrnehmen läßt und das zweifellos in: ersten
Falle sehr viel einfacher ist als in: zweiten, findet sich
beide Male auch im Grna:::ent. Und nicht zu einem
andern Ergebnis kon:mt man, wenn n:an einen
kaum durch vortretende Pilaster gegliederten Bau der
italienischen Frührenaissance mit einer Iesuitenfassade
in Parallele stellt.
Unschön :nuß dann alles sein, den: die Einheit
von Forn: und Aon:position mangelt. Wollte :nan
z. B. an einen naturähnlich gezeichneten Zweig streng
gestaltete Palmetten als Blätter heften, so würde
jeder das päßliche empfinden, und wollte man sehr
naturähnlich gezeichnete Blätter oder dergleichen in
einfachster Reihung zusammenstellen, würde wiederum
jeder das Mißverhältnis, das Unschöne fühlen. Auch
mit der streng gezeichneten Ranke dürfte man über
ein gewisses Maß der Naturähnlichkeit hinausgehende
Blätter nicht verbinden, ohne das Gefühl zu verletzen.
Ungezählte ausgeführte Arbeiten, ganz besonders aus