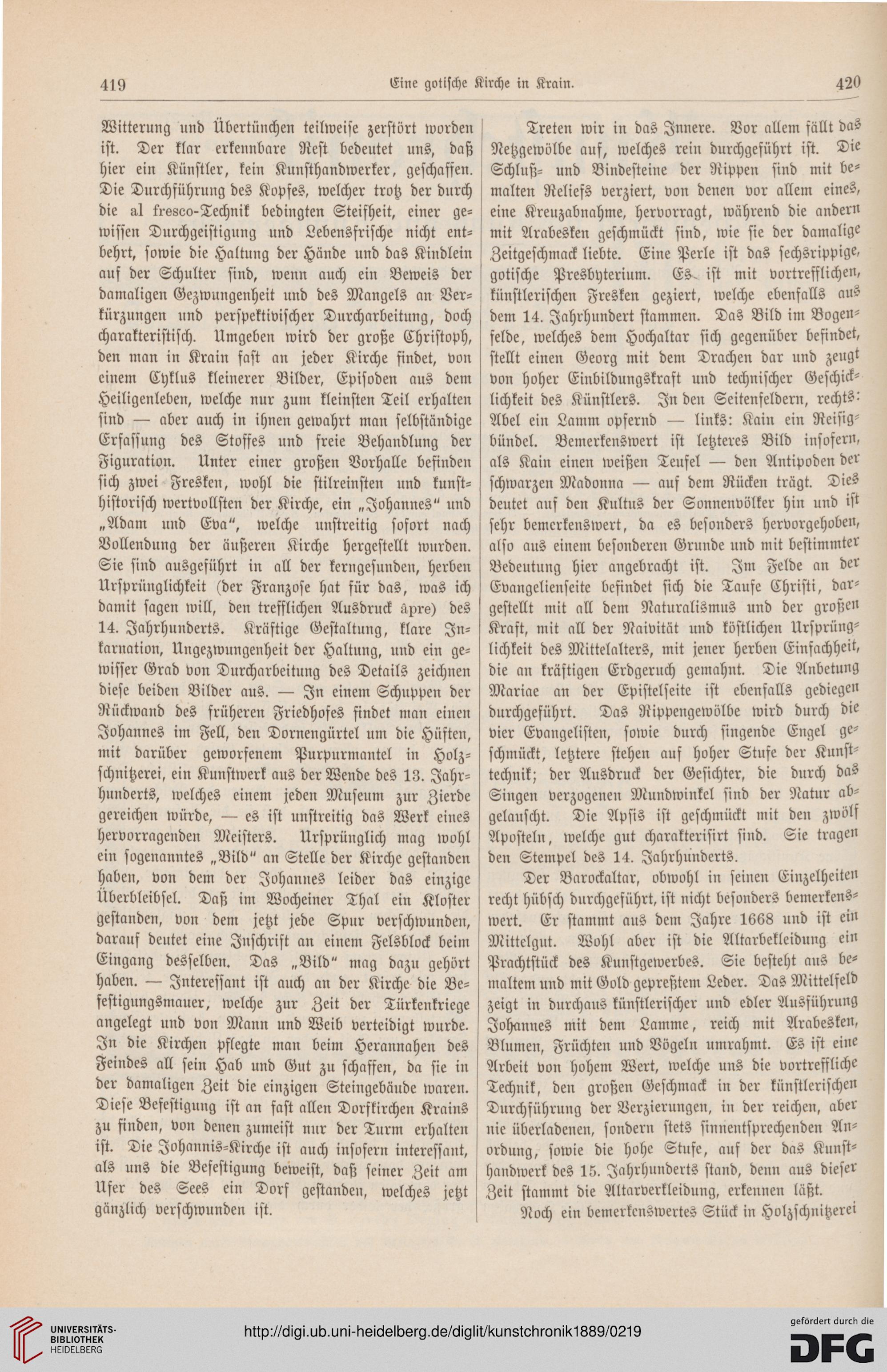419
Eine gotische Kirchs in Krain.
420
Witterung und Übertünchen teilweise zerstört worden
ist. Der klar erkennbare Rest bedeutet uns, daß
hier ein Künstler, kein Kunsthandwerker, geschaffen.
Die Durchführung des Kopfes, welcher trotz der durch
die al krssoo-Technik bedingten Steifheit, einer ge-
wissen Durchgeistigung und Lebensfrische nicht ent-
behrt, sowie die Haltung der Hände und das Kindlein
auf der Schulter sind, wenn auch ein Beweis der
damaligen Gezwungenheit und des Mangels an Ver-
kürzungen nnd perspektivischer Durcharbeitung, doch
charakteristisch. Umgeben wird der große Christoph,
den man in Krain fast an jeder Kirche findet, vou
einem Cyklus kleinerer Bilder, Episoden aus dem
Heiligenleben, welche nur zum kleinsten Teil erhalten
sind — aber auch in ihnen gewahrt man selbständige
Erfassung des Stoffes und freie Behandlung der
Figuration. Unter einer großen Borhalle befinden
sich zwei Fresken, wohl die stilreinsten und kunst-
historisch wertvollsten der Kirche, ein „Johannes" und
„Adam und Eva", welche unstreitig sofort nach
Vollendung der äußeren Kirche hergestellt wurden.
Sie sind ausgeführt in all der kerngesunden, herben
Ursprünglichkeit (der Franzose hat für das, was ich
damit sagen will, den trefflichen Ausdruck Lxrs) des
14. Jahrhuuderts. Kräftige Gestaltung, klare Jn-
karnation, Ungezwungenheit der Haltnng, und ein ge-
wisser Grad von Dnrcharbeitung des Details zeichnen
diese beiden Bilder aus. — Jn einem Schuppen der
Rückwand des früheren Friedhofes findet man einen
Johannes im Fell, den Dornengürtel um die Hüften,
mit darüber geworfenem Purpurmantel in Holz-
schnitzerei, ein Kunstwerk aus der Wende des 13. Jahr-
hunderts, welches einem jeden Museum zur Zierde
gereichen würde, — es ist unstreitig das Werk eiues
hervorragenden Meisters. Ursprünglich mag wohl
ein sogenanntes „Bild" an Stelle der Kirche gestanden
habeu, von dem der Johannes leider das einzige
Überbleibsel. Daß im Wocheiner Thal ein Kloster
gestanden, von dem jetzt jede Spur verschwunden,
darauf deutet eine Jnschrift an einem Felsblock beim
Eingang desselben. Das „Bild" mag dazu gehört
haben. — Jnteressant ist auch an der Kirche die Be-
festigungsmauer, welche zur Zeit der Türkenkriege
angelegt und von Mann und Weib verteidigt wurde.
Jn die Kirchen Pflegte mau beim Herannahen des
Feindes all sein Hab und Gut zu schaffen, da sie in
der damaligen Zeit die einzigen Steingebäude waren.
Diese Befestigung ist an fast allen Dorfkirchen Krains
zu finden, von denen zumeist nur der Turm erhalteu
ist. Die Johanuis-Kirche ist auch insoferu interessaiit,
als uns die Befestigung beweist, daß seiner Zeit am
Ufer des Sees ein Dorf gestanden, welches jetzt
gänzlich verschwunden ist.
Treten wir in das Jnnere. Vor allem fällt das
Netzgewölbe auf, welches rein durchgeführt ist. Die
Schluß- und Bindesteine der Rippen sind mit be-
malten Reliefs verziert, von denen vor allem eines,
eine Kreuzabnahme, hervorragt, während die andern
mit Arabesken geschmückt sind, wie sie der damalige
Zeitgeschmack liebte. Eine Perle ist das sechsrippige,
gotische Presbyterium. Es- ist mit vortrefflichen,
künstlerischen Fresken geziert, welche ebenfalls aus
dem 14. Jahrhundert stammen. Das Bild im Bogen-
felde, welches dem Hochaltar fich gegenüber befindet,
stellt einen Georg mit dem Drachen dar und zeugt
von hoher Einbildungskraft und technischer Geschick-
lichkeit des Künstlers. Jn den Seitenfeldern, rechts:
Abel ein Lamm opfernd — links: Kain ein Reisig-
bündel. Bemerkenswert ist letzteres Bild insofern,
als Kain einen weißen Teufel — den Antipoden der
schwarzen Madonna — auf dem Rücken trägt. Dies
deutet auf den Kultus der Sonnenvölker hin und ist
sehr bemerkenswert, da es besonders hervorgehoben,
also aus einem besonderen Grunde und mit bestimmter
Bedeutung hier angebracht ist. Jm Felde an der
Evangelienseite befindet sich die Taufe Christi, dar-
gestellt mit all dem Naturalismus und der großen
Kraft, mit all der Naivität und köstlichen Ursprüng-
lichkeit des Mittelalters, mit jener herben Einfachheit,
die an kräftigen Erdgeruch gemahnt. Die Anbetung
Mariae an der Epistelseite ist ebenfalls gediegen
durchgeführt. Das Rippengewölbe wird durch die
vier Evangelisten, sowie durch singende Engel ge-
schmückt, letztere stehen auf hoher Stufe der Kunst-
technik; der Ausdruck der Gesichter, die durch das
Singen verzogenen Mundwinkel sind der Natur ab-
gelauscht. Die Apsis ist geschmückt mit den zwölf
Aposteln, welche gut charakterisirt siud. Sie tragen
den Stempel des 14. Jahrhünderts.
Der Barockaltar, obwohl in seinen Einzelheiten
recht hübsch durchgeführt, ist nicht besouders bemerkens-
wert. Er stammt aus dem Jahre 1668 und ist ein
Mittelgut. Wohl aber ist die Altarbekleidung ein
Prachtstück des Kunstgewerbes. Sie besteht aus be-
maltem und mit Gold gepreßtem Leder. Das Mittelfeld
zeigt in durchaus künstlerischer und edler Ausführung
Johannes mit dem Lamme, reich mit Arabesken,
Blumen, Früchten und Vögeln umrahmt. Es ist eine
Arbeit von hohem Wert, welche uns die vortreffliche
Technik, den großen Geschmack in der künstlerischen
Durchführung der Verzierungen, in der reichen, aber
nie überladenen, sondern stets sinnentsprechenden An-
ordung, sowie die hohe Stufe, auf der das Kunst-
handwerk des 15. Jahrhunderts stand, denn aus dieser
Zeit stammt die Altarverkleidung, erkennen läßt.
Noch ein bemerkcnswertes Stück in Holzschnitzerei
Eine gotische Kirchs in Krain.
420
Witterung und Übertünchen teilweise zerstört worden
ist. Der klar erkennbare Rest bedeutet uns, daß
hier ein Künstler, kein Kunsthandwerker, geschaffen.
Die Durchführung des Kopfes, welcher trotz der durch
die al krssoo-Technik bedingten Steifheit, einer ge-
wissen Durchgeistigung und Lebensfrische nicht ent-
behrt, sowie die Haltung der Hände und das Kindlein
auf der Schulter sind, wenn auch ein Beweis der
damaligen Gezwungenheit und des Mangels an Ver-
kürzungen nnd perspektivischer Durcharbeitung, doch
charakteristisch. Umgeben wird der große Christoph,
den man in Krain fast an jeder Kirche findet, vou
einem Cyklus kleinerer Bilder, Episoden aus dem
Heiligenleben, welche nur zum kleinsten Teil erhalten
sind — aber auch in ihnen gewahrt man selbständige
Erfassung des Stoffes und freie Behandlung der
Figuration. Unter einer großen Borhalle befinden
sich zwei Fresken, wohl die stilreinsten und kunst-
historisch wertvollsten der Kirche, ein „Johannes" und
„Adam und Eva", welche unstreitig sofort nach
Vollendung der äußeren Kirche hergestellt wurden.
Sie sind ausgeführt in all der kerngesunden, herben
Ursprünglichkeit (der Franzose hat für das, was ich
damit sagen will, den trefflichen Ausdruck Lxrs) des
14. Jahrhuuderts. Kräftige Gestaltung, klare Jn-
karnation, Ungezwungenheit der Haltnng, und ein ge-
wisser Grad von Dnrcharbeitung des Details zeichnen
diese beiden Bilder aus. — Jn einem Schuppen der
Rückwand des früheren Friedhofes findet man einen
Johannes im Fell, den Dornengürtel um die Hüften,
mit darüber geworfenem Purpurmantel in Holz-
schnitzerei, ein Kunstwerk aus der Wende des 13. Jahr-
hunderts, welches einem jeden Museum zur Zierde
gereichen würde, — es ist unstreitig das Werk eiues
hervorragenden Meisters. Ursprünglich mag wohl
ein sogenanntes „Bild" an Stelle der Kirche gestanden
habeu, von dem der Johannes leider das einzige
Überbleibsel. Daß im Wocheiner Thal ein Kloster
gestanden, von dem jetzt jede Spur verschwunden,
darauf deutet eine Jnschrift an einem Felsblock beim
Eingang desselben. Das „Bild" mag dazu gehört
haben. — Jnteressant ist auch an der Kirche die Be-
festigungsmauer, welche zur Zeit der Türkenkriege
angelegt und von Mann und Weib verteidigt wurde.
Jn die Kirchen Pflegte mau beim Herannahen des
Feindes all sein Hab und Gut zu schaffen, da sie in
der damaligen Zeit die einzigen Steingebäude waren.
Diese Befestigung ist an fast allen Dorfkirchen Krains
zu finden, von denen zumeist nur der Turm erhalteu
ist. Die Johanuis-Kirche ist auch insoferu interessaiit,
als uns die Befestigung beweist, daß seiner Zeit am
Ufer des Sees ein Dorf gestanden, welches jetzt
gänzlich verschwunden ist.
Treten wir in das Jnnere. Vor allem fällt das
Netzgewölbe auf, welches rein durchgeführt ist. Die
Schluß- und Bindesteine der Rippen sind mit be-
malten Reliefs verziert, von denen vor allem eines,
eine Kreuzabnahme, hervorragt, während die andern
mit Arabesken geschmückt sind, wie sie der damalige
Zeitgeschmack liebte. Eine Perle ist das sechsrippige,
gotische Presbyterium. Es- ist mit vortrefflichen,
künstlerischen Fresken geziert, welche ebenfalls aus
dem 14. Jahrhundert stammen. Das Bild im Bogen-
felde, welches dem Hochaltar fich gegenüber befindet,
stellt einen Georg mit dem Drachen dar und zeugt
von hoher Einbildungskraft und technischer Geschick-
lichkeit des Künstlers. Jn den Seitenfeldern, rechts:
Abel ein Lamm opfernd — links: Kain ein Reisig-
bündel. Bemerkenswert ist letzteres Bild insofern,
als Kain einen weißen Teufel — den Antipoden der
schwarzen Madonna — auf dem Rücken trägt. Dies
deutet auf den Kultus der Sonnenvölker hin und ist
sehr bemerkenswert, da es besonders hervorgehoben,
also aus einem besonderen Grunde und mit bestimmter
Bedeutung hier angebracht ist. Jm Felde an der
Evangelienseite befindet sich die Taufe Christi, dar-
gestellt mit all dem Naturalismus und der großen
Kraft, mit all der Naivität und köstlichen Ursprüng-
lichkeit des Mittelalters, mit jener herben Einfachheit,
die an kräftigen Erdgeruch gemahnt. Die Anbetung
Mariae an der Epistelseite ist ebenfalls gediegen
durchgeführt. Das Rippengewölbe wird durch die
vier Evangelisten, sowie durch singende Engel ge-
schmückt, letztere stehen auf hoher Stufe der Kunst-
technik; der Ausdruck der Gesichter, die durch das
Singen verzogenen Mundwinkel sind der Natur ab-
gelauscht. Die Apsis ist geschmückt mit den zwölf
Aposteln, welche gut charakterisirt siud. Sie tragen
den Stempel des 14. Jahrhünderts.
Der Barockaltar, obwohl in seinen Einzelheiten
recht hübsch durchgeführt, ist nicht besouders bemerkens-
wert. Er stammt aus dem Jahre 1668 und ist ein
Mittelgut. Wohl aber ist die Altarbekleidung ein
Prachtstück des Kunstgewerbes. Sie besteht aus be-
maltem und mit Gold gepreßtem Leder. Das Mittelfeld
zeigt in durchaus künstlerischer und edler Ausführung
Johannes mit dem Lamme, reich mit Arabesken,
Blumen, Früchten und Vögeln umrahmt. Es ist eine
Arbeit von hohem Wert, welche uns die vortreffliche
Technik, den großen Geschmack in der künstlerischen
Durchführung der Verzierungen, in der reichen, aber
nie überladenen, sondern stets sinnentsprechenden An-
ordung, sowie die hohe Stufe, auf der das Kunst-
handwerk des 15. Jahrhunderts stand, denn aus dieser
Zeit stammt die Altarverkleidung, erkennen läßt.
Noch ein bemerkcnswertes Stück in Holzschnitzerei