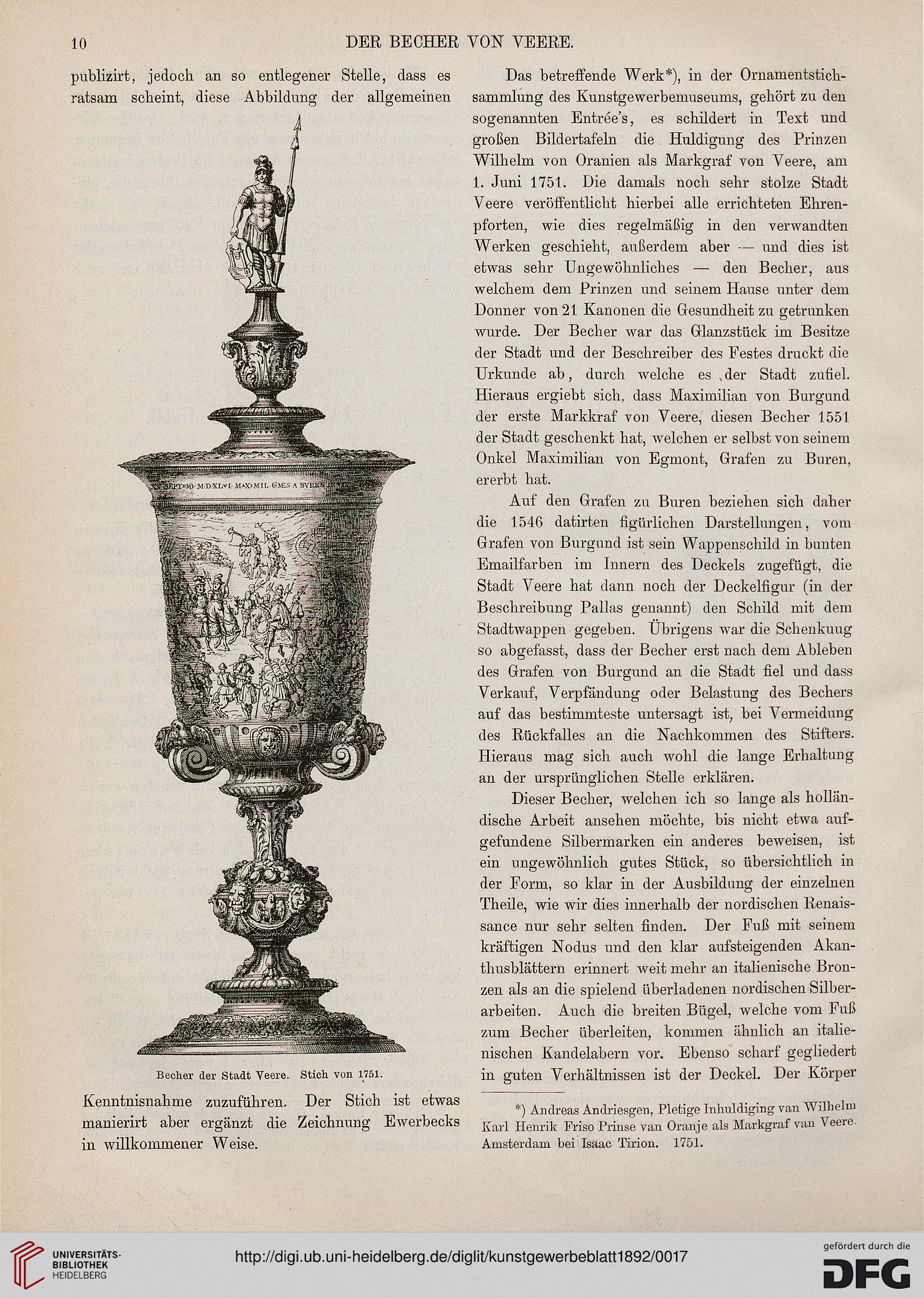10
DER BECHER VON VEERE.
publizirt, jedoch an so entlegener Stelle, dass es
ratsam scheint, diese Abbildung der allgemeinen
Becher der Stadt Yeere. Stich von 1751.
Kenntnisnahme zuzuführen. Der Stich ist etwas
manierirt aber ergänzt die Zeichnung Ewerbecks
in willkommener Weise.
Das betreffende Werk*), in der Ornamentstich-
sammlung des Kunstgewerbemuseums, gehört zu den
sogenannten Entree's, es schildert in Text und
großen Bildertafeln die Huldigung des Prinzen
Wilhelm von Oranien als Markgraf von Veere, am
1. Juni 1751. Die damals noch sehr stolze Stadt
Veere veröffentlicht hierbei alle errichteten Ehren-
pforten, wie dies regelmäßig in den verwandten
Werken geschieht, außerdem aber — und dies ist
etwas sehr Ungewöhnliches — den Becher, aus
welchem dem Prinzen und seinem Hause unter dem
Donner von 21 Kanonen die Gesundheit zu getrunken
wurde. Der Becher war das Glanzstück im Besitze
der Stadt und der Beschreiber des Festes druckt die
Urkunde ab, durch welche es , der Stadt zufiel.
Hieraus ergiebt sich, dass Maximilian von Burgund
der erste Markkraf von Veere, diesen Becher 1551
der Stadt geschenkt hat, welchen er selbst von seinem
Onkel Maximilian von Egmont, Grafen zu Buren,
ererbt hat.
Auf den Grafen zu Buren beziehen sich daher
die 1546 datirten figürlichen Darstellungen, vom
Grafen von Burgund ist sein Wappenschild in bunten
Emailfarben im Innern des Deckels zugefügt, die
Stadt Veere hat dann noch der Deckelfigur (in der
Beschreibung Pallas genannt) den Schild mit dem
Stadtwappen gegeben. Übrigens war die Schenkuug
so abgefasst, dass der Becher erst nach dem Ableben
des Grafen von Burgund an die Stadt fiel und dass
Verkauf, Verpfändung oder Belastung des Bechers
auf das bestimmteste untersagt ist, bei Vermeidung
des Rückfalles an die Nachkommen des Stifters.
Hieraus mag sich auch wohl die lange Erhaltung
an der ursprünglichen Stelle erklären.
Dieser Becher, welchen ich so lange als hollän-
dische Arbeit ansehen möchte, bis nicht etwa auf-
gefundene Silbermarken ein anderes beweisen, ist
ein ungewöhnlich gutes Stück, so übersichtlich in
der Form, so klar in der Ausbildung der einzelnen
Theile, wie wir dies innerhalb der nordischen Renais-
sance nur sehr selten finden. Der Fuß mit seinem
kräftigen Nodus und den klar aufsteigenden Akan-
thusblättern erinnert weit mehr an italienische Bron-
zen als an die spielend überladenen nordischen Silber-
arbeiten. Auch die breiten Bügel, welche vom Fuß
zum Becher überleiten, kommen ähnlich an italie-
nischen Kandelabern vor. Ebenso scharf gegliedert
in guten Verhältnissen ist der Deckel. Der Körper
*) Andreas Andriesgen, Pletige Inhuldiging van Wilhelm
Karl Henrik Friso Prinse van Oranje als Markgraf van Veere.
Amsterdam bei Isaac Tirion. 1751.
DER BECHER VON VEERE.
publizirt, jedoch an so entlegener Stelle, dass es
ratsam scheint, diese Abbildung der allgemeinen
Becher der Stadt Yeere. Stich von 1751.
Kenntnisnahme zuzuführen. Der Stich ist etwas
manierirt aber ergänzt die Zeichnung Ewerbecks
in willkommener Weise.
Das betreffende Werk*), in der Ornamentstich-
sammlung des Kunstgewerbemuseums, gehört zu den
sogenannten Entree's, es schildert in Text und
großen Bildertafeln die Huldigung des Prinzen
Wilhelm von Oranien als Markgraf von Veere, am
1. Juni 1751. Die damals noch sehr stolze Stadt
Veere veröffentlicht hierbei alle errichteten Ehren-
pforten, wie dies regelmäßig in den verwandten
Werken geschieht, außerdem aber — und dies ist
etwas sehr Ungewöhnliches — den Becher, aus
welchem dem Prinzen und seinem Hause unter dem
Donner von 21 Kanonen die Gesundheit zu getrunken
wurde. Der Becher war das Glanzstück im Besitze
der Stadt und der Beschreiber des Festes druckt die
Urkunde ab, durch welche es , der Stadt zufiel.
Hieraus ergiebt sich, dass Maximilian von Burgund
der erste Markkraf von Veere, diesen Becher 1551
der Stadt geschenkt hat, welchen er selbst von seinem
Onkel Maximilian von Egmont, Grafen zu Buren,
ererbt hat.
Auf den Grafen zu Buren beziehen sich daher
die 1546 datirten figürlichen Darstellungen, vom
Grafen von Burgund ist sein Wappenschild in bunten
Emailfarben im Innern des Deckels zugefügt, die
Stadt Veere hat dann noch der Deckelfigur (in der
Beschreibung Pallas genannt) den Schild mit dem
Stadtwappen gegeben. Übrigens war die Schenkuug
so abgefasst, dass der Becher erst nach dem Ableben
des Grafen von Burgund an die Stadt fiel und dass
Verkauf, Verpfändung oder Belastung des Bechers
auf das bestimmteste untersagt ist, bei Vermeidung
des Rückfalles an die Nachkommen des Stifters.
Hieraus mag sich auch wohl die lange Erhaltung
an der ursprünglichen Stelle erklären.
Dieser Becher, welchen ich so lange als hollän-
dische Arbeit ansehen möchte, bis nicht etwa auf-
gefundene Silbermarken ein anderes beweisen, ist
ein ungewöhnlich gutes Stück, so übersichtlich in
der Form, so klar in der Ausbildung der einzelnen
Theile, wie wir dies innerhalb der nordischen Renais-
sance nur sehr selten finden. Der Fuß mit seinem
kräftigen Nodus und den klar aufsteigenden Akan-
thusblättern erinnert weit mehr an italienische Bron-
zen als an die spielend überladenen nordischen Silber-
arbeiten. Auch die breiten Bügel, welche vom Fuß
zum Becher überleiten, kommen ähnlich an italie-
nischen Kandelabern vor. Ebenso scharf gegliedert
in guten Verhältnissen ist der Deckel. Der Körper
*) Andreas Andriesgen, Pletige Inhuldiging van Wilhelm
Karl Henrik Friso Prinse van Oranje als Markgraf van Veere.
Amsterdam bei Isaac Tirion. 1751.