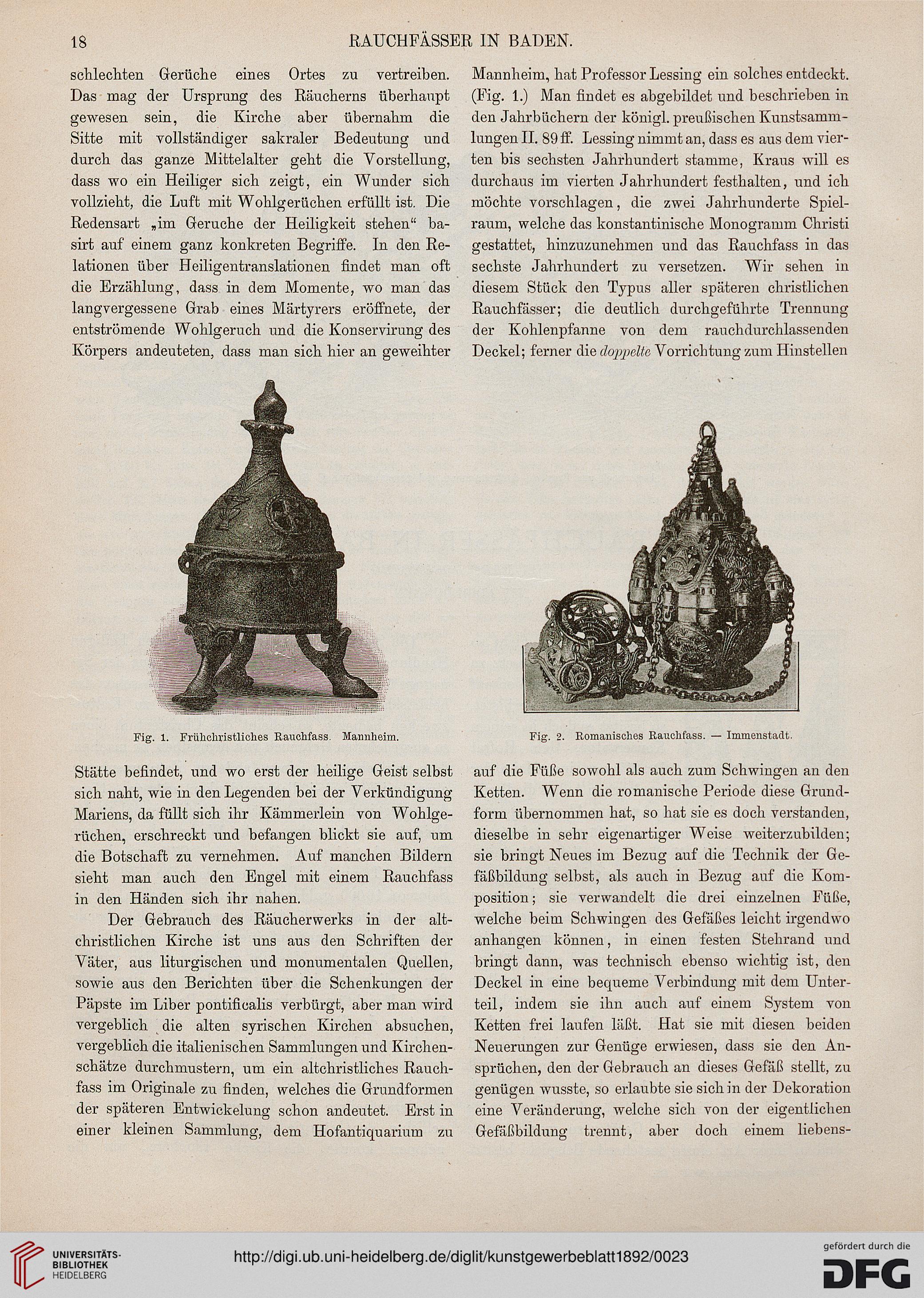18
RAUCHFÄSSER IN BADEN.
schlechten Gerüche eines Ortes zu vertreiben.
Das mag der Ursprung des Räucherns überhaupt
gewesen sein, die Kirche aber übernahm die
Sitte mit vollständiger sakraler Bedeutung und
durch das ganze Mittelalter geht die Vorstellung,
dass wo ein Heiliger sich zeigt, ein Wunder sich
vollzieht, die Luft mit Wohlgerüchen erfüllt ist. Die
Redensart „im Gerüche der Heiligkeit stehen" ba-
sirt auf einem ganz konkreten Begriffe. In den Re-
lationen über Heiligentranslationen findet man oft
die Erzählung, dass in dem Momente, wo man das
langvergessene Grab eines Märtyrers eröffnete, der
entströmende Wohlgeruch und die Konservirung des
Körpers andeuteten, dass man sich hier an geweihter
Fig. 1. Frühchristliches Eauchfass. Mannheim.
Stätte befindet, und wo erst der heilige Geist selbst
sich naht, wie in den Legenden bei der Verkündigung
Mariens, da füllt sich ihr Kämmerlein von Wohlge-
rüchen, erschreckt und befangen blickt sie auf, um
die Botschaft zu vernehmen. Auf manchen Bildern
sieht man auch den Engel mit einem Rauchfass
in den Händen sich ihr nahen.
Der Gehrauch des Räucherwerks in der alt-
christlichen Kirche ist uns aus den Schriften der
Väter, aus liturgischen und monumentalen Quellen,
sowie aus den Berichten über die Schenkungen der
Päpste im Liber pontificalis verbürgt, aber man wird
vergeblich die alten syrischen Kirchen absuchen,
vergeblich die italienischen Sammlungen und Kirchen-
schätze durchmustern, um ein altchristliches Rauch-
fass im Originale zu finden, welches die Grundformen
der späteren Entwickelung schon andeutet. Erst in
einer kleinen Sammlung, dem Hofantiquarimn zu
Mannheim, hat Professor Lessing ein solches entdeckt.
(Fig. 1.) Man findet es abgebildet und beschrieben in
den Jahrbüchern der königl. preußischen Kunstsamm-
lungen II. 89 ff. Lessing nimmt an, dass es aus dem vier-
ten bis sechsten Jahrhundert stamme, Kraus will es
durchaus im vierten Jahrhundert festhalten, und ich
möchte vorschlagen, die zwei Jahrhunderte Spiel-
raum, welche das konstantinische Monogramm Christi
gestattet, hinzuzunehmen und das Rauchfass in das
sechste Jahrhundert zu versetzen. Wir sehen in
diesem Stück den Typus aller späteren christlichen
Rauchfässer; die deutlich durchgeführte Trennung
der Kohlenpfanne von dem rauchdurchlassenden
Deckel; ferner die doppelte Vorrichtung zum Hinstellen
FiK
Romanisches Eauchfass. — Immenstadt.
auf die Füße sowohl als auch zum Schwingen an den
Ketten. Wenn die romanische Periode diese Grund-
form übernommen hat, so hat sie es doch verstanden,
dieselbe in sehr eigenartiger Weise weiterzubilden;
sie bringt Neues im Bezug auf die Technik der Ge-
fäßbildung selbst, als auch in Bezug auf die Kom-
position ; sie verwandelt die drei einzelnen Füße,
welche beim Schwingen des Gefäßes leicht irgendwo
anhangen können, in einen festen Stehrand und
bringt dann, was technisch ebenso wichtig ist, den
Deckel in eine bequeme Verbindung mit dem Unter-
teil, indem sie ihn auch auf einem System von
Ketten frei laufen läßt. Hat sie mit diesen beiden
Neuerungen zur Genüge erwiesen, dass sie den An-
sprüchen, den der Gebrauch an dieses Gefäß stellt, zu
genügen wusste, so erlaubte sie sich in der Dekoration
eine Veränderung, welche sich von der eigentlichen
Gefäßbildung trennt, aber doch einem Hebens-
RAUCHFÄSSER IN BADEN.
schlechten Gerüche eines Ortes zu vertreiben.
Das mag der Ursprung des Räucherns überhaupt
gewesen sein, die Kirche aber übernahm die
Sitte mit vollständiger sakraler Bedeutung und
durch das ganze Mittelalter geht die Vorstellung,
dass wo ein Heiliger sich zeigt, ein Wunder sich
vollzieht, die Luft mit Wohlgerüchen erfüllt ist. Die
Redensart „im Gerüche der Heiligkeit stehen" ba-
sirt auf einem ganz konkreten Begriffe. In den Re-
lationen über Heiligentranslationen findet man oft
die Erzählung, dass in dem Momente, wo man das
langvergessene Grab eines Märtyrers eröffnete, der
entströmende Wohlgeruch und die Konservirung des
Körpers andeuteten, dass man sich hier an geweihter
Fig. 1. Frühchristliches Eauchfass. Mannheim.
Stätte befindet, und wo erst der heilige Geist selbst
sich naht, wie in den Legenden bei der Verkündigung
Mariens, da füllt sich ihr Kämmerlein von Wohlge-
rüchen, erschreckt und befangen blickt sie auf, um
die Botschaft zu vernehmen. Auf manchen Bildern
sieht man auch den Engel mit einem Rauchfass
in den Händen sich ihr nahen.
Der Gehrauch des Räucherwerks in der alt-
christlichen Kirche ist uns aus den Schriften der
Väter, aus liturgischen und monumentalen Quellen,
sowie aus den Berichten über die Schenkungen der
Päpste im Liber pontificalis verbürgt, aber man wird
vergeblich die alten syrischen Kirchen absuchen,
vergeblich die italienischen Sammlungen und Kirchen-
schätze durchmustern, um ein altchristliches Rauch-
fass im Originale zu finden, welches die Grundformen
der späteren Entwickelung schon andeutet. Erst in
einer kleinen Sammlung, dem Hofantiquarimn zu
Mannheim, hat Professor Lessing ein solches entdeckt.
(Fig. 1.) Man findet es abgebildet und beschrieben in
den Jahrbüchern der königl. preußischen Kunstsamm-
lungen II. 89 ff. Lessing nimmt an, dass es aus dem vier-
ten bis sechsten Jahrhundert stamme, Kraus will es
durchaus im vierten Jahrhundert festhalten, und ich
möchte vorschlagen, die zwei Jahrhunderte Spiel-
raum, welche das konstantinische Monogramm Christi
gestattet, hinzuzunehmen und das Rauchfass in das
sechste Jahrhundert zu versetzen. Wir sehen in
diesem Stück den Typus aller späteren christlichen
Rauchfässer; die deutlich durchgeführte Trennung
der Kohlenpfanne von dem rauchdurchlassenden
Deckel; ferner die doppelte Vorrichtung zum Hinstellen
FiK
Romanisches Eauchfass. — Immenstadt.
auf die Füße sowohl als auch zum Schwingen an den
Ketten. Wenn die romanische Periode diese Grund-
form übernommen hat, so hat sie es doch verstanden,
dieselbe in sehr eigenartiger Weise weiterzubilden;
sie bringt Neues im Bezug auf die Technik der Ge-
fäßbildung selbst, als auch in Bezug auf die Kom-
position ; sie verwandelt die drei einzelnen Füße,
welche beim Schwingen des Gefäßes leicht irgendwo
anhangen können, in einen festen Stehrand und
bringt dann, was technisch ebenso wichtig ist, den
Deckel in eine bequeme Verbindung mit dem Unter-
teil, indem sie ihn auch auf einem System von
Ketten frei laufen läßt. Hat sie mit diesen beiden
Neuerungen zur Genüge erwiesen, dass sie den An-
sprüchen, den der Gebrauch an dieses Gefäß stellt, zu
genügen wusste, so erlaubte sie sich in der Dekoration
eine Veränderung, welche sich von der eigentlichen
Gefäßbildung trennt, aber doch einem Hebens-