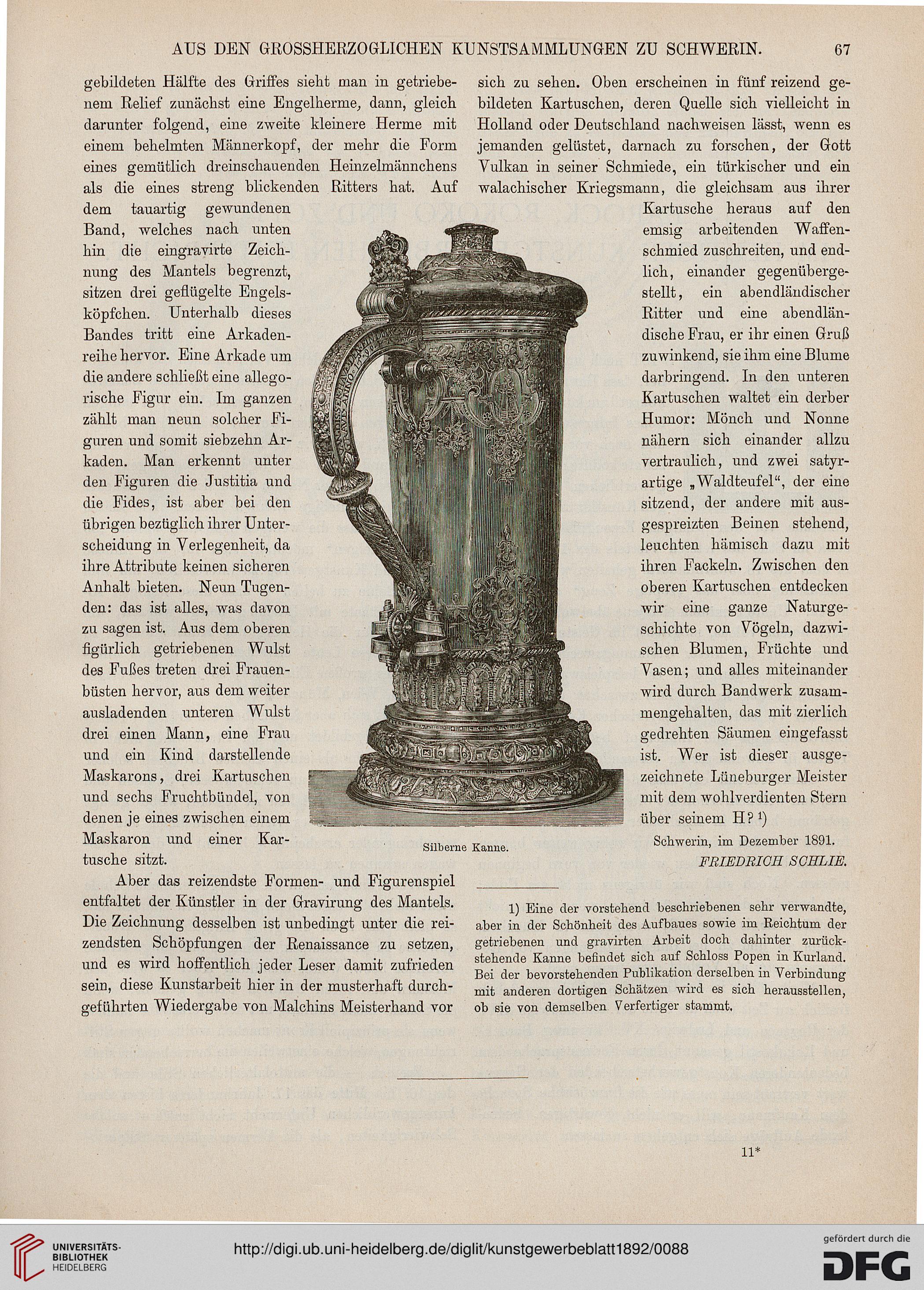AUS DEN GROSSHERZOGLICHEN KUNSTSAMMLUNGEN ZU SCHWERIN.
67
gebildeten Hälfte des Griffes sieht man in getriebe-
nem Relief zunächst eine Engelherme, dann, gleich
darunter folgend, eine zweite kleinere Herme mit
einem behelmten Männerkopf, der mehr die Form
eines gemütlich dreinschauenden Heinzelmännchens
als die eines streng blickenden Ritters hat. Auf
dem tauartig gewundenen
Band, welches nach unten
hin die eingravirte Zeich-
nung des Mantels begrenzt,
sitzen drei geflügelte Engels-
köpfchen. Unterhalb dieses
Bandes tritt eine Arkaden-
reihe hervor. Eine Arkade um
die andere schließt eine allego-
rische Figur ein. Im ganzen
zählt man neun solcher Fi-
guren und somit siebzehn Ar-
kaden. Man erkennt unter
den Figuren die Justitia und
die Fides, ist aber bei den
übrigen bezüglich ihrer Unter-
scheidung in Verlegenheit, da
ihre Attribute keinen sicheren
Anhalt bieten. Neun Tugen-
den: das ist alles, was davon
zu sagen ist. Aus dem oberen
figürlich getriebenen Wulst
des Fußes treten drei Frauen-
büsten hervor, aus dem weiter
ausladenden unteren Wulst
drei einen Mann, eine Frau
und ein Kind darstellende
Maskarons, drei Kartuschen
und sechs Fruchtbündel, von
denen je eines zwischen einem
Maskaron und einer Kar-
tusche sitzt.
Aber das reizendste Formen- und Figurenspiel
entfaltet der Künstler in der Gravirung des Mantels.
Die Zeichnung desselben ist unbedingt unter die rei-
zendsten Schöpfungen der Renaissance zu setzen,
und es wird hoffentlich jeder Leser damit zufrieden
sein, diese Kunstarbeit hier in der musterhaft durch-
geführten Wiedergabe von Malchins Meisterhand vor
Silberne Kanne.
sich zu sehen. Oben erscheinen in fünf reizend ge-
bildeten Kartuschen, deren Quelle sich vielleicht in
Holland oder Deutschland nachweisen lässt, wenn es
jemanden gelüstet, darnach zu forschen, der Gott
Vulkan in seiner Schmiede, ein türkischer und ein
walachischer Kriegsmann, die gleichsam aus ihrer
Kartusche heraus auf den
emsig arbeitenden Waffen-
schmied zuschreiten, und end-
lich, einander gegenüberge-
stellt , ein abendländischer
Ritter und eine abendlän-
dische Frau, er ihr einen Gruß
zuwinkend, sie ihm eine Blume
darbringend. In den unteren
Kartuschen waltet ein derber
Humor: Mönch und Nonne
nähern sich einander allzu
vertraulich, und zwei satyr-
artige „Waldteufel", der eine
sitzend, der andere mit aus-
gespreizten Beinen stehend,
leuchten hämisch dazu mit
ihren Fackeln. Zwischen den
oberen Kartuschen entdecken
wir eine ganze Naturge-
schichte von Vögeln, dazwi-
schen Blumen, Früchte und
Vasen; und alles miteinander
wird durch Bandwerk zusam-
mengehalten, das mit zierlich
gedrehten Säumen eingefasst
ist. Wer ist dieser ausge-
zeichnete Lüneburger Meister
mit dem wohlverdienten Stern
über seinem H ? *)
Schwerin, im Dezember 1891.
FRIEDRICH SCHLIE.
1) Eine der vorstehend beschriebenen sehr verwandte,
aber in der Schönheit des Aufbaues sowie im Reichtum der
getriebenen und gravirten Arbeit doch dahinter zurück-
stehende Kanne befindet sich auf Schloss Popen in Kurland.
Bei der bevorstehenden Publikation derselben in Verbindung
mit anderen dortigen Schätzen wird es sich herausstellen,
ob sie von demselben Verfertiger stammt.
11*
67
gebildeten Hälfte des Griffes sieht man in getriebe-
nem Relief zunächst eine Engelherme, dann, gleich
darunter folgend, eine zweite kleinere Herme mit
einem behelmten Männerkopf, der mehr die Form
eines gemütlich dreinschauenden Heinzelmännchens
als die eines streng blickenden Ritters hat. Auf
dem tauartig gewundenen
Band, welches nach unten
hin die eingravirte Zeich-
nung des Mantels begrenzt,
sitzen drei geflügelte Engels-
köpfchen. Unterhalb dieses
Bandes tritt eine Arkaden-
reihe hervor. Eine Arkade um
die andere schließt eine allego-
rische Figur ein. Im ganzen
zählt man neun solcher Fi-
guren und somit siebzehn Ar-
kaden. Man erkennt unter
den Figuren die Justitia und
die Fides, ist aber bei den
übrigen bezüglich ihrer Unter-
scheidung in Verlegenheit, da
ihre Attribute keinen sicheren
Anhalt bieten. Neun Tugen-
den: das ist alles, was davon
zu sagen ist. Aus dem oberen
figürlich getriebenen Wulst
des Fußes treten drei Frauen-
büsten hervor, aus dem weiter
ausladenden unteren Wulst
drei einen Mann, eine Frau
und ein Kind darstellende
Maskarons, drei Kartuschen
und sechs Fruchtbündel, von
denen je eines zwischen einem
Maskaron und einer Kar-
tusche sitzt.
Aber das reizendste Formen- und Figurenspiel
entfaltet der Künstler in der Gravirung des Mantels.
Die Zeichnung desselben ist unbedingt unter die rei-
zendsten Schöpfungen der Renaissance zu setzen,
und es wird hoffentlich jeder Leser damit zufrieden
sein, diese Kunstarbeit hier in der musterhaft durch-
geführten Wiedergabe von Malchins Meisterhand vor
Silberne Kanne.
sich zu sehen. Oben erscheinen in fünf reizend ge-
bildeten Kartuschen, deren Quelle sich vielleicht in
Holland oder Deutschland nachweisen lässt, wenn es
jemanden gelüstet, darnach zu forschen, der Gott
Vulkan in seiner Schmiede, ein türkischer und ein
walachischer Kriegsmann, die gleichsam aus ihrer
Kartusche heraus auf den
emsig arbeitenden Waffen-
schmied zuschreiten, und end-
lich, einander gegenüberge-
stellt , ein abendländischer
Ritter und eine abendlän-
dische Frau, er ihr einen Gruß
zuwinkend, sie ihm eine Blume
darbringend. In den unteren
Kartuschen waltet ein derber
Humor: Mönch und Nonne
nähern sich einander allzu
vertraulich, und zwei satyr-
artige „Waldteufel", der eine
sitzend, der andere mit aus-
gespreizten Beinen stehend,
leuchten hämisch dazu mit
ihren Fackeln. Zwischen den
oberen Kartuschen entdecken
wir eine ganze Naturge-
schichte von Vögeln, dazwi-
schen Blumen, Früchte und
Vasen; und alles miteinander
wird durch Bandwerk zusam-
mengehalten, das mit zierlich
gedrehten Säumen eingefasst
ist. Wer ist dieser ausge-
zeichnete Lüneburger Meister
mit dem wohlverdienten Stern
über seinem H ? *)
Schwerin, im Dezember 1891.
FRIEDRICH SCHLIE.
1) Eine der vorstehend beschriebenen sehr verwandte,
aber in der Schönheit des Aufbaues sowie im Reichtum der
getriebenen und gravirten Arbeit doch dahinter zurück-
stehende Kanne befindet sich auf Schloss Popen in Kurland.
Bei der bevorstehenden Publikation derselben in Verbindung
mit anderen dortigen Schätzen wird es sich herausstellen,
ob sie von demselben Verfertiger stammt.
11*