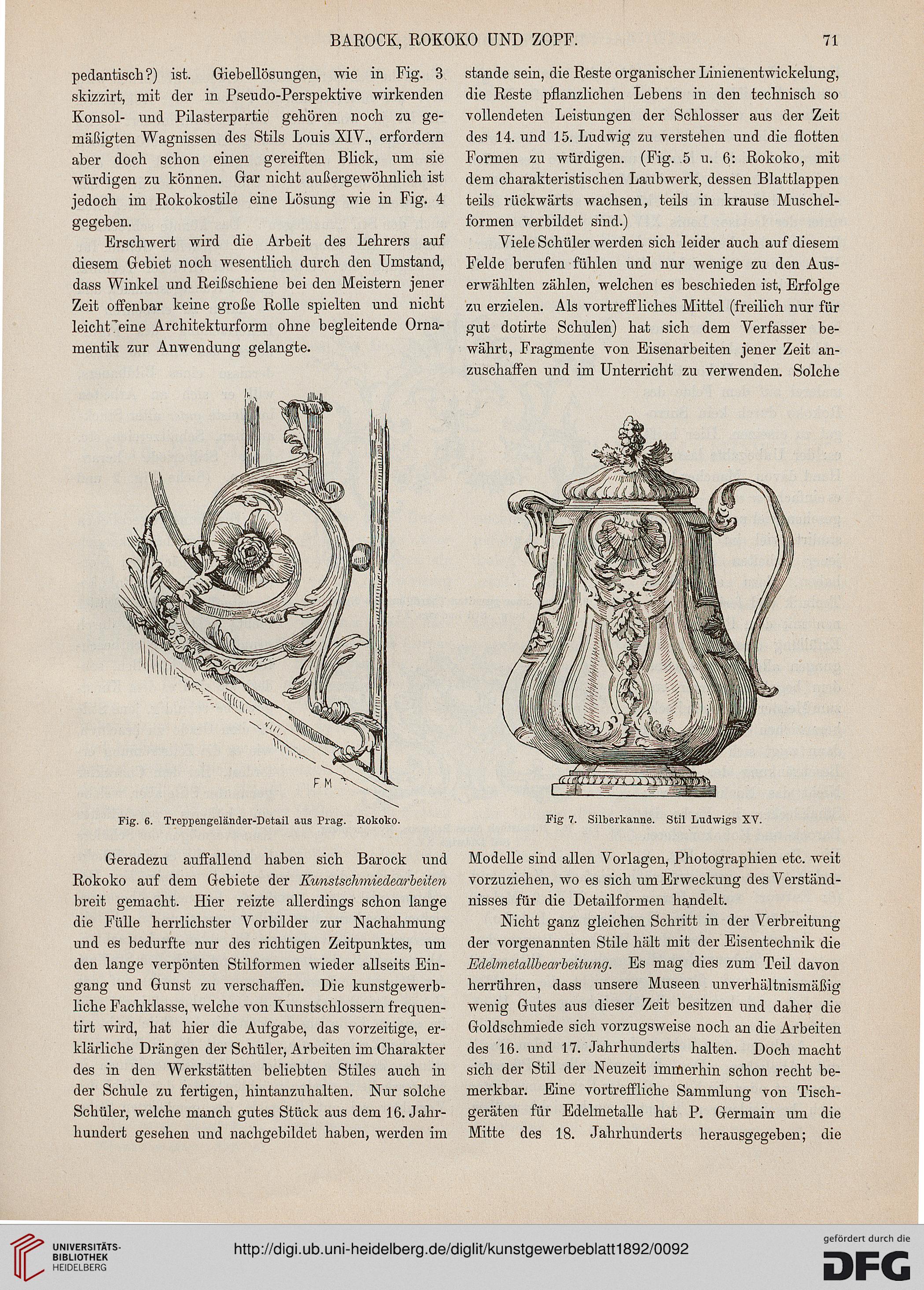BAROCK, ROKOKO UND ZOPF.
71
pedantisch?) ist. Giebellösungen, wie in Fig. 3
skizzirt, mit der in Pseudo-Perspektive wirkenden
Konsol- und Pilasterpartie gehören noch zu ge-
mäßigten Wagnissen des Stils Louis XIV., erfordern
aber doch schon einen gereiften Blick, um sie
würdigen zu können. Gar nicht außergewöhnlich ist
jedoch im Rokokostile eine Lösung wie in Fig. 4
gegeben.
Erschwert wird die Arbeit des Lehrers auf
diesem Gebiet noch wesentlich durch den Umstand,
dass Winkel und Reißschiene bei den Meistern jener
Zeit offenbar keine große Rolle spielten und nicht
leichfeine Architekturform ohne begleitende Orna-
mentik zur Anwendung gelangte.
Fig. 6. Treppengeländer-Detail aus Prag. Rokoko.
Geradezu auffallend haben sich Barock und
Rokoko auf dem Gebiete der Kunstschmiedearbeiten
breit gemacht. Hier reizte allerdings schon lange
die Fülle herrlichster Vorbilder zur Nachahmung
und es bedurfte nur des richtigen Zeitpunktes, um
den lange verpönten Stilformen wieder allseits Ein-
gang und Gunst zu verschaffen. Die kunstgewerb-
liche Fachklasse, welche von Kunstschlossern frequen-
tirt wird, hat hier die Aufgabe, das vorzeitige, er-
klärliche Drängen der Schüler, Arbeiten im Charakter
des in den Werkstätten beliebten Stiles auch in
der Schule zu fertigen, hintanzuhalten. Nur solche
Schüler, welche manch gutes Stück aus dem 16. Jahr-
hundert gesehen und nachgebildet haben, werden im
stände sein, die Reste organischer Linienentwickelung,
die Reste pflanzlichen Lebens in den technisch so
vollendeten Leistungen der Schlosser aus der Zeit
des 14. und 15. Ludwig zu verstehen und die flotten
Formen zu würdigen. (Fig. 5 u. 6: Rokoko, mit
dem charakteristischen Laubwerk, dessen Blattlappen
teils rückwärts wachsen, teils in krause Muschel-
formen verbildet sind.)
Viele Schüler werden sich leider auch auf diesem
Felde berufen fühlen und nur wenige zu den Aus-
erwählten zählen, welchen es beschieden ist, Erfolge
zu erzielen. Als vortreffliches Mittel (freilich nur für
gut dotirte Schulen) hat sich dem Verfasser be-
währt, Fragmente von Eisenarbeiten jener Zeit an-
zuschaffen und im Unterricht zu verwenden. Solche
Fig 7. Silberkanne. Stil Ludwigs XV.
Modelle sind allen Vorlagen, Photographien etc. weit
vorzuziehen, wo es sich um Erweckung des Verständ-
nisses für die Detailformen handelt.
Nicht ganz gleichen Schritt in der Verbreitung
der vorgenannten Stile hält mit der Eisentechnik die
Edelmetallbearbeitung. Es mag dies zum Teil davon
herrühren, dass unsere Museen unverhältnismäßig
wenig Gutes aus dieser Zeit besitzen und daher die
Goldschmiede sich vorzugsweise noch an die Arbeiten
des 16. und 17. Jahrhunderts halten. Doch macht
sich der Stil der Neuzeit immerhin schon recht be-
merkbar. Eine vortreffliche Sammlung von Tisch-
geräten für Edelmetalle hat P. Germain um die
Mitte des 18. Jahrhunderts herausgegeben; die
71
pedantisch?) ist. Giebellösungen, wie in Fig. 3
skizzirt, mit der in Pseudo-Perspektive wirkenden
Konsol- und Pilasterpartie gehören noch zu ge-
mäßigten Wagnissen des Stils Louis XIV., erfordern
aber doch schon einen gereiften Blick, um sie
würdigen zu können. Gar nicht außergewöhnlich ist
jedoch im Rokokostile eine Lösung wie in Fig. 4
gegeben.
Erschwert wird die Arbeit des Lehrers auf
diesem Gebiet noch wesentlich durch den Umstand,
dass Winkel und Reißschiene bei den Meistern jener
Zeit offenbar keine große Rolle spielten und nicht
leichfeine Architekturform ohne begleitende Orna-
mentik zur Anwendung gelangte.
Fig. 6. Treppengeländer-Detail aus Prag. Rokoko.
Geradezu auffallend haben sich Barock und
Rokoko auf dem Gebiete der Kunstschmiedearbeiten
breit gemacht. Hier reizte allerdings schon lange
die Fülle herrlichster Vorbilder zur Nachahmung
und es bedurfte nur des richtigen Zeitpunktes, um
den lange verpönten Stilformen wieder allseits Ein-
gang und Gunst zu verschaffen. Die kunstgewerb-
liche Fachklasse, welche von Kunstschlossern frequen-
tirt wird, hat hier die Aufgabe, das vorzeitige, er-
klärliche Drängen der Schüler, Arbeiten im Charakter
des in den Werkstätten beliebten Stiles auch in
der Schule zu fertigen, hintanzuhalten. Nur solche
Schüler, welche manch gutes Stück aus dem 16. Jahr-
hundert gesehen und nachgebildet haben, werden im
stände sein, die Reste organischer Linienentwickelung,
die Reste pflanzlichen Lebens in den technisch so
vollendeten Leistungen der Schlosser aus der Zeit
des 14. und 15. Ludwig zu verstehen und die flotten
Formen zu würdigen. (Fig. 5 u. 6: Rokoko, mit
dem charakteristischen Laubwerk, dessen Blattlappen
teils rückwärts wachsen, teils in krause Muschel-
formen verbildet sind.)
Viele Schüler werden sich leider auch auf diesem
Felde berufen fühlen und nur wenige zu den Aus-
erwählten zählen, welchen es beschieden ist, Erfolge
zu erzielen. Als vortreffliches Mittel (freilich nur für
gut dotirte Schulen) hat sich dem Verfasser be-
währt, Fragmente von Eisenarbeiten jener Zeit an-
zuschaffen und im Unterricht zu verwenden. Solche
Fig 7. Silberkanne. Stil Ludwigs XV.
Modelle sind allen Vorlagen, Photographien etc. weit
vorzuziehen, wo es sich um Erweckung des Verständ-
nisses für die Detailformen handelt.
Nicht ganz gleichen Schritt in der Verbreitung
der vorgenannten Stile hält mit der Eisentechnik die
Edelmetallbearbeitung. Es mag dies zum Teil davon
herrühren, dass unsere Museen unverhältnismäßig
wenig Gutes aus dieser Zeit besitzen und daher die
Goldschmiede sich vorzugsweise noch an die Arbeiten
des 16. und 17. Jahrhunderts halten. Doch macht
sich der Stil der Neuzeit immerhin schon recht be-
merkbar. Eine vortreffliche Sammlung von Tisch-
geräten für Edelmetalle hat P. Germain um die
Mitte des 18. Jahrhunderts herausgegeben; die