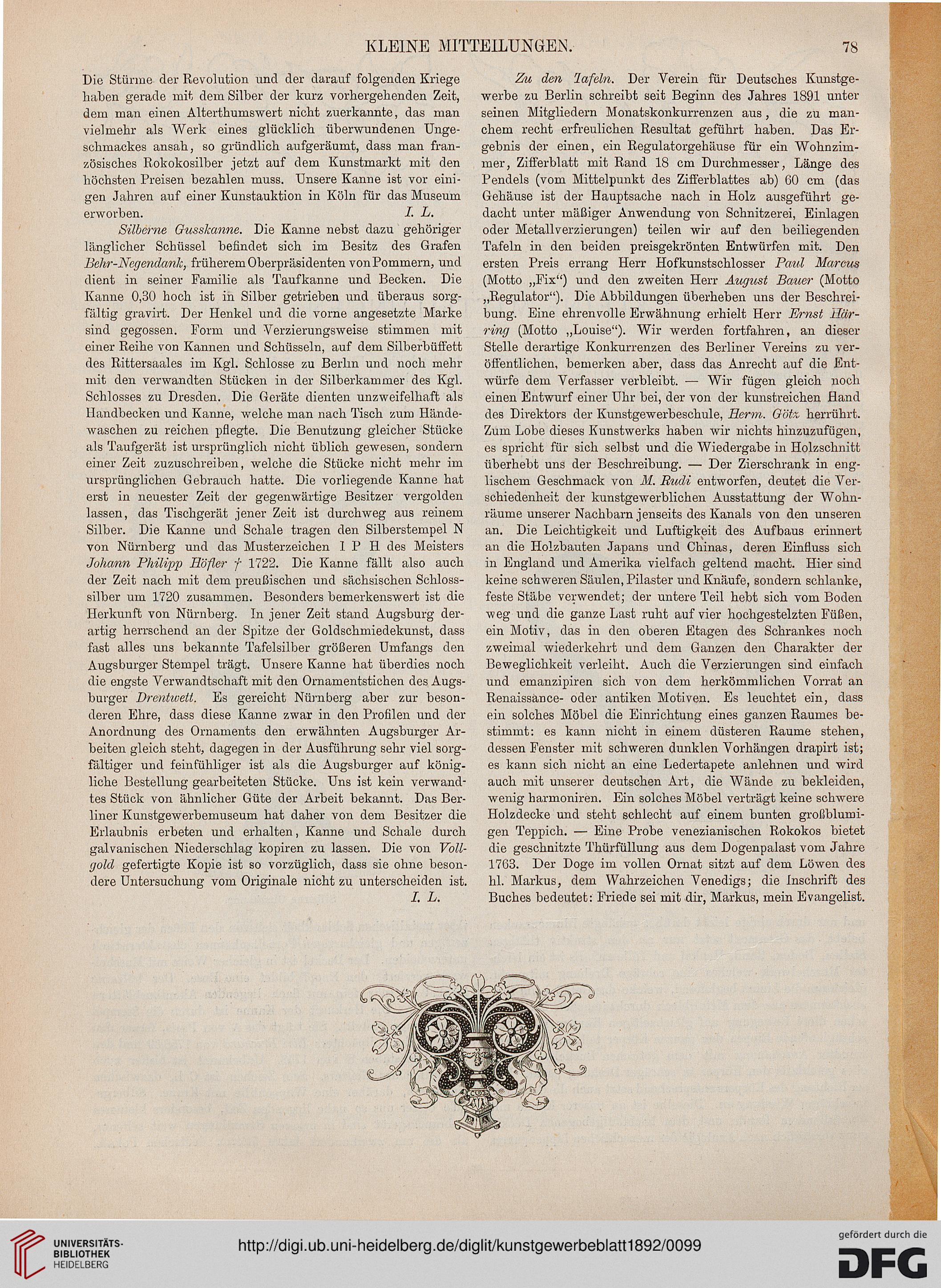KLEINE MITTEILUNGEN.
78
Die Stürme der Revolution und der darauf folgenden Kriege
haben gerade mit dem Silber der kurz vorhergehenden Zeit,
dem man einen Alterthumswert nicht zuerkannte, das man
vielmehr als Werk eines glücklich überwundenen Unge-
schmackes ansah, so gründlich aufgeräumt, dass man fran-
zösisches Rokokosilber jetzt auf dem Kunstmarkt mit den
höchsten Preisen bezahlen muss. Unsere Kanne ist vor eini-
gen Jahren auf einer Kunstauktion in Köln für das Museum
erworben. L L.
Silberne Gusskanne. Die Kanne nebst dazu gehöriger
länglicher Schüssel befindet sich im Besitz des Grafen
Bchr-Negendank, früherem Oberpräsidenten von Pommern, und
dient in seiner Familie als Taufkanne und Becken. Die
Kanne 0,30 hoch ist in Silber getrieben und überaus sorg-
fältig gravirt. Der Henkel und die vorne angesetzte Marke
sind gegossen. Form und Verzierungsweise stimmen mit
einer Reihe von Kannen und Schüsseln, auf dem Silberbüfi'ett
des Rittersaales im Kgl. Schlosse zu Berlin und noch mehr
mit den verwandten Stücken in der Silberkammer des Kgl.
Schlosses zu Dresden. Die Geräte dienten unzweifelhaft als
Handbecken und Kanne, welche man nach Tisch zum Hände-
waschen zu reichen pflegte. Die Benutzung gleicher Stücke
als Taufgerät ist ursprünglich nicht üblich gewesen, sondern
einer Zeit zuzuschreiben, welche die Stücke nicht mehr im
ursprünglichen Gebrauch hatte. Die vorliegende Kanne hat
erst in neuester Zeit der gegenwärtige Besitzer vergolden
lassen, das Tischgerät jener Zeit ist durchweg aus reinem
Silber. Die Kanne und Schale tragen den Silberstempel N
von Nürnberg und das Musterzeichen 1 P H des Meisters
Johann Philipp Röfler f 1722. Die Kanne fällt also auch
der Zeit nach mit dem preußischen und sächsischen Schloss-
silber um 1720 zusammen. Besonders bemerkenswert ist die
Herkunft von Nürnberg. In jener Zeit stand Augsburg der-
artig herrschend an der Spitze der Goldschmiedekunst, dass
fast alles uns bekannte Tafelsilber größeren Umfangs den
Augsburger Stempel trägt. Unsere Kanne hat überdies noch
die engste Verwandtschaft mit den Ornamentstichen des Augs-
burger Drentwelt. Es gereicht Nürnberg aber zur beson-
deren Ehre, dass diese Kanne zwar in den Profilen und der
Anordnung des Ornaments den erwähnten Augsburger Ar-
beiten gleich steht, dagegen in der Ausführung sehr viel sorg-
fältiger und feinfühliger ist als die Augsburger auf könig-
liche Bestellung gearbeiteten Stücke. Uns ist kein verwand-
tes Stück von ähnlicher Güte der Arbeit bekannt. Das Ber-
liner Kunstgewerbemuseum hat daher von dem Besitzer die
Erlaubnis erbeten und erhalten, Kanne und Schale durch
galvanischen Niederschlag kopiren zu lassen. Die von Voll-
gold gefertigte Kopie ist so vorzüglich, dass sie ohne beson-
dere Untersuchung vom Originale nicht zu unterscheiden ist.
I. L.
Zu den tafeln. Der Verein für Deutsches Kunstge-
werbe zu Berlin schreibt seit Beginn des Jahres 1891 unter
seinen Mitgliedern Monatskonkurrenzen aus, die zu man-
chem recht erfreulichen Resultat geführt haben. Das Er-
gebnis der einen, ein Regulatorgehäuse für ein Wohnzim-
mer, Zifferblatt mit Rand 18 cm Durchmesser, Länge des
Pendels (vom Mittelpunkt des Zifferblattes ab) 60 cm (das
Gehäuse ist der Hauptsache nach in Holz ausgeführt ge-
dacht unter mäßiger Anwendung von Schnitzerei, Einlagen
oder Metallverzierungen) teilen wir auf den beiliegenden
Tafeln in den beiden preisgekrönten Entwürfen mit. Den
ersten Preis errang Herr Hofkunstschlosser Paul Marcus
(Motto „Fix") und den zweiten Herr August Bauer (Motto
„Regulator"). Die Abbildungen überheben uns der Beschrei-
bung. Eine ehrenvolle Erwähnung erhielt Herr Ernst Här-
ring (Motto „Louise"). Wir werden fortfahren, an dieser
Stelle derartige Konkurrenzen des Berliner Vereins zu ver-
öffentlichen, bemerken aber, dass das Anrecht auf die Ent-
würfe dem Verfasser verbleibt. — Wir fügen gleich noch
einen Entwurf einer Uhr bei, der von der kunstreichen Hand
des Direktors der Kunstgewerbeschule, Herrn. Götz herrührt.
Zum Lobe dieses Kunstwerks haben wir nichts hinzuzufügen,
es spricht für sich selbst und die Wiedergabe in Holzschnitt
überhebt uns der Beschreibung. — Der Zierschrank in eng-
lischem Geschmack von M. Rudi entworfen, deutet die Ver-
schiedenheit der kunstgewerblichen Ausstattang der Wohn-
räume unserer Nachbarn jenseits des Kanals von den unseren
an. Die Leichtigkeit und Luftigkeit des Aufbaus erinnert
an die Holzbauten Japans und Chinas, deren Einfluss sich
in England und Amerika vielfach geltend macht. Hier sind
keine schweren Säulen, Pilaster und Knäufe, sondern schlanke,
feste Stäbe verwendet; der untere Teil hebt sich vom Boden
weg und die ganze Last ruht auf vier hochgostelzten Füßen,
ein Motiv, das in den oberen Etagen des Schrankes noch
zweimal wiederkehrt und dem Ganzen den Charakter der
Beweglichkeit verleiht. Auch die Verzierungen sind einfach
und emanzipiren sich von dem herkömmlichen Vorrat an
Renaissance- oder antiken Motiven. Es leuchtet ein, dass
ein solches Möbel die Einrichtung eines ganzen Raumes be-
stimmt: es kann nicht in einem düsteren Räume stehen,
dessen Fenster mit schweren dunklen Vorhängen drapirt ist;
es kann sich nicht an eine Ledertapete anlehnen und wird
auch mit unserer deutschen Art, die Wände zu bekleiden,
wenig harmoniren. Ein solches Möbel verträgt keine schwere
Holzdecke und steht schlecht auf einem bunten großblumi-
gen Teppich. — Eine Probe venezianischen Rokokos bietet
die geschnitzte Thürfüllung aus dem Dogenpalast vom Jahre
1763. Der Doge im vollen Ornat sitzt auf dem Löwen des
hl. Markus, dem Wahrzeichen Venedigs; die Inschrift des
Buches bedeutet: Friede sei mit dir, Markus, mein Evangelist.
78
Die Stürme der Revolution und der darauf folgenden Kriege
haben gerade mit dem Silber der kurz vorhergehenden Zeit,
dem man einen Alterthumswert nicht zuerkannte, das man
vielmehr als Werk eines glücklich überwundenen Unge-
schmackes ansah, so gründlich aufgeräumt, dass man fran-
zösisches Rokokosilber jetzt auf dem Kunstmarkt mit den
höchsten Preisen bezahlen muss. Unsere Kanne ist vor eini-
gen Jahren auf einer Kunstauktion in Köln für das Museum
erworben. L L.
Silberne Gusskanne. Die Kanne nebst dazu gehöriger
länglicher Schüssel befindet sich im Besitz des Grafen
Bchr-Negendank, früherem Oberpräsidenten von Pommern, und
dient in seiner Familie als Taufkanne und Becken. Die
Kanne 0,30 hoch ist in Silber getrieben und überaus sorg-
fältig gravirt. Der Henkel und die vorne angesetzte Marke
sind gegossen. Form und Verzierungsweise stimmen mit
einer Reihe von Kannen und Schüsseln, auf dem Silberbüfi'ett
des Rittersaales im Kgl. Schlosse zu Berlin und noch mehr
mit den verwandten Stücken in der Silberkammer des Kgl.
Schlosses zu Dresden. Die Geräte dienten unzweifelhaft als
Handbecken und Kanne, welche man nach Tisch zum Hände-
waschen zu reichen pflegte. Die Benutzung gleicher Stücke
als Taufgerät ist ursprünglich nicht üblich gewesen, sondern
einer Zeit zuzuschreiben, welche die Stücke nicht mehr im
ursprünglichen Gebrauch hatte. Die vorliegende Kanne hat
erst in neuester Zeit der gegenwärtige Besitzer vergolden
lassen, das Tischgerät jener Zeit ist durchweg aus reinem
Silber. Die Kanne und Schale tragen den Silberstempel N
von Nürnberg und das Musterzeichen 1 P H des Meisters
Johann Philipp Röfler f 1722. Die Kanne fällt also auch
der Zeit nach mit dem preußischen und sächsischen Schloss-
silber um 1720 zusammen. Besonders bemerkenswert ist die
Herkunft von Nürnberg. In jener Zeit stand Augsburg der-
artig herrschend an der Spitze der Goldschmiedekunst, dass
fast alles uns bekannte Tafelsilber größeren Umfangs den
Augsburger Stempel trägt. Unsere Kanne hat überdies noch
die engste Verwandtschaft mit den Ornamentstichen des Augs-
burger Drentwelt. Es gereicht Nürnberg aber zur beson-
deren Ehre, dass diese Kanne zwar in den Profilen und der
Anordnung des Ornaments den erwähnten Augsburger Ar-
beiten gleich steht, dagegen in der Ausführung sehr viel sorg-
fältiger und feinfühliger ist als die Augsburger auf könig-
liche Bestellung gearbeiteten Stücke. Uns ist kein verwand-
tes Stück von ähnlicher Güte der Arbeit bekannt. Das Ber-
liner Kunstgewerbemuseum hat daher von dem Besitzer die
Erlaubnis erbeten und erhalten, Kanne und Schale durch
galvanischen Niederschlag kopiren zu lassen. Die von Voll-
gold gefertigte Kopie ist so vorzüglich, dass sie ohne beson-
dere Untersuchung vom Originale nicht zu unterscheiden ist.
I. L.
Zu den tafeln. Der Verein für Deutsches Kunstge-
werbe zu Berlin schreibt seit Beginn des Jahres 1891 unter
seinen Mitgliedern Monatskonkurrenzen aus, die zu man-
chem recht erfreulichen Resultat geführt haben. Das Er-
gebnis der einen, ein Regulatorgehäuse für ein Wohnzim-
mer, Zifferblatt mit Rand 18 cm Durchmesser, Länge des
Pendels (vom Mittelpunkt des Zifferblattes ab) 60 cm (das
Gehäuse ist der Hauptsache nach in Holz ausgeführt ge-
dacht unter mäßiger Anwendung von Schnitzerei, Einlagen
oder Metallverzierungen) teilen wir auf den beiliegenden
Tafeln in den beiden preisgekrönten Entwürfen mit. Den
ersten Preis errang Herr Hofkunstschlosser Paul Marcus
(Motto „Fix") und den zweiten Herr August Bauer (Motto
„Regulator"). Die Abbildungen überheben uns der Beschrei-
bung. Eine ehrenvolle Erwähnung erhielt Herr Ernst Här-
ring (Motto „Louise"). Wir werden fortfahren, an dieser
Stelle derartige Konkurrenzen des Berliner Vereins zu ver-
öffentlichen, bemerken aber, dass das Anrecht auf die Ent-
würfe dem Verfasser verbleibt. — Wir fügen gleich noch
einen Entwurf einer Uhr bei, der von der kunstreichen Hand
des Direktors der Kunstgewerbeschule, Herrn. Götz herrührt.
Zum Lobe dieses Kunstwerks haben wir nichts hinzuzufügen,
es spricht für sich selbst und die Wiedergabe in Holzschnitt
überhebt uns der Beschreibung. — Der Zierschrank in eng-
lischem Geschmack von M. Rudi entworfen, deutet die Ver-
schiedenheit der kunstgewerblichen Ausstattang der Wohn-
räume unserer Nachbarn jenseits des Kanals von den unseren
an. Die Leichtigkeit und Luftigkeit des Aufbaus erinnert
an die Holzbauten Japans und Chinas, deren Einfluss sich
in England und Amerika vielfach geltend macht. Hier sind
keine schweren Säulen, Pilaster und Knäufe, sondern schlanke,
feste Stäbe verwendet; der untere Teil hebt sich vom Boden
weg und die ganze Last ruht auf vier hochgostelzten Füßen,
ein Motiv, das in den oberen Etagen des Schrankes noch
zweimal wiederkehrt und dem Ganzen den Charakter der
Beweglichkeit verleiht. Auch die Verzierungen sind einfach
und emanzipiren sich von dem herkömmlichen Vorrat an
Renaissance- oder antiken Motiven. Es leuchtet ein, dass
ein solches Möbel die Einrichtung eines ganzen Raumes be-
stimmt: es kann nicht in einem düsteren Räume stehen,
dessen Fenster mit schweren dunklen Vorhängen drapirt ist;
es kann sich nicht an eine Ledertapete anlehnen und wird
auch mit unserer deutschen Art, die Wände zu bekleiden,
wenig harmoniren. Ein solches Möbel verträgt keine schwere
Holzdecke und steht schlecht auf einem bunten großblumi-
gen Teppich. — Eine Probe venezianischen Rokokos bietet
die geschnitzte Thürfüllung aus dem Dogenpalast vom Jahre
1763. Der Doge im vollen Ornat sitzt auf dem Löwen des
hl. Markus, dem Wahrzeichen Venedigs; die Inschrift des
Buches bedeutet: Friede sei mit dir, Markus, mein Evangelist.