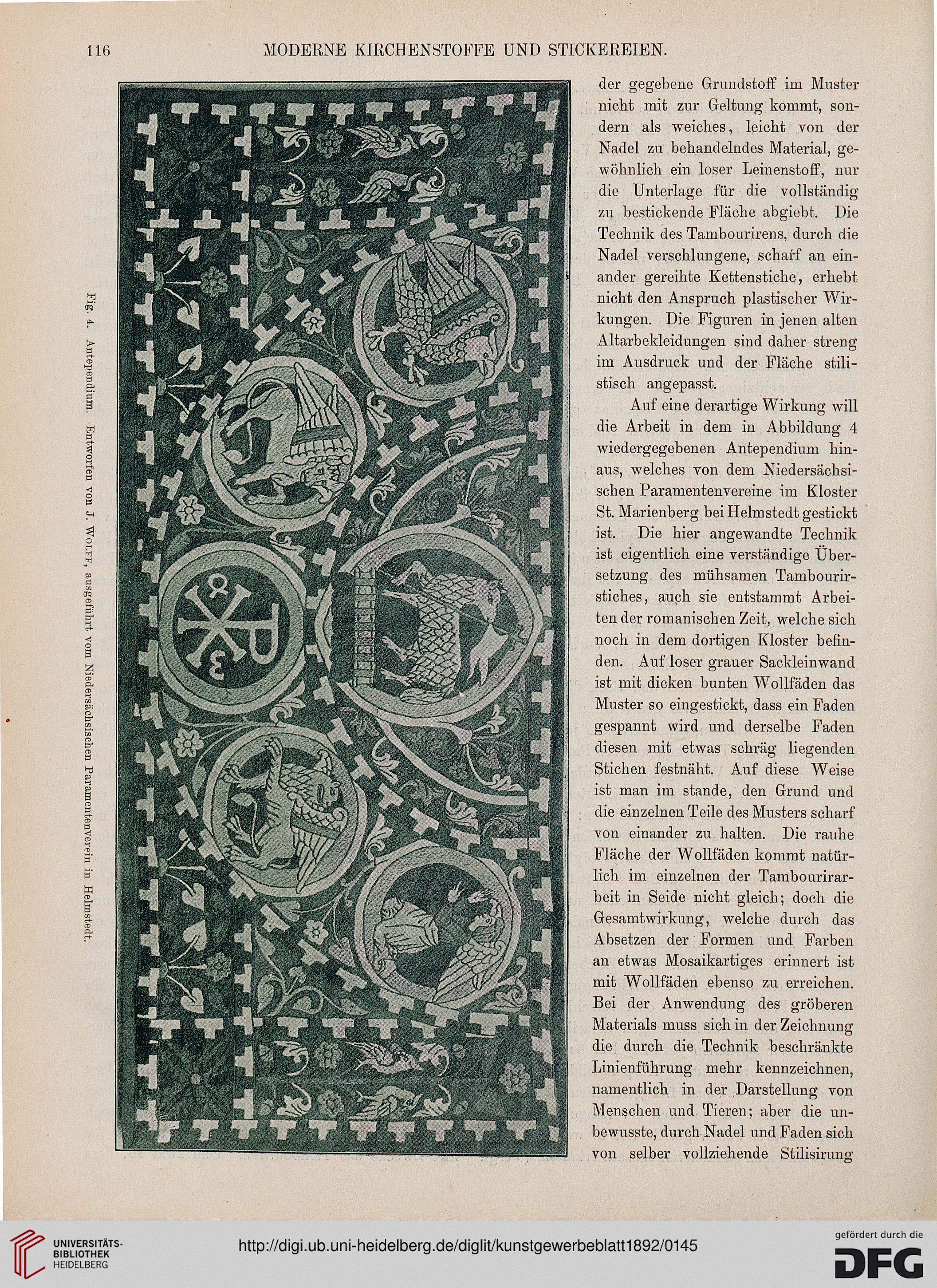116
MODERNE KIRCHENSTOFFE UND STICKEREIEN.
3
der gegebene Grundstoff im Muster
nicht mit zur Geltung kommt, son-
dern als weiches, leicht von der
Nadel zu behandelndes Material, ge-
wöhnlich ein loser Leinenstoff, nur
die Unterlage für die vollständig
zu bestickende Fläche abgiebt. Die
Technik des Tambourirens, durch die
Nadel verschlungene, scharf an ein-
ander gereihte Kettenstiche, erhebt
nicht den Anspruch plastischer Wir-
kungen. Die Figuren in jenen alten
Altarbekleidungen sind daher streng
im Ausdruck und der Fläche stili-
stisch angepasst.
Auf eine derartige Wirkung will
die Arbeit in dem in Abbildung 4
wiedergegebenen Antependium hin-
aus, welches von dem Niedersächsi-
schen Paramentenvereine im Kloster
St. Marienberg bei Helmstedt gestickt
ist. Die hier angewandte Technik
ist eigentlich eine verständige Über-
setzung des mühsamen Tambourir-
stiches, auph sie entstammt Arbei-
ten der romanischen Zeit, welche sich
noch in dem dortigen Kloster befin-
den. Auf loser grauer Sackleinwand
ist mit dicken bunten Wollfäden das
Muster so eingestickt, dass ein Faden
gespannt wird und derselbe Faden
diesen mit etwas schräg liegenden
Stichen festnäht. Auf diese Weise
ist man im stände, den Grund und
die einzelnen Teile des Musters scharf
von einander zu halten. Die rauhe
Fläche der Wollfäden kommt natür-
lich im einzelnen der Tambourirar-
beit in Seide nicht gleich; doch die
Gesamt Wirkung, welche durch das
Absetzen der Formen und Farben
an etwas Mosaikartiges erinnert ist
mit Wollfäden ebenso zu erreichen.
Bei der Anwendung des gröberen
Materials muss sich in der Zeichnung
die durch die Technik beschränkte
Linienführung mehr kennzeichnen,
namentlich in der Darstellung von
Menschen und Tieren; aber die un-
bewusste, durch Nadel und Faden sich
von selber vollziehende Stilisirung
MODERNE KIRCHENSTOFFE UND STICKEREIEN.
3
der gegebene Grundstoff im Muster
nicht mit zur Geltung kommt, son-
dern als weiches, leicht von der
Nadel zu behandelndes Material, ge-
wöhnlich ein loser Leinenstoff, nur
die Unterlage für die vollständig
zu bestickende Fläche abgiebt. Die
Technik des Tambourirens, durch die
Nadel verschlungene, scharf an ein-
ander gereihte Kettenstiche, erhebt
nicht den Anspruch plastischer Wir-
kungen. Die Figuren in jenen alten
Altarbekleidungen sind daher streng
im Ausdruck und der Fläche stili-
stisch angepasst.
Auf eine derartige Wirkung will
die Arbeit in dem in Abbildung 4
wiedergegebenen Antependium hin-
aus, welches von dem Niedersächsi-
schen Paramentenvereine im Kloster
St. Marienberg bei Helmstedt gestickt
ist. Die hier angewandte Technik
ist eigentlich eine verständige Über-
setzung des mühsamen Tambourir-
stiches, auph sie entstammt Arbei-
ten der romanischen Zeit, welche sich
noch in dem dortigen Kloster befin-
den. Auf loser grauer Sackleinwand
ist mit dicken bunten Wollfäden das
Muster so eingestickt, dass ein Faden
gespannt wird und derselbe Faden
diesen mit etwas schräg liegenden
Stichen festnäht. Auf diese Weise
ist man im stände, den Grund und
die einzelnen Teile des Musters scharf
von einander zu halten. Die rauhe
Fläche der Wollfäden kommt natür-
lich im einzelnen der Tambourirar-
beit in Seide nicht gleich; doch die
Gesamt Wirkung, welche durch das
Absetzen der Formen und Farben
an etwas Mosaikartiges erinnert ist
mit Wollfäden ebenso zu erreichen.
Bei der Anwendung des gröberen
Materials muss sich in der Zeichnung
die durch die Technik beschränkte
Linienführung mehr kennzeichnen,
namentlich in der Darstellung von
Menschen und Tieren; aber die un-
bewusste, durch Nadel und Faden sich
von selber vollziehende Stilisirung