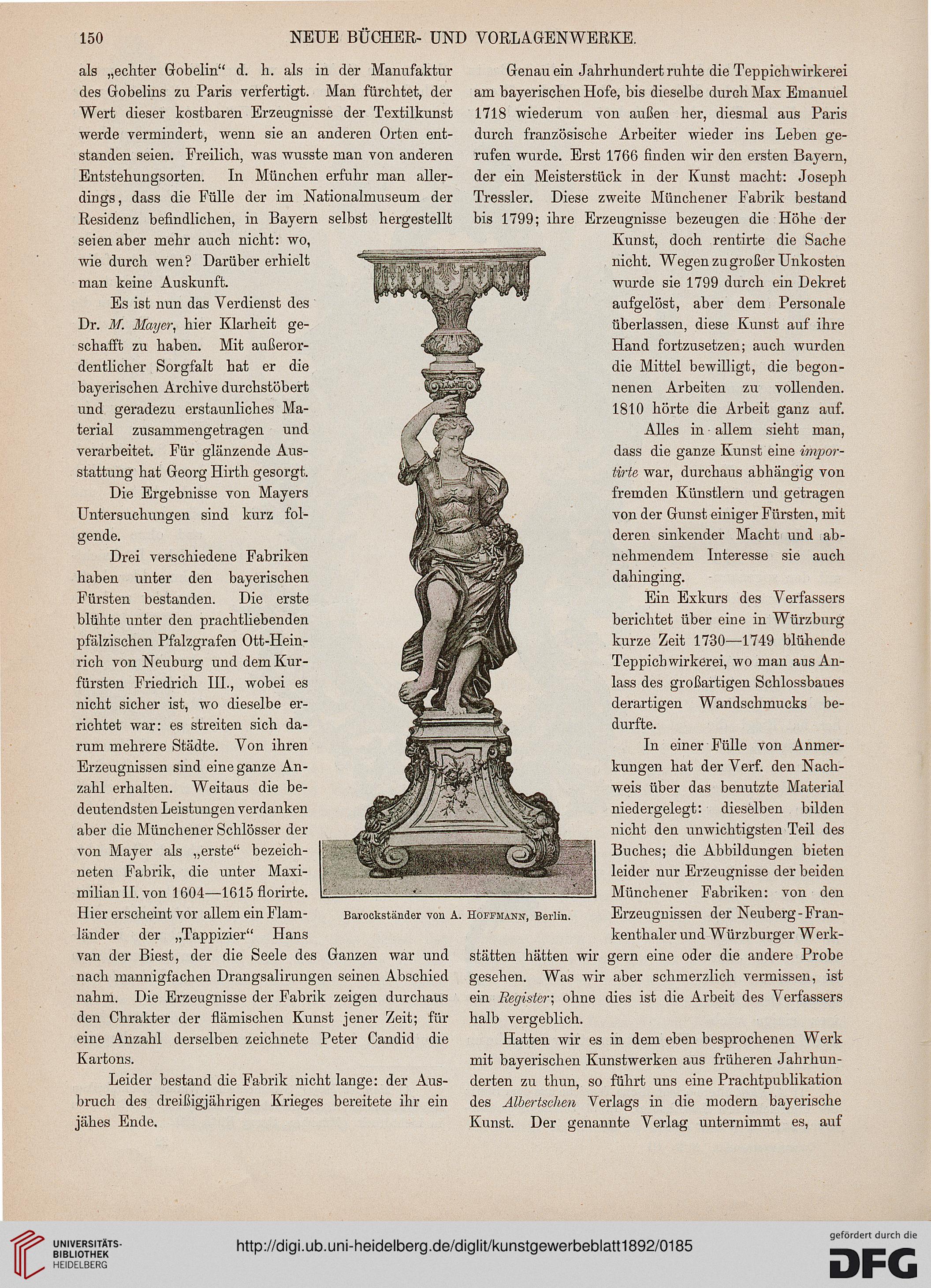150
NEUE BÜCHER- UND VORLAGENWERKE.
als „echter Gobelin" d. h. als in der Manufaktur
des Gobelins zu Paris verfertigt. Man fürchtet, der
Wert dieser kostbaren Erzeugnisse der Textilkunst
werde vermindert, wenn sie an anderen Orten ent-
standen seien. Freilich, was wusste man von anderen
Entstehungsorten. In München erfuhr man aller-
dings, dass die Fülle der im Nationalmuseum der
Residenz befindlichen, in Bayern selbst hergestellt
seien aber mehr auch nicht: wo,
wie durch wen? Darüber erhielt
man keine Auskunft.
Es ist nun das Verdienst des
Dr. M. Mayer, hier Klarheit ge-
schafft zu haben. Mit außeror-
dentlicher Sorgfalt hat er die
bayerischen Archive durchstöbert
und geradezu erstaunliches Ma-
terial zusammengetragen und
verarbeitet. Für glänzende Aus-
stattung hat Georg Hirth gesorgt.
Die Ergebnisse von Mayers
Untersuchungen sind kurz fol-
gende.
Drei verschiedene Fabriken
haben unter den bayerischen
Fürsten bestanden. Die erste
blühte unter den prachtliebenden
pfälzischen Pfalzgrafen Ott-Hein-
rich von Neuburg und dem Kur-
fürsten Friedrich III., wobei es
nicht sicher ist, wo dieselbe er-
richtet war: es streiten sich da-
rum mehrere Städte. Von ihren
Erzeugnissen sind eine ganze An-
zahl erhalten. Weitaus die be-
deutendsten Leistungen verdanken
aber die Münchener Schlösser der
von Mayer als „erste" bezeich-
neten Fabrik, die unter Maxi-
milian II. von 1604—1615 fiorirte.
Hier erscheint vor allem ein Flam-
länder der „Tappizier" Hans
van der Biest, der die Seele des Ganzen war und
nach mannigfachen Drangsalirungen seinen Abschied
nahm. Die Erzeugnisse der Fabrik zeigen durchaus
den Chrakter der flämischen Kunst jener Zeit; für
eine Anzahl derselben zeichnete Peter Candid die
Kartons.
Leider bestand die Fabrik nicht lange: der Aus-
bruch des dreißigjährigen Krieges bereitete ihr ein
jähes Ende.
Barockständer von A. Hoffmann, Berlin
Genau ein Jahrhundert ruhte die Teppich Wirkerei
am bayerischen Hofe, bis dieselbe durch Max Emanuel
1718 wiederum von außen her, diesmal aus Paris
durch französische Arbeiter wieder ins Leben ge-
rufen wurde. Erst 1766 finden wir den ersten Bayern,
der ein Meisterstück in der Kunst macht: Joseph
Tressler. Diese zweite Münchener Fabrik bestand
bis 1799; ihre Erzeugnisse bezeugen die Höhe der
Kunst, doch rentirte die Sache
nicht. Wegen zu großer Unkosten
wurde sie 1799 durch ein Dekret
aufgelöst, aber dem Personale
überlassen, diese Kunst auf ihre
Hand fortzusetzen; auch wurden
die Mittel bewilligt, die begon-
nenen Arbeiten zu vollenden.
1810 hörte die Arbeit ganz auf.
Alles in • allem sieht man,
dass die ganze Kunst eine impor-
tirte war, durchaus abhängig von
fremden Künstlern und getragen
von der Gunst einiger Fürsten, mit
deren sinkender Macht und ab-
nehmendem Interesse sie auch
dahinging.
Ein Exkurs des Verfassers
berichtet über eine in Würzburg
kurze Zeit 1730—1749 blühende
Teppich wirkerei, wo man ausAn-
lass des großartigen Schlossbaues
derartigen Wandschmucks be-
durfte.
In einer Fülle von Anmer-
kungen hat der Verf. den Nach-
weis über das benutzte Material
niedergelegt: dieselben bilden
nicht den unwichtigsten Teil des
Buches; die Abbildungen bieten
leider nur Erzeugnisse der beiden
Münchener Fabriken: von den
Erzeugnissen der Neuberg-Fran-
kenthaler und Würzburger Werk-
stätten hätten wir gern eine oder die andere Probe
gesehen. Was wir aber schmerzlich vermissen, ist
ein Register; ohne dies ist die Arbeit des Verfassers
halb vergeblich.
Hatten wir es in dem eben besprochenen Werk
mit bayerischen Kunstwerken aus früheren Jahrhun-
derten zu thun, so führt uns eine Prachtpublikation
des Albertschen Verlags in die modern bayerische
Kunst. Der genannte Verlag unternimmt es, auf
NEUE BÜCHER- UND VORLAGENWERKE.
als „echter Gobelin" d. h. als in der Manufaktur
des Gobelins zu Paris verfertigt. Man fürchtet, der
Wert dieser kostbaren Erzeugnisse der Textilkunst
werde vermindert, wenn sie an anderen Orten ent-
standen seien. Freilich, was wusste man von anderen
Entstehungsorten. In München erfuhr man aller-
dings, dass die Fülle der im Nationalmuseum der
Residenz befindlichen, in Bayern selbst hergestellt
seien aber mehr auch nicht: wo,
wie durch wen? Darüber erhielt
man keine Auskunft.
Es ist nun das Verdienst des
Dr. M. Mayer, hier Klarheit ge-
schafft zu haben. Mit außeror-
dentlicher Sorgfalt hat er die
bayerischen Archive durchstöbert
und geradezu erstaunliches Ma-
terial zusammengetragen und
verarbeitet. Für glänzende Aus-
stattung hat Georg Hirth gesorgt.
Die Ergebnisse von Mayers
Untersuchungen sind kurz fol-
gende.
Drei verschiedene Fabriken
haben unter den bayerischen
Fürsten bestanden. Die erste
blühte unter den prachtliebenden
pfälzischen Pfalzgrafen Ott-Hein-
rich von Neuburg und dem Kur-
fürsten Friedrich III., wobei es
nicht sicher ist, wo dieselbe er-
richtet war: es streiten sich da-
rum mehrere Städte. Von ihren
Erzeugnissen sind eine ganze An-
zahl erhalten. Weitaus die be-
deutendsten Leistungen verdanken
aber die Münchener Schlösser der
von Mayer als „erste" bezeich-
neten Fabrik, die unter Maxi-
milian II. von 1604—1615 fiorirte.
Hier erscheint vor allem ein Flam-
länder der „Tappizier" Hans
van der Biest, der die Seele des Ganzen war und
nach mannigfachen Drangsalirungen seinen Abschied
nahm. Die Erzeugnisse der Fabrik zeigen durchaus
den Chrakter der flämischen Kunst jener Zeit; für
eine Anzahl derselben zeichnete Peter Candid die
Kartons.
Leider bestand die Fabrik nicht lange: der Aus-
bruch des dreißigjährigen Krieges bereitete ihr ein
jähes Ende.
Barockständer von A. Hoffmann, Berlin
Genau ein Jahrhundert ruhte die Teppich Wirkerei
am bayerischen Hofe, bis dieselbe durch Max Emanuel
1718 wiederum von außen her, diesmal aus Paris
durch französische Arbeiter wieder ins Leben ge-
rufen wurde. Erst 1766 finden wir den ersten Bayern,
der ein Meisterstück in der Kunst macht: Joseph
Tressler. Diese zweite Münchener Fabrik bestand
bis 1799; ihre Erzeugnisse bezeugen die Höhe der
Kunst, doch rentirte die Sache
nicht. Wegen zu großer Unkosten
wurde sie 1799 durch ein Dekret
aufgelöst, aber dem Personale
überlassen, diese Kunst auf ihre
Hand fortzusetzen; auch wurden
die Mittel bewilligt, die begon-
nenen Arbeiten zu vollenden.
1810 hörte die Arbeit ganz auf.
Alles in • allem sieht man,
dass die ganze Kunst eine impor-
tirte war, durchaus abhängig von
fremden Künstlern und getragen
von der Gunst einiger Fürsten, mit
deren sinkender Macht und ab-
nehmendem Interesse sie auch
dahinging.
Ein Exkurs des Verfassers
berichtet über eine in Würzburg
kurze Zeit 1730—1749 blühende
Teppich wirkerei, wo man ausAn-
lass des großartigen Schlossbaues
derartigen Wandschmucks be-
durfte.
In einer Fülle von Anmer-
kungen hat der Verf. den Nach-
weis über das benutzte Material
niedergelegt: dieselben bilden
nicht den unwichtigsten Teil des
Buches; die Abbildungen bieten
leider nur Erzeugnisse der beiden
Münchener Fabriken: von den
Erzeugnissen der Neuberg-Fran-
kenthaler und Würzburger Werk-
stätten hätten wir gern eine oder die andere Probe
gesehen. Was wir aber schmerzlich vermissen, ist
ein Register; ohne dies ist die Arbeit des Verfassers
halb vergeblich.
Hatten wir es in dem eben besprochenen Werk
mit bayerischen Kunstwerken aus früheren Jahrhun-
derten zu thun, so führt uns eine Prachtpublikation
des Albertschen Verlags in die modern bayerische
Kunst. Der genannte Verlag unternimmt es, auf