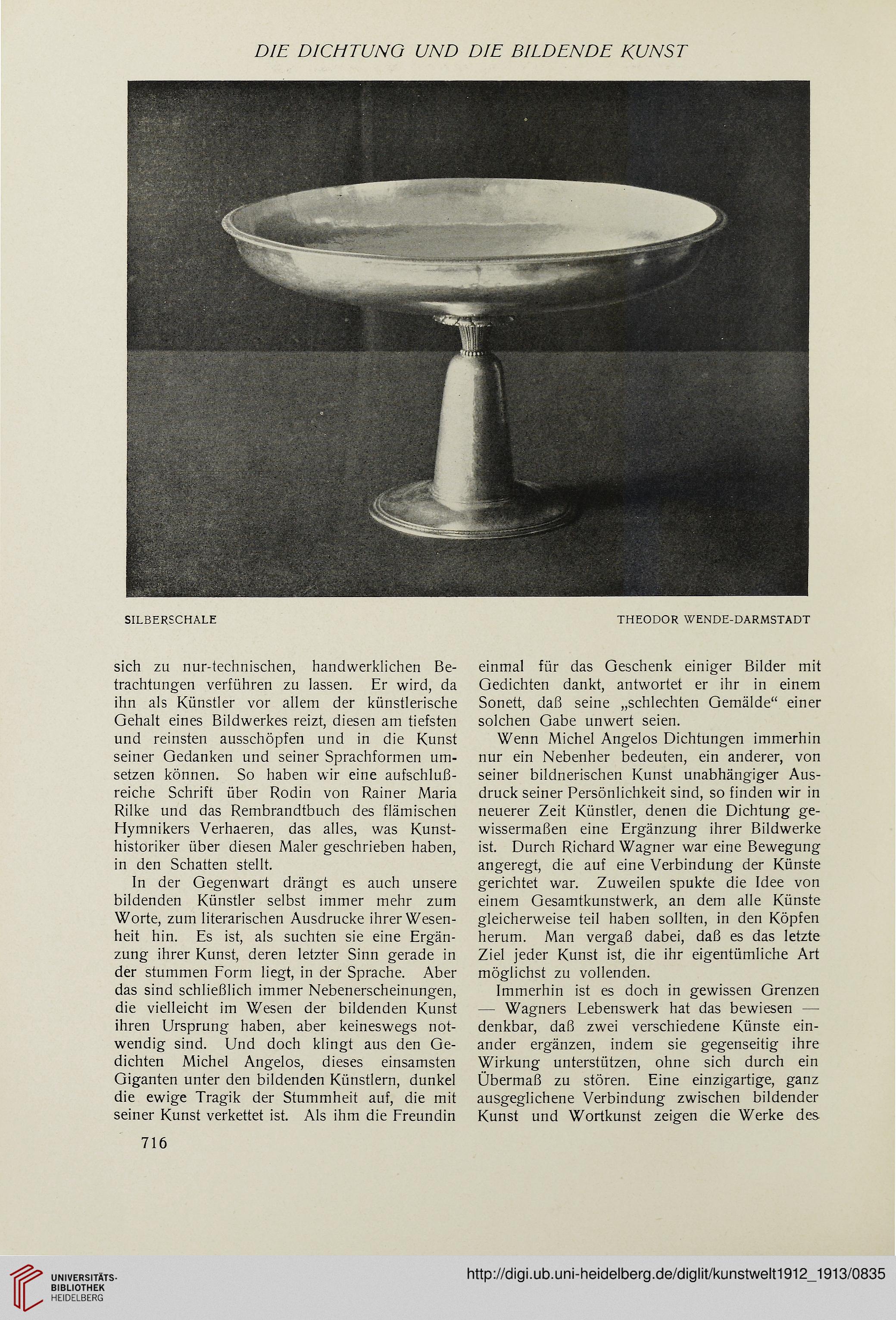sich zu nur-technischen, handwerklichen Be-
trachtungen verführen zu lassen. Er wird, da
ihn als Künstler vor allem der künstlerische
Gehalt eines Bildwerkes reizt, diesen am tiefsten
und reinsten ausschöpfen und in die Kunst
seiner Gedanken und seiner Sprachformen um-
setzen können. So haben wir eine aufschluß-
reiche Schrift über Rodin von Rainer Maria
Rilke und das Rembrandtbuch des flämischen
Hymnikers Verhaeren, das alles, was Kunst-
historiker über diesen Maler geschrieben haben,
in den Schatten stellt.
In der Gegenwart drängt es auch unsere
bildenden Künstler selbst immer mehr zum
Worte, zum literarischen Ausdrucke ihrer Wesen-
heit hin. Es ist, als suchten sie eine Ergän-
zung ihrer Kunst, deren letzter Sinn gerade in
der stummen Form liegt, in der Sprache. Aber
das sind schließlich immer Nebenerscheinungen,
die vielleicht im Wesen der bildenden Kunst
ihren Ursprung haben, aber keineswegs not-
wendig sind. Und doch klingt aus den Ge-
dichten Michel Angelos, dieses einsamsten
Giganten unter den bildenden Künstlern, dunkel
die ewige Tragik der Stummheit auf, die mit
seiner Kunst verkettet ist. Als ihm die Freundin
einmal für das Geschenk einiger Bilder mit
Gedichten dankt, antwortet er ihr in einem
Sonett, daß seine „schlechten Gemälde" einer
solchen Gabe unwert seien.
Wenn Michel Angelos Dichtungen immerhin
nur ein Nebenher bedeuten, ein anderer, von
seiner bildnerischen Kunst unabhängiger Aus-
druck seiner Persönlichkeit sind, so finden wir in
neuerer Zeit Künstler, denen die Dichtung ge-
wissermaßen eine Ergänzung ihrer Bildwerke
ist. Durch Richard Wagner war eine Bewegung
angeregt, die auf eine Verbindung der Künste
gerichtet war. Zuweilen spukte die Idee von
einem Gesamtkunstwerk, an dem alle Künste
gleicherweise teil haben sollten, in den Köpfen
herum. Man vergaß dabei, daß es das letzte
Ziel jeder Kunst ist, die ihr eigentümliche Art
möglichst zu vollenden.
Immerhin ist es doch in gewissen Grenzen
— Wagners Lebenswerk hat das bewiesen —
denkbar, daß zwei verschiedene Künste ein-
ander ergänzen, indem sie gegenseitig ihre
Wirkung unterstützen, ohne sich durch ein
Übermaß zu stören. Eine einzigartige, ganz
ausgeglichene Verbindung zwischen bildender
Kunst und Wortkunst zeigen die Werke des
716
trachtungen verführen zu lassen. Er wird, da
ihn als Künstler vor allem der künstlerische
Gehalt eines Bildwerkes reizt, diesen am tiefsten
und reinsten ausschöpfen und in die Kunst
seiner Gedanken und seiner Sprachformen um-
setzen können. So haben wir eine aufschluß-
reiche Schrift über Rodin von Rainer Maria
Rilke und das Rembrandtbuch des flämischen
Hymnikers Verhaeren, das alles, was Kunst-
historiker über diesen Maler geschrieben haben,
in den Schatten stellt.
In der Gegenwart drängt es auch unsere
bildenden Künstler selbst immer mehr zum
Worte, zum literarischen Ausdrucke ihrer Wesen-
heit hin. Es ist, als suchten sie eine Ergän-
zung ihrer Kunst, deren letzter Sinn gerade in
der stummen Form liegt, in der Sprache. Aber
das sind schließlich immer Nebenerscheinungen,
die vielleicht im Wesen der bildenden Kunst
ihren Ursprung haben, aber keineswegs not-
wendig sind. Und doch klingt aus den Ge-
dichten Michel Angelos, dieses einsamsten
Giganten unter den bildenden Künstlern, dunkel
die ewige Tragik der Stummheit auf, die mit
seiner Kunst verkettet ist. Als ihm die Freundin
einmal für das Geschenk einiger Bilder mit
Gedichten dankt, antwortet er ihr in einem
Sonett, daß seine „schlechten Gemälde" einer
solchen Gabe unwert seien.
Wenn Michel Angelos Dichtungen immerhin
nur ein Nebenher bedeuten, ein anderer, von
seiner bildnerischen Kunst unabhängiger Aus-
druck seiner Persönlichkeit sind, so finden wir in
neuerer Zeit Künstler, denen die Dichtung ge-
wissermaßen eine Ergänzung ihrer Bildwerke
ist. Durch Richard Wagner war eine Bewegung
angeregt, die auf eine Verbindung der Künste
gerichtet war. Zuweilen spukte die Idee von
einem Gesamtkunstwerk, an dem alle Künste
gleicherweise teil haben sollten, in den Köpfen
herum. Man vergaß dabei, daß es das letzte
Ziel jeder Kunst ist, die ihr eigentümliche Art
möglichst zu vollenden.
Immerhin ist es doch in gewissen Grenzen
— Wagners Lebenswerk hat das bewiesen —
denkbar, daß zwei verschiedene Künste ein-
ander ergänzen, indem sie gegenseitig ihre
Wirkung unterstützen, ohne sich durch ein
Übermaß zu stören. Eine einzigartige, ganz
ausgeglichene Verbindung zwischen bildender
Kunst und Wortkunst zeigen die Werke des
716